JCSW 45 (2004): 037–060, Quelle: www.jcsw.de
ELISABETH
HILDT
Autonomie.
Von den Implikationen eines politisch-moralischen
in Humangenetik und Neurowissenschaften
Ideals
Das Autonomiekonzept, mithilfe dessen die Bedeutung der individuellen Freiheit des Einzelnen sowohl für die persönliche Entwicklung als
auch für das politische Leben betont wird, ist tief in der liberalen westlichen Tradition verwurzelt. In westlichen demokratischen Industrienationen, die geprägt sind von einer zunehmenden Entwicklung unterschiedlicher Lebenseinstellungen und Werte innerhalb der Bevölkerung,
ist ein Rekurs auf Autonomie und auf das damit einhergehende Recht
auf Selbstbestimmung weit verbreitet. Stanley B enn beschreibt >Autonomie< denn auch als ein Ideal für gesellschaftlich unruhige Zeiten.!
Demzufolge entwickelt sich in einer sich schnell verändernden und rezeptiven Kultur, in der vielfältige Einflüsse von fremden Quellen einströmen, unter den Menschen in hohem Maße das Bedürfnis, selbst zu
ermitteln, was wirklich wichtig für sie ist.
Im folgenden Beitrag soll der Bedeutung des gesellschaftlichen Grundkonzepts der Autonomie für die Medizin und für aktuelle biomedizinische Entwicklungen nachgegangen werden. Hierzu wird zunächst in allgemeiner Weise auf die Bedeutung von Autonomie im medizinischen
Kontext, insbesondere innerhalb der Arzt-Patient-Beziehung, eingegangen. So stellt das Autonomiekonzept die zentrale Basis des so genannten
inform ed consent dar, im Rahmen dessen der Patient, nachdem er vollständig über die relevanten medizinischen Zusammenhänge informiert
wurde, in selbstbestimmter Weise über die ihn betreffende medizinische
Behandlung entscheidet. Hieran anschließend wird auf weitere Aspekte
des Autonomiekonzepts eingegangen, die zwar nicht direkt beim inform ed consent zum Tragen kommen, deren Bedeutung jedoch im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen im Bereich der Humangenetik
und im Bereich der Neurowissenschaften deutlich wird. Insbesondere
der Gesichtspunkt der selbstbestimmten Lebensgestaltung sowie der
Gesichtspunkt der Selbststeuerung stehen hierbei im Mittelpunkt der
Überlegungen. Die Bedeutung einer starken Betonung dieser Autonomieaspekte für aktuelle bzw. künftige Entwicklungen in diesen Berei1
Stanley I. B enn, A Theory of Freedom, Cambridge 1988.
37
�chen wird analysiert; ebenso werden mögliche Implikationen herausgearbeitet und diskutiert.
1. BEDEUTUNG
DES AUTONOMIEKONZEPTES
IM MEDIZINISCHEN KONTEXT
Das Wort >Autonomie<ist griechischen Ursprungs und bedeutet Selbstgesetzgebung, Selbstbestimmung. Etymologisch kann der Begriff >Autonomie< von autos = selbst und nom os = Regel oder Gesetz abgeleitet
werden. Der Begriff >Autonomie< wurde ursprünglich auf den griechischen Stadtstaat, der politische Selbstverwaltung besaß, angewandt. So
hatte eine Stadt autonom ia, wenn die Bürger ihre eigenen Gesetze verfassten und nicht unter der Herrschaft oder Kontrolle einer übergeordneten mächtigen Gewalt standen. Die Anwendung des Begriffs weitete
sich dann zunehmend auf Personen aus im Sinne von: Personen sind autonom, wenn ihre Entscheidungen und Handlungen ihre eigenen sind,
wenn sie sich selbst bestimmen. Die Wurzeln des so verwendeten Autonomiekonzeptes finden sich in der jüdisch-christlichen Tradition. Der
philosophische Autonomiebegriff, der die freie Selbstbestimmung des
Menschen als Vernunftwesen meint, geht auf Im m anuel K ant zurück.
Überlegungen zur Autonomie des Menschen sind generell eingebettet
in Theorien, welche menschliches Verhalten nicht als vollständig durch
Naturprozesse gesteuert sehen.2
Der Begriff >Autonomie<,der allgemein gesprochen die menschliche Fähigkeit zur Selbstbestimmung umschreibt, wird von verschiedenen Autoren mit teilweise recht unterschiedlichen inhaltlichen Bedeutungen
verknüpft. So wird mit >Autonomie< eine große Zahl unterschiedlicher
Aspekte assoziiert, wie Selbstverwirklichung, Freiwilligkeit, der Besitz
von Entscheidungs- und Wahlfreiheit, oder die Achtung des Privatlebens. Der Begriff der Autonomie wird manchmal als Äquivalent für
Freiheit benützt, manchmal als gleichbedeutend mit Souveränität,
Selbstgesetzgebung, oder Willensfreiheit. Er wird auch gleichgesetzt mit
Würde, Individualität, Unabhängigkeit, Integrität, Verantwortlichkeit
oder Selbst-Kenntnis. Autonomie wird in Beziehung gebracht mit kritischer Reflexion, mit der Freiheit von Verpflichtungen, mit der Abwesenheit externer Verursachung oder mit der Kenntnis der eigenen Inter2
G erald D w orkin, The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge 1988; B ruce M iller, Autonomy, in: W arren T . R eich (ed.), Encyclopedia
of Bioethics, New York 1995,
215-220; A nnem arie P ieper, Autonomie,
in: W ilhelm K orffiL utw in B ecklP aul M ikat
(H g.), Lexikon der Bioethik, Gütersloh
1998,289-293.
38
�essen. Den Verwendungen des Begriffs >Autonomie<ist gemeinsam, dass
es sich hierbei um ein zunächst als grundlegend positiv bewertetes Charakteristikum von Personen handelt.3
Im medizinischen Kontext wird erst seit kurzem die Autonomie und
das Selbstbestimmungsrecht des Patienten explizit diskutiert; eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Autonomiekonzept ist hier historisch gesehen relativ neu. Traditionell beschäftigte sich Medizinethik
mit der Förderung des Patientenwohls durch den Arzt, d. h. der Schwerpunkt lag auf der Fürsorge des Arztes für den Patienten. So lässt sich gemäß traditioneller, bis in die Mitte dieses Jahrhunderts vorherrschender
Sichtweise die Beziehung zwischen Arzt und Patient in hohem Maße als
von Asymmetrie geprägt charakterisieren: Der an einem körperlichen
Gebrechen, Unwohlsein, Schmerzen etc. leidende Patient wendet sich
hilfesuchend an einen Arzt, welcher Kraft seiner Autorität alle nötigen
Entscheidungen hinsichtlich des Verlaufs der medizinischen Behandlung zum Wohle des Patienten trifft. Ärztliche Anordnungen werden in
dieser, von paternalistischem Handeln geprägten Beziehung nicht in
Frage gestellt.
In westlichen Industrienationen ist in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich ein grundlegender Wandel festzustellen. So rückt innerhalb der
Arzt-Patient-Beziehung zunehmend der Aspekt der Selbstbestimmung
des Patienten ins Bewusstsein, welcher das Recht des Patienten impliziert, selbst über den Verlauf der ihn betreffenden medizinischen Maßnahmen zu entscheiden. Innerhalb des sich auf die individuelle Arzt-Patient- Beziehung beziehenden medizinischen Rahmens wird das Autonomiekonzept zumeist im Zusammenhang mit dem so genannten inform ed consent diskutiert. So ist es seit einiger Zeit als allgemein anerkannter Standard medizinischer Praxis anzusehen, vor dem Durchführen
einer medizinischen Maßnahme die freiwillige Zustimmung des Patienten bzw. Probanden einzuholen, nachdem er umfassend über den beabsichtigten Eingriff, seine Chancen und Risiken sowie alternative Behandlungsmöglichkeiten informiert wurde. Im englischen Sprachraum
wird diese Vorgehensweise unter dem Begriff des inform ed consent zusammengefasst; deutsche Umschreibungen für diesen Begriff wären
etwa >Einwilligung nach Aufklärung<, >freiwillige Zustimmung nach
vollständiger Aufklärung< oder >Informierte Einwilligung<. Während
der letzten Jahre erfolgten detaillierte Überlegungen über den Modus ei3
R uth R . F aden/T om L . B eaucham p, A History and Theory of Informed Consent, Oxford 1986; joseph R az, The Morality of Freedom, Oxford 1986; G erald D w orkin, The
Theory and Practice of Autonomy, Cambridge 1988.
39
�ner adäquaten Sicherung des inform ed consent bei der Durchführung
medizinisch-therapeutischer
Maßnahmen und im Vorfeld von Humanexperimenten und klinischen Studien. Im Mittelpunkt stehen hierbei geeignete Kriterien einer adäquaten Aufklärung und freiwilligen Zustimmung des Patienten bzw. Probanden, welche das Treffen selbstbestimmter, auf medizinische Behandlungsoptionen
bezogener Entscheidungen
gewährleisten.4
Parallel zu dieser zunehmenden Betonung der Bedeutung der Autonomie des Einzelnen innerhalb der individuellen Arzt-Patient-Beziehung
spielten Autonomie-bezogene
Überlegungen eine wichtige Rolle für das
Entstehen moderner Medizin- und Bioethik. Während Medizinethik bis in die 1960er Jahre hinein - hauptsächlich als aus der Arztperspektive entwickelte Fürsorgeethik
beschrieben werden kann, veränderte
sich in den USA Ende der 1960er bzw. Anfang der 1970er Jahre die
Sichtweise, indem die Rechte von Patienten gegenüber Ärzten, Pflegenden, Wissenschaftlern und Kostenträgern
in den Vordergrund rückten.
Mit ein Grund für diese Entwicklung war ein wachsendes Misstrauen
gegenüber Ärzten und Forschern, die nicht selten gegen die Interessen
der Patienten und Versuchspersonen
zu verstoßen schienen. Durch Veröffentlichungen über riskante oder unfreiwillig durchgeführte Humanexperimente wurde eine Woge von Entrüstung hervorgerufen in einer
Bevölkerung, die - im Umfeld der nach intellektueller und politischer
Emanzipation
strebenden
Bürgerrechtsbewegung
der späten 1960er
Jahre - bereits in hohem Maße für Bürgerrechtsfragen
und Probleme
der Diskriminierung
von Minderheiten sensibilisiert war. In der Folge
dieses von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung
geprägten Einsatzes für die Rechte von Patienten und Probanden setzte eine interdisziplinäre Debatte um ethische Fragen bei der Durchführung von Humanexperimenten ein. Von verschiedenen Organisationen
wurden Richtlinien zur Wahrung ethischer Standards erlassen, wobei insbesondere die
amerikanische N ational C om m ission for the P rotection of H um an Subjects in B iom edical and B ehavioral R esearch eingehende
Analysen
durchführte und detaillierte praktische Regelungsvorschläge
vorlegte.5
4
5
jay K atz, The Silent World of Doctor and Patient, New York 1984; F adenlB eaucham p,
A History (Anm. 3); H ans-P . W olff, Arzt und Patient, in: H ans-M artin Sass (H g.), Medizin und Ethik, Stuttgart 1986, 184-211; C laudia W iesem ann, Das Recht auf Selbstbestimmung und das Arzt- Patient-Verhältnis aus sozial geschichtlicher Perspektive, in: R ichard T oellnerlU rban W iesing (H g.), Geschichte und Ethik in der Medizin. Von den
Schwierigkeiten einer Kooperation, Stuttgart 1997,67-89.
N ational C om m ission for the P rotection of H um an Subjects of B iom edical and B ehavioural R esearch, The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research, Washington DC 1978.
40
�Im Mittelpunkt stand hierbei die Notwendigkeit, die Selbstbestimmung
des Probanden zu achten, und diese Selbstbestimmung jeglicher (potenzieller) Steigerung des Wohlergehens - seiner selbst oder anderer - vorzuordnen. Hierzu wurden Regeln und institutionelle Kontrollrnaßnahmen vorgeschlagen, die unter dem Leitbegriff des inform ed consent zusammengefasst werden können. Die Forderung nach Einholen des inform ed consent blieb nicht auf den experimentellen Kontext beschränkt,
sondern wurde auch auf die standardisierte medizinische Praxis übertragen.6 Der Beginn moderner Medizinethik kann demnach in den USA in
den späten 1960er Jahren gesehen werden. Charakteristisch für diese
Anfangsphase war, dass sie sich - im Gegensatz zu früherer ethischer
Reflexion, die primär Gesichtspunkte wie Fürsorge und Schadensvermeidung thematisierte - mit Fragen der Selbstbestimmung des Patienten
beschäftigte und hiermit das Autonomieprinzip verstärkt in die Diskussion einbrachte. So geht die Forderung, Patienten und Versuchspersonen selbst über die Durchführung diagnostischer, therapeutischer oder
experimenteller Maßnahmen durch Zustimmung oder Ablehnung entscheiden zu lassen, auf die Achtung der Autonomie der betreffenden
Personen zurück. Insgesamt gewann die Patientenperspektive an Bedeutung, und mit ihr Fragen, die sich mit den modernen Bedürfnissen von
Patienten beschäftigen. Hierzu gehören neben der Entscheidungsautorität hinsichtlich der durchzuführenden medizinischen Behandlung auch
generell Fragen des adäquaten Umgangs mit Patienten oder Fragen der
Verteilungsgerechtigkeit.
In der Folge dieser Entwicklung wurde angestrebt, die sich auf die hippokratische Tradition beziehende Medizinethik zu ersetzen durch eine
Vorgehensweise, bei der nicht mehr in erster Linie die Arztperspektive
berücksichtigt wird, sondern bei der verschiedenartige Standpunkte in
transparenter Weise in die Urteilsbildung einfließen: Hierzu gehört, bei
schwierigen Entscheidungen die Option einer Ethikkommission bereitzustellen, sowie geplante Humanexperimente und klinische Studien vor
der Durchführung von einem multidisziplinären Gremium prüfen zu
lassen. Eine solche Vorgehensweise impliziert jedoch, Medizinethik
nicht mehr lediglich im Kontext der individuellen Arzt-Patient-Beziehung anzusiedeln und damit als Bestandteil des ärztlichen Berufsethos
zu betrachten, sondern als in interdisziplinärer Weise betriebenen Arbeits- und Forschungsbereich. Als Leitbegriff für diese neue Richtung
6
F aden/B eaucham p, A History (Anm. 3); B ettina Schöne-Seifert, Medizinethik, in: ]ulian N ida-R üm elin (H g.), Angewandte Ethik - die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundierung, Stuttgart 1996, 553-648.
41
�fungierte der Begriff bioethics, aber auch biom edical ethics, deutsch als
Bioethik bzw. Biomedizinische Ethik bezeichnet. Diese neue Entwicklung ist darauf ausgerichtet, im interdisziplinären Gespräch zwischen
Vertretern aus Medizin, Biowissenschaften, Rechtswissenschaften, Philosophie und Theologie zur ethischen Urteilsbildung beizutragen und
gemeinsam Kriterien richtigen Handelns im Bereich der Medizin und
der biomedizinischen Forschung zu entwickeln.
Insgesamt gesehen lassen sich drei E ntw icklungen als wesentliche Voraussetzung für die zeitgenössische >westliche<Medizinethik bzw. Biomedizinische Ethik nennen:8
a) Das Vorhandensein einer steigenden Zahl neuer medizinischer
Eingriffsmöglichkeiten, wie z. B. künstliche Beatmungstechniken,
Organtransplantationen oder In-vitro- Fertilisations- Verfahren. All
diese Entwicklungen werfen neuartige Entscheidungsprobleme auf.
b) Eine zunehmende Vielfalt der Lebensstile und Moralauffassungen.
Dieser Pluralismus bildet die Voraussetzung für Diskussionen um
Rechte der Patienten auf Information und Selbstbestimmung. So gehen Diskussionen um die Zulässigkeit bestimmter Handlungen im
medizinischen Kontext, wie z. B. Schwangerschaftsabbrüche oder
Maßnahmen der Sterbehilfe, auf unterschiedliche Moralauffassungen
zurück.
c) Der Verlust moralischer Autorität und Unanfechtbarkeit von Ärzten
und Forschern. Einer der Gründe dieser Entwicklung ist sicher in
der zunehmenden Pluralisierung der Lebensstile und Moralauffassungen zu sehen.
Diese Veränderungen haben dazu geführt, ethische Fragen im medizinischen Kontext nicht mehr, wie in der hippokratischen Tradition, ausschließlich von Ärzten regeln zu lassen - wodurch der Weg freigegeben
wurde für die Umwandlung der modernen Medizin- und Bioethik in
ein interdisziplinäres Gebiet. So wird im modernen Gesundheitssystem
Verantwortung nicht mehr nur vom einzelnen Arzt bzw. vom betreuenden Ärzteteam und vom jeweiligen Patienten übernommen; auch Mitglieder anderer Berufsgruppen sind beteiligt, wie Angehörige der Pflegeberufe, im medizinisch-technischen Bereich tätige Personen, Apotheker und Verwaltungsangestellte. Darüber hinaus spielen der Einfluss der
7
7
8
W arren R eich, The Word »Bioethics«: Its Birth and the Legacies of Those Who Shaped
It, in: Kennedy Institute of Ethics Journal Vol. 4, No. 4 (1994), 319-335; E ve-M arie E ngels, Natur- und Menschenbilder in der Bioethik des 20. Jahrhunderts. Zur Einführung,
in: D ies (H g.), Biologie und Ethik, Stuttgart 1999, 7-42.
F aden/B eaucham p, A History (Anm. 3); W olff, Arzt und Patient (Anm. 4); Schöne-Seifert, Medizinethik (Anm. 6).
42
�Kostenträger des Gesundheitswesens und die von staatlichen Organen
und Behörden bereitgestellten Rahmenbedingungen eine große Rolle.
In Westeuropa verlief eine entsprechende Entwicklung wesentlich langsamer und mit anderer Ausrichtung als in den USA. Als Gründe für die
ca. 20jährige Verzögerung der Entwicklung in Deutschland im Vergleich
zu den USA lässt sich zunächst einmal das Fehlen einer einflussreichen
Bürgerrechtsbewegung nennen, die sich um die Rechte von Patienten
und Probanden gekümmert hätte. Zum anderen spielt hier auch die Tradition der hauptsächlich an theoretischen Fragestellungen ausgerichteten deutschen Philosophie eine Rolle. Nicht zuletzt haben die Implikationen des Nationalsozialismus im medizinischen Kontext in der Zeit
von 1933-1945 (Eugenik, Euthanasie, Menschenversuche) dazu geführt,
weite Bereiche zu tabuisieren, welche genuin medizin- und bioethische
Fragestellungen betreffen. Hierzu gehören Themen wie die Auswirkungen genetischer Diagnostik oder Fragen des Behandlungsabbruchs bei
Schwerstkranken.
2.
DAS AUTONOMIE-KoNZEPT
UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
DER BIOMEDIZIN
Im Umfeld des inform ed consent, d.h. bezogen auf die für das Treffen
selbstbestimmter Entscheidungen relevanten Voraussetzungen innerhalb
einer konkreten Entscheidungssituation, kommt der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Autonomiekonzept in der Medizin seit einiger
Zeit zentrale Bedeutung zu. Autonomie ist jedoch auch in anderen medizinischen Zusammenhängen von Relevanz: zum einen, wenn es um
Fragen der langfristigen Lebensplanung und Lebensgestaltung geht,
zum anderen im Zusammenhang mit dem Bestreben, sich selbst in wirksamer Weise zu steuern, d.h. möglichst umfassend >Herr<über das eigene Handeln und Verhalten, wenn nicht gar in der Lage zu sein, einige
diesbezüglich bestehende >Schwachstellen<auszubügeln oder zu verbessern. Auf diese beiden Aspekte des Autonomiekonzepts, die über die
herkömmlichen, im medizinisch-therapeutischen Bereich im Kontext
des inform ed consent diskutierten Autonomie-bezogenen Überlegungen
hinausgehen, soll nun näher eingegangen werden. Dazu werden im Folgenden zwei verschiedene medizinische Bereiche, in denen jeweils einer
dieser Aspekte des Autonomiekonzepts von besonderer Bedeutung ist,
näher beschrieben und diskutiert. Zunächst soll auf die im Bereich prädiktiver genetischer Diagnostik im Mittelpunkt stehenden Fragen
43
�selbstbestimmter Lebensplanung und Lebensgestaltung eingegangen
werden (2.1). Im Anschluss daran wird anhand von medizinischen Einsatzmöglichkeiten der Neurowissenschaften, insbesondere der Neurotechnologie, den Möglichkeiten wirksamer >Selbststeuerung< nachgegangen (2.2).
2.1. P rädiktive
genetische
D iagnostik
Durch große Fortschritte der molekulargenetischen Forschung rückte
in den letzten Jahren verstärkt die Bedeutung genetischer Faktoren beim
Entstehen von Krankheiten ins Bewusstsein. So konnte - beschleunigt
durch das Humangenomprojekt und die Entschlüsselung des menschlichen Genoms - im letzten Jahrzehnt eine große Zahl Krankheits-assoziierter Gene identifiziert werden. Allein ca. 8000 verschiedene, zum Teil
sehr seltene monogenetisch bedingte Erkrankungen sind derzeit bekannt. Des Weiteren wurden genetische Komponenten festgestellt oder
vorgeschlagen für so unterschiedliche Erkrankungen wie bspw. Osteoporose, Morbus Alzheimer, Fettleibigkeit, Herzkreislauf-Erkrankungen, verschiedene Krebserkrankungen, Asthma, Diabetes, Allergien und
diverse mentale Erkrankungen. Derzeit sind Diagnoseverfahren auf
über 900 genetisch bedingte oder mitbedingte Krankheiten und Behinderungen verfügbar.9 Durch DNA-Analysen ist es in zunehmendem
Maße möglich zu ermitteln, ob eine Person genetische Varianten trägt,
die als für das Auftreten bestimmter Erkrankungen verantwortlich bzw.
mitverantwortlich betrachtet werden können. Genetische Diagnoseverfahren werden mit zwei verschiedenen Zielsetzungen eingesetzt: einerseits um bei von Krankheitssymptomen betroffenen Patienten die Diagnose zu bestätigen und ggf. die Therapie am Testergebnis auszurichten,
sowie andererseits um zu ermitteln, ob eine Person bestimmte DNAVeränderungen trägt, welche prädiktiv für das Auftreten eines klinischen Phänotyps sind. Auf diesem letztgenannten Weg der prädiktiven
genetischen Diagnostik können aufgrund der genetischen Analyse
Krankheitsrisiken vorhergesagt werden.
Vor diesem Hintergrund ist das sich rasch entwickelnde Gebiet der prädiktiven genetischen Medizin zu sehen, im Rahmen dessen aus der gene9
H ennenlT hom as P eterm annlA rnold Sauter, Das genetische Orakel. Prognosen und Diagnosen durch Gentests - eine aktuelle Bilanz (Studien des Büros für
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, 10), Berlin 2001; OMIM:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim bzw. V ictor A . M cK usick 1998
(http://www.genetests.org).
L eonhard
44
�tischen Konstitution einer Person Wahrscheinlichkeitsaussagen über das
künftige Auftreten bestimmter Erkrankungen getroffen werden können.
Prädiktive Medizin beschäftigt sich - anders als die klassische klinische
Medizin - nicht mit bereits erkrankten Patienten, sondern ermöglicht
es, Individuen mit Risiko unter gesunden Individuen zu ermitteln. Zunächst können generell verschiedene Typen prädiktiver genetischer Diagnoseverfahren unterschieden werden:10
a) Präsymptomatische Gentests auf autosomal dominante oder X-chromosomale Erkrankungen (z. B. Chorea Huntington). Hierbei handelt
es sich um Erkrankungen, die (annähernd) unvermeidbar auftreten,
wenn eine entsprechende Mutation vorhanden ist.
b) Suszeptibilitätstests auf polygen oder multifaktoriell bedingte Erkrankungen (z. B. Cardiovaskuläre Erkrankungen, verschiedene
Krebsformen), bei deren Auftreten mehrere Gene bzw. vielfältige
Wechselwirkungen mit Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Hierbei
wird genetische Information ermittelt, welche ein erhöhtes Risiko
für einen möglichen Krankheitsausbruch angibt (Prädisposition).
c) C arrier-T ests auf autosomal rezessive Erkrankungen (z. B. Mukoviszidose). Mithilfe dieser Diagnoseverfahren können heterozygote
C arrier ermittelt werden, bei denen die Erkrankung zwar nicht im
eigenen Phänotyp manifest werden wird, entsprechende genetische
Informationen jedoch u. U. große Bedeutung im Zusammenhang mit
Fragen der Familienplanung besitzen.
Des Weiteren lässt sich eine Unterscheidung nach dem Testzeitpunkt im
Lebensverlauf sowie nach der zu testenden Zielgruppe vornehmen, d. h.
in Abhängigkeit davon, ob das genetische Diagnoseverfahren bei erwachsenen Einzelpersonen, bei Paaren mit Kinderwunsch, bei Kindern,
oder aber pränatal durchgeführt wird. Darüber hinaus kann nach der
für genetische Diagnostik in Frage kommenden Risikogruppe unterschieden werden, d. h. gezielte Diagnosen bei Mitgliedern von Hochrisikofamilien können allgemeinen, bei weiten Teilen der Bevölkerung eingesetzten screening-V erfahren
gegenübergestellt werden. Durch nichtdirektive genetische Beratung wird die selbstbestimmte Entscheidungsfindung der Ratsuchenden hinsichtlich der Inanspruchnahme genetischer Diagnoseverfahren und der sich aus dem Testergebnis ergebenden
10
]ean Dausset, Predictive medicine, in: European Journal of Obstetrics & Gynecology
and Reproductive Biology 65 (1996), 29-32; R obert W achbroit, The Question Not
Asked: The Challenge of Pleiotropic Genetic Tests, in: Kennedy Institute of Ethics
Journal 8 (1998),131-144; F rancis S. C ollins/A lan E. Guttmacher, Genetics moves into
the medical mainstream, in: Journal of the American Medical Association Val. 286,
No. 18 (2001); Editorial.
45
�Konsequenzen unterstützt,
Entscheidung auszuüben.!!
jedoch ohne Einfluss auf die eigentliche
Viele Autoren rechnen für die Zukunft mit einer starken Zunahme der
Bedeutung prädiktiver genetischer Diagnostik.!2 So erwarten z. B. F rancis S. C ollins und V ictor A . M cK usick, dass bereits im Jahr 2010 prädiktive Gentests für ca. ein Dutzend weitverbreitete Erkrankungen zur
Verfügung stehen werden, welche Individuen erlauben werden, ihre jeweiligen Suszeptibilitäten zu erfahren, um so durch Lebensstilveränderungen, Diät, pharmakologische Behandlung oder medizinische Überwachung ihre Erkrankungsrisiken zu verringern.13 Auch ist zunehmend
von einer breiteren Verfügbarkeit prädiktiver Gentests auszugehen, so
dass deren Einsatz voraussichtlich nicht mehr in erster Linie auf Personen mit entsprechender Familiengeschichte beschränkt bleiben wird,
sondern die Testverfahren künftig auch in steigendem Maße für die allgemeine Bevölkerung verfügbar sein werden. Vor diesem Hintergrund
einer sich abzeichnenden Ausweitung des Einsatzes prädiktiver genetischer Diagnostik sieht etwa H ans-M artin Sass durch die auf diesem
Wege erhaltene molekulargenetische Information und die hierdurch ermöglichte Nennung von Erkrankungsrisiken das Eintreten einer Revolution von Kopernikanischen Dimensionen in der Medizin gegeben.!4
Angesichts der Möglichkeiten der prädiktiven Medizin, Krankheiten
Jahre oder Jahrzehnte vor ihrem Ausbruch vorhersagen zu können und
Krankheitsrisiken sowie Risikofaktoren zu benennen, ist eine Verschiebung des Schwerpunkts der Medizin von der akuten Versorgung erkrankter Personen im Krisenfall zu nicht-akuten, langfristigen Formen
der Gesundheitsversorgung zu erwarten, bei der angemessenes Verhalten im Umgang mit Risiken eine zentrale Rolle spielt. Hierbei stehen
häufig Fragen der allgemeinen Lebensgestaltung im Mittelpunkt, die
11
12
13
14
46
Seym our K essler (H g.), Psychologische
Aspekte der genetischen Beratung, Stuttgart
1984; B arbara B ow les B iesecker, Future Directions in Genetic Counseling: Practical
and Ethical Considerations,
in: Kennedy Institute of Ethics Journal 8 (1998), 145-160.
R uth H ubbard, Transparent Women, Visible Genes, and New Conceptions of Disease,
in: Cambridge Quarterly
of Healthcare Ethics 4 (1995), 291-295; H ans-M artin Sass,
Copernican
Challenge of Genetic Prediction in Human Medicine, in: Jahrbuch für
Recht und Ethik 4 (1996), 67-79; H enk A .M .]. ten H ave, Genetic Information and Human Existence, in: R uth C hadw icklM airi L evittlD arren Shickle (eds), The Right to
Know and the Right Not to Know, Aldershot 1997, 87-95; C ollinslG uttm acher, Genetics moves (Anm. 10); H ennenlP eterm annl Sauter, Das genetische Orakel (Anm. 9);
M uln]. K hourylL inda L . M cC abelE dw ard R . B . M cC abe, Population Screening in the
Age of Genomic Medicine, in: New Englandjournal
of Medicine 348 (2003), 50-58.
F rancis S. C ollins IV ictor A . M cK usick, Implications of the Human Genome Project for
Medical Science, in: Journal of the American Medical Association 285 (2001), 540-544.
Vgl. H ans-M artin Sass, Copernican Challenge (Anm. 12).
�nicht nur im medizinischen Bereich von Bedeutung sind, sondern auch
vielfältige Auswirkungen auf das Selbstverständnis der jeweiligen Personen und ihrer Familien besitzen. Diese im Umfeld der prädiktiven genetischen Diagnostik zunehmende Bedeutung der langfristigen, an Erkrankungsrisiken ausgerichteten selbstbestimmten Lebensgestaltung des
Einzelnen deutet auf eine stärkere Rolle des Patienten im Rahmen der
Arzt-Patient-Beziehung hin. In diesem Zusammenhang mag man die
Rolle des Mediziners im 21. Jahrhundert zunehmend als diejenige eines
Beraters sehen, der seinen gesunden ,Patienten< genetische Informationen übermittelt und ihnen hilft, hiervon ausgehend in Eigenverantwortung präventive Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, um langfristig gesund zu bleiben (attentive surveillance ).15
Allerdings variiert der Nutzen prädiktiver genetischer Diagnostik stark
in Abhängigkeit von der jeweiligen konkreten Situation, d. h. der Höhe
des Erkrankungsrisikos, der Genauigkeit der Risiko-Vorhersage, den
verfügbaren Optionen zur Risikoverringerung, den vorausgegangenen
Erfahrungen der jeweiligen Person sowie der zugehörigen Familienkonstellation. Da prädiktive genetische Medizin auf häufig nur äußerst
schwierig zu quantifizierenden Wahrscheinlichkeits aussagen basiert, lassen sich konkrete Vorhersagen darüber, wie stark ein bestimmtes Individuum betroffen sein wird, zumeist nicht treffen.16 Denn nur wenige genetische Vorhersagen sind absolut, da sich die Beziehungen zwischen
DNA-Mutation und klinischer Manifestation zumeist äußerst komplex
gestalten. Bei Vorliegen einer bestimmten genetischen Variante muss in
vielen Fällen aufgrund verminderter Penetranz und/oder variabler Expressivität mit individuellen Unterschieden im Auftreten und im Charakter der Krankheitssymptome gerechnet werden. Das Vorhandensein
einer bestimmten genetischen Variante kann daher nicht mit dem Vorhandensein einer bestimmten Erkrankung oder einer bestimmten Form
der Krankheitsausprägung gleichgesetzt werden.
Insgesamt kommt der Autonomie der betreffenden Personen im Umgang mit prädiktiver genetischer Information sehr starke Bedeutung zu.
So steht die Kenntnis genetischer Information häufig in einem besonders komplexen lebensweltlichen Kontext, in dem langfristige Ausrich15
Predictive medicine (Anm. 10); Sass, Copernican Challenge (Anm. 12); D irk
K ochlP ascale B ourret, DNA Diagnosis and the Emergence of Cancer
Genetic Services in European Health Care, in: European Journal of Human Genetics 5
(suppI2) (1997),25-30.
H ubbard, Transparent Warnen (Anm. 12); D ies.lR ichard
C. Lewontin, Pitfalls in Genetic Testing, in: New England Journal of Medicine 334 (1996), 1192-1194; D ausset, Predictive medicine (Anm. 10).
D ausset,
Stem erdinglL ene
16
47
�tun gen der Lebens- und Familienplanung
eine stärkere Rolle spielen als
in anderen medizinischen Gebieten. Zumeist müssen völlig asymptomatische Personen mit Informationen
zurechtkommen,
denen zufolge sie
mit gewisser Wahrscheinlichkeit
früher oder später eine bestimmte Erkrankung entwickeln werden. Im Gegensatz hierzu sind in anderen medizinischen Kontexten prädiktive Informationen
wesentlich enger an
vorhandene Symptome geknüpft; dort werden in den meisten Fällen
Personen, die bereits von Krankheitsanzeichen
betroffen sind, mit einer
Prognose konfrontiert.
Darüber hinaus eilt die prädiktive genetische
Diagnostik häufig jeglicher Form von Behandlungsmöglichkeit
voraus,
so dass - abgesehen von Wahrscheinlichkeitsaussagen
hinsichtlich des
künftigen Auftretens der Erkrankung - derzeit oft weder präventive
noch kurative Behandlung angeboten werden kann. Zudem besitzt die
Kenntnis genetischer Daten große Bedeutung im Kontext der Familienplanung.
Die Besonderheit prädiktiver genetischer Information wird auch deutlich, wenn man den Zusammenhang bedenkt, in dem prädiktive genetische Diagnostik steht. Zumeist wird das Durchführen
eines Gentests
aus einem der folgenden
Gründe in Erwägung
gezogen: Jemand
wünscht eine prädiktive genetische Analyse, um in der Lage zu sein, im
Falle eines positiven Testergebnisses geeignete Präventions- oder Therapiemaßnahmen
ergreifen zu können; eine Person möchte Details über
ihren genetischen Status erfahren, um ihre Lebensplanung
an diesem
Wissen ausrichten zu können, auch wenn keine adäquaten Präventionsoder Therapiemöglichkeiten
zur Verfügung stehen; Dritte besitzen ein
Interesse daran, etwas über den genetischen Status einer Person zu ermitteln, so z. B. Angehörige, aber u. U. auch Arbeitgeber oder Versicherungsgesellschaften;
ein Paar mit Kinderwunsch
möchte in Erfahrung
bringen, mit welcher Wahrscheinlichkeit
künftige Kinder von einer bestimmten genetischen Erkrankung
betroffen sein werden; eine Frau
bzw. ein Paar mit bereits bestehender Schwangerschaft möchte wissen,
ob ihr Fötus eine bestimmte genetische Auffälligkeit trägt, die voraussichtlich zu einer solcherart schweren Erkrankung führen wird, dass
dies für die Frau bzw. das Paar das Durchführen
eines Schwangerschaftsabbruchs
rechtfertigen würde; an durch in-vitro-F ertilisation erzeugten Embryonen
soll vor der Implantation
in den Uterus mittels
Präimplantationsdiagnostik
der genetische Status ermittelt werden, um
das Auftreten bestimmter Erkrankungen auszuschließen.
Wie aus dieser Auflistung deutlich wird, steht nur im zuerst genannten
Fall die Sorge um die Gesundheit des Betreffenden und um deren Er48
�halt, d. h. das klassische, am gesundheitlichen Wohl des Patienten ausgerichtete Fürsorgeprinzip
im Vordergrund.
Zumeist bilden vielmehr
Aspekte der eigenen Lebensgestaltung
und der Familienplanung
die
Hauptmotivation
für die Inanspruchnahme
eines Gentests. Ein Hauptgrund hierfür - und zugleich eines der im Zusammenhang mit prädiktiver genetischer Diagnostik bestehenden Hauptprobleme
- liegt darin,
dass derzeit in den meisten Fällen im Anschluss an das Testverfahren
kein geeignetes präventives oder therapeutisches Eingreifen möglich ist.
Je weniger Präventionsoder Therapiemöglichkeiten
im Umfeld der
prädiktiven genetischen Diagnostik zur Verfügung stehen, desto stärker
rücken am medizinischen Wohlbefinden des Betreffenden ausgerichtete
Fürsorgeaspekte in den Hintergrund und desto stärker gelangt der Autonomiegesichtspunkt
in den Mittelpunkt.
Denn solange keine (oder
nur eine sehr begrenzte) Möglichkeit besteht, die vorhergesagte Krankheit wirklich zu vermeiden oder frühzeitig zu therapieren, liegt der
Nachfrage nach prädiktiver genetischer Diagnostik in erster Linie die
Erwartung zugrunde, durch die auf diese Weise erhaltene Information
werde der Entscheidungsund Handlungsspielraum
der Betreffenden
erweitert und somit eine umfassendere und angemessenere Lebens- und
Familienplanung ermöglicht. Im Hintergrund steht hierbei das Ideal der
individuellen Autonomie,
demzufolge Personen - soweit möglich über den Lebensverlauf hinweg durch das Treffen eigener Entscheidungen ihr Schicksal bestimmen und gestalterisch in ihr eigenes Leben eingreifen.
Anders als im Kontext des inform ed consent - bei dem sich Autonomieüberlegungen auf die konkrete medizinische Entscheidungssituation
beschränken, in der zwischen verschiedenen Behandlungsoptionen
ausgewählt werden kann - bezieht sich >Autonomie< hier auf den gesamten
weiteren Lebensverlauf und die langfristig angelegte Lebensgestaltung
und Familienplanung
und besitzt somit Bedeutung jenseits medizinischer Zusammenhänge.
Allerdings sind auch hier Fürsorgegesichtspunkte relevant im Sinne von: den Betreffenden darf durch die genetische Analyse und den damit verbundenen Implikationen
nicht geschadet werden. Nicht zuletzt können durch die genetische Information
vielfältige psychische Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste etc. ausgelöst sowie aus dem Wissen um genetische Zusammenhänge
u. U. übereilte,
letztlich inadäquate Maßnahmen ergriffen werden. Insbesondere können für die betreffenden Personen Schwierigkeiten auftreten, angesichts
der erhaltenen genetischen Information in adäquater Weise ihr Leben zu
gestalten. So mag man zweifeln, ob eine Person in der Lage ist, ihr Le-
49
�ben frei und ungezwungen zu planen, wenn sie beständig das Schreckgespenst einer künftigen Erkrankung vor sich hat. Denn mit dem Wissen um eine Anlageträgerschaft ist, gerade wenn keinerlei wirksame präventive oder therapeutische Möglichkeit zur Verfügung steht und die
Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft ausbrechen
wird, immer auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins
verbunden. Zwar schränkt ganz allgemein jegliche Form von Krankheit
die Gestaltungsmöglichkeiten einer Person ein. Gerade im Umfeld prädiktiver genetischer Analysen und genetisch bedingter Erkrankungen
mag jedoch in besonderem Maße der Eindruck entstehen, von den eigenen Genen gesteuert zu werden. Hierfür spielen nicht zuletzt auf den
Gesichtspunkt der genetischen Determination rekurrierende Intuitionen
und Positionen eine Rolle. Auch der Möglichkeit prädiktiver genetischer Diagnostik, Aussagen über zeitlich u. U. weit entfernt liegende Erkrankungen zu treffen, kommt hierbei Bedeutung zu. So scheint es nicht
das eigene, bewusst planende >Ich<zu sein, das wichtige Eckdaten des
Lebensverlaufs kontrolliert, sondern die eigenen Gene.
Wenn man Autonomie als die Fähigkeit von Personen beschreibt, sich
selbst zu entwerfen, kann man fragen: ist dieses Sich-selbst-Entwerfen
nicht besser unabhängig von genetischen Vorgaben möglich? Denn aufgrund der genetischen Information mag es für die betreffende Person
naheliegend sein, ihre Zukunftspläne etc. der erhaltenen genetischen Information anzupassen. Zwar lässt sich genau dieses Anpassen der Lebensplanung als selbstbestimmte Lebensgestaltung angesichts genetischer Information beschreiben; allerdings ist in Bezug auf Autonomie
die resultierende Situation keineswegs eindeutig: Denn angesichts der
vielfältigen mit prädiktiver genetischer Information verbundenen Unsicherheiten besteht eine beträchtliche Gefahr großer, selbst auferlegter
Beschränkungen aufgrund des Testergebnisses. Insbesondere in den Fällen, in denen der Verlauf der Erkrankung stark vom erwarteten Verlauf
abweicht, mag es sich nachträglich erweisen, dass der Handlungsspielraum ohne wirklichen Grund eingeschränkt wurde. Dies ist vor allem
dann der Fall, wenn die Krankheits-Symptome gar nicht oder sehr viel
später auftreten als erwartet, wenn sie weniger gravierend sind, oder
wenn der Verlauf der Erkrankung stark vom erwarteten Verlauf abweicht.
2.2. A ktuelle E ntw icklungen der N eurow issenschaften
Der zweite Zusammenhang, in dem Autonomie-bezogene Überlegungen jenseits des auf den inform ed consent bezogenen Rahmens diskutiert
50
�werden sollten, betrifft die einem Menschen zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten zur Selbstkontrolle und zur Selbststeuerung. Eine entsprechende Einflussnahme auf die Fähigkeiten eines Menschen zu
selbstbestimmter Lebensgestaltung erscheint am ehesten möglich im
Umfeld von Verfahren, deren Wirkung in direkter oder indirekter Weise
am Gehirn ansetzt. Denn das Gehirn stellt das für Personsein, Personalität und Identität eines Menschen entscheidende Organ dar. Die zentrale Bedeutung und die Fragilität dieses hochkomplexen Organs zeigen
sich deutlich bei Gehirnverletzungen, Funktionsausfällen, angeborenen
Stoffwechseldefekten wie Phenylketonurie oder Galactosämie oder aber
bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Alzheimer oder
Morbus Huntington. Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Verständnisses der komplexen Funktionszusammenhänge des Gehirns wird
in steigendem Maße ein therapeutischer Einsatz der verschiedensten
Medikamente und Verfahren ermöglicht. So wird für therapeutische
Zwecke auf vielfältige Weise sowohl mit Hilfe von Psychopharmaka als
auch durch invasive Techniken, wie beispielsweise durch Hirngewebetransplantationen, in den Funktionszusammenhang des Gehirns eingegriffen und somit die Korrelation zwischen Gehirn und Personalität eines Menschen ausgenützt. Darüber hinaus eröffnen diese verschiedenen
Ansätze jedoch auch die grundsätzliche Möglichkeit, unabhängig von
therapeutischen Zielen in das als zentrale Steuereinheit des Menschen
geltende Gehirn einzugreifen, um so durch Veränderung der Persönlichkeit, Steigerung der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses oder Ähnlichem entsprechend gewünschte Wirkungen zu erzielen.
Im Rahmen dieses Aufsatzes soll mit dem Gebiet der Neurotechnologie
ein in mancher Hinsicht futuristisch anmutender Bereich der Neurowissenschaften näher betrachtet werden, in dessen Zentrum verschiedene
Formen der direkten Gehirn-Computer-Interaktion
stehen. Denn in
den letzten Jahren zeichnen sich im Bereich der Neurotechnologie eine
Reihe neuartiger Entwicklungen ab, die vielversprechende therapeutische Möglichkeiten eröffnen. Neben Cochlea- und Retina-Implantaten
sind hier ins Gehirn implantierte Elektrodenanordnungen, aber auch
nicht-invasive Gehirn-Computer-Schnittstellen zu nennen.17 Diese neurotechnologischen Ansätze werden häufig in den Zusammenhang einer
Entwicklung gestellt, innerhalb derer der Mensch dabei ist, Teil seiner
eigenen Technologie zu werden, um ein Wiederherstellen verlorener
17
Vgl. E lisabeth H ildt, Computer, Körper und Gehirn. Ethische Aspekte eines Wechselspiels, in: D ies.lE ve-M arie E ngels (H g.), Neurowissenschaften und Menschenbild Wissenschaftstheoretische und ethische Aspekte, Paderborn 2004 (i.E.)
51
�Körperfunktionen oder eine Erleichterung des Lebens zu erreichen.
Von sich zu C yborgs (~ernetic
Q Iganism s) entwickelnden Menschen
ist hierbei die Rede, von Carbon-Silicon- Konvergenz und künftiger
Symbiose zwischen Menschen und Maschinen. So sind in der Literatur
auffallend häufig diesbezügliche Visionen, Spekulationen und Sciencefiction-Überlegungen anzutreffen, was nicht zuletzt auf die große technische Faszination hinweist, die von den bereits jetzt bestehenden Verfahren der Mensch- Maschine- Interaktion ausgeht.1B
Bereits seit den frühen 1980er Jahren bestehen umfangreiche Erfahrungen mit elektronischen Hörhilfen, mit denen bei gehörlosen Personen
mit intaktem Hörnerv die Hörfähigkeit wiedererlangt werden kann.
Durch ein Cochlea-Implantat werden Schallwellen aufgenommen, umgewandelt und in modifizierter Form mittels Elektroden an den Hörnerv weitergeleitet. Entsprechende Implantate sind weltweit bereits bei
über 40.000 Personen erfolgreich im Einsatz. Derzeit befindet sich darüber hinaus ein - auch bei Personen mit nicht funktionsfähigem Hörnerv einsetzbares - Verfahren in der Entwicklung, bei dem eine Mikroelektroden-Anordnung direkt in den auditorischen Hirnstamm implantiert werden sol1.19 Demgegenüber befinden sich die so genannten Retina-Implantate, mit deren Hilfe angestrebt wird, bei Personen mit
Funktionsschäden der Retina - v.a. bei Retinitis pigmentosa, aber auch
bei Macula-Degenerationen - die Sehfähigkeit wiederzuerlangen, derzeit im experimentellen Stadium.20 Angestrebt wird, eine flexible Folie
mit eingebetteten Mikrokontakten ins Auge zu implantieren, welche in
Verbindung mit einer Spezialbrille bei Blinden und Erblindenden die
Arbeit zerstörter Netzhaut übernehmen soll. Einen stärker invasiven
Ansatz mit ähnlichem Eingriffsziel, der jedoch bei fast jeder Form von
Blindheit einsetzbar ist, bildet das so genannte >Dobelle Eye<. Hierbei
wird Information von einer auf eine Spezialbrille montierten Minicamera und einem Ultraschall-Entfernungs-Sensor aufgenommen, über
Computer verarbeitet, und an eine Elektrodenanordnung weitergeleitet,
18
19
20
P eter C ochrane, Carbon-Silicon
Convergence,
in: Forbes Magazine (August 1999);
D ers., Cows Horns To Implants, in: One in Seven Magazine, Royal National Institute
for the Deaf 15 (2000), 14-15; R odney B rooks, Menschmaschinen
- Wie uns die Zukunftstechnologien
neu erschaffen, Frankfurt/M.
2002.
J. P . R auscheckeriR . V. Shannon, Sending Sound to the Brain, in: Science 295 (2002),
1055-1029.
R alf E ckm iller, Das Retina-Implantat
für die Wiedergewinnung
des Sehens, in: E . P äppelle. M aar, Die Technik auf dem Weg zur Seele, Reinbek 1996, 295-308; E berhart
Z renner, »Retina-Implantate«Ersatz von Retinafunktionen
durch technische Implantate: Ein gangbarer Weg zur Wiederherstellung
des Sehens?, in: Der Ophthalmologe
98
(2001),353-356.
52
�die an der Oberfläche des visuellen Cortex implantiert ist. Die am besten mit der Apparatur zurecht kommende Person ist in der Lage, mithilfe des Geräts U-Bahn zu fahren, sowie aus einiger Entfernung Buchstaben zu lesen. Trotz generell bestehenden Infektionsrisikos befinden
sich die Elektroden teilweise seit über 20 Jahren im Gehirn der Versuchspersonen, ohne zu stärkeren Beeinträchtigungen, Infektionen, epileptischen Symptomen oder anderen systemischen Problemen zu führen.21
Als eine weitere Gruppe von Verfahren können direkte Gehirn-Computer-Schnittstellen (brain com puter interfaces) genannt werden. Hierbei
handelt es sich um Kommunikationssysteme, bei denen Botschaften
oder Befehle, welche ein Individuum an die externe Welt sendet, nicht
über die normalerweise benutzten Ausgänge des Gehirns über periphere
Nerven und Muskeln verlaufen, sondern direkt vom Gehirn abgeleitet
werden.22 Ein derartiger, erfolgreich eingesetzter Ansatz beruht z. B. auf
der direkten, auf Elektroenzephalographie basierenden Kommunikation
zwischen Gehirn und Computer.23 Mithilfe eines so genannten Gedankenübersetzungssystems (thought-translation-device)
wurde vollständig
Gelähmten ermöglicht, über die Selbstkontrolle langsamer kortikaler
Potenziale eine elektronische Buchstabieranordnung zu bedienen. Auf
diesem Weg konnten locked in-Patienten mit fortgeschrittener Amyotropher Lateralsklerose, die nicht mehr in der Lage waren, auf anderem
Wege mit ihrer Umgebung in Kontakt zu treten, eine Kommunikationsmöglichkeit erzielen bzw. sie konnten erlernen, durch Ja-Nein-Befehle
technische Geräte zu bedienen. Allerdings sind solche nicht-invasiven
Methoden, bei denen Hirnstrom-Aktivität außen an der Kopfhaut aufgezeichnet wird, nicht geeignet, um Arm- oder Bein-Prothesen zu bewegen, da diese lediglich die durchschnittliche elektrische Aktivität von
breiten Neuronen-Populationen widerspiegelt; es ist schwierig, hieraus
die feinen Veränderungen zu extrahieren, welche benötigt werden, um
genaue Arm- oder Handbewegungen zu codieren. Für das Erlernen einer Roboterarm-Bewegung ist vielmehr eine direkte Aufzeichnung der
W illiam H . D obelle, Artificial Vision for the Blind by Connecting a Television Camera
to the Visual Cortex, in: American Society for Artificial InternaIOrgans 46 (2000), 3-9;
D obelle Institute, Artificial Vision System For The Blind Announced By The Dobelle
Institute, in: Science Daily Magazine (18. Januar 2000)
12 Jonathan R . W olpaw /N iels B irbaum eriD ennis j. M cF arland et al., Brain-computer
interfaces for communication and contral, in: Clinical Neuraphysiology 113 (2002), 767791.
13 N iels B irbaum er/N im r
G hanayim /T hilo H interberger et al., A spelling device for the
paralysed, in: Nature 398 (1999) 297-298; W olpaw et al., B rain-com puter interfaces
(Anm.22).
21
53
�Aktivität von beim Erzeugen des jeweiligen Motorbefehls beteiligten
Neuronenpopulationen erforderlich. Für diese invasiven Methoden, bei
denen intrakortikale Elektroden eingesetzt werden, liegt - aufgrund der
mit solchen Verfahren einher gehenden Verletzungsgefahr des Gehirnsdie Schwelle für einen klinischen Einsatz wesentlich höher als für nichtinvasive Verfahren. Mithilfe derartiger invasiver Gehirn-ComputerSchnittstellen lernten Affen unter Zuhilfenahme von feedback-M echanismen, einen Roboterarm oder Ähnliches in Bewegung zu setzen über
das >Durchdenken< (thinking through) einer Bewegung, d. h. über die
Aktivität der normalerweise an dieser Bewegung beteiligten Motoneurone.24 Über solche, direkt in das Gehirn implantierten Elektroden soll
künftig Personen, die durch eine neurologische Erkrankung oder durch
Verletzung des Rückenmarks gelähmt sind, aber deren Motor-Cortex
unbeeinträchtigt ist, ermöglicht werden, durch das >Durchdenken< der
entsprechenden Bewegungen Roboter-Gliedmaßen, einen Rollstuhl,
oder Ähnliches zu bewegen. Die diesbezügliche Forschung steht allerdings erst am Anfang. Für die Zukunft wird jedoch eine rapide Weiterentwicklung der direkten invasiven Gehirn-Computer-Schnittstellen erwartet, mit einigen hundert Kontaktstellen mit Neuronen über mehrere
Motorregionen. Möglicherweise könnten entsprechende Verfahren
künftig auch dazu dienen, die Kontrolle über die eigenen natürlichen
Gliedmaßen wiederzuerlangen. Derzeit ist allerdings ungewiss, ob solche invasiven Gehirn-Computer-Schnittstellen in der Zukunft einsetzbar sein werden, ohne unvertretbare Risiken für zusätzliche Beschädigungen des Gehirns in sich zu bergen. Die Entwicklung und Implantation bioverträglicher Elektroden-Anordnungen, welche in der Lage
sind, langfristig ohne Beschädigung des Gehirns zu funktionieren, stellt
hier eine der Schlüsselaufgaben dar.
Darüber hinaus bestehen auch Bestrebungen, mithilfe von GehirnComputer- Interaktionen zusätzliche Funktionen, welche dem Menschen normalerweise nicht zur Verfügung stehen, einzuführen. Einige
Ansätze sind zum jetzigen Zeitpunkt als rein spekulativ zu betrachten,
andere jedoch nicht. Die naheliegendsten Möglichkeiten zur Funktionserweiterung bestehen darin, in Weiterentwicklung der derzeit bestehenden Verfahren der Cochlea- und Retinaimplantation die Bereiche der
verfügbaren Sinneswahrnehmung auszudehnen. So könnte z. B. angestrebt werden, das Spektrum hörbarer Frequenzen auszuweiten, oder
das Sehvermögen auf den ultravioletten oder infraroten Bereich auszu24
54
M iguel A . L . N icolelislJohn K . C hapin, Controlling
American (16. September 2002).
Robots with the Mind, in: Scientific
�dehnen.25 Darüber hinaus ist - ausgehend von Modulationsverfahren
wie die sich bereits erfolgreich im klinischen Einsatz befindende Tiefenhirnstimulation bei Parkinson-Patienten oder die Nervus-Vagus-Stimulation bei Epilepsiepatienten26 - eine Erweiterung des Einsatzbereiches
vorstellbar. Eine Implantation von Elektroden könnte z. B. angestrebt
werden, um Persönlichkeitsveränderungen zu bewirken, um erwünschte
Verhaltensweisen zu erreichen bzw. zu verstärken oder um unerwünschte Verhaltensweisen auszuschalten. So wurden bspw. Ratten
mittels Mikrostimulation des Gehirns durch Elektroden dazu gebracht,
im dreidimensionalen Raum den Richtungs-Anweisungen (rechts links - vorwärts etc.) des Experimentators zu folgen.27 Dies wurde erreicht durch das Zusammenspiel geeigneter Auslöser- und Belohnungsstimulationen: durch Erzeugen virtueller Berührungen der rechten bzw.
linken Barthaare mittels Stimulation der jeweiligen somatosensorischen
kortikalen Repräsentation der Barthaare einerseits sowie entsprechende
Belohnung durch Stimulation des medialen Vorderhirnbündels andererseits. Als möglicher Einsatzbereich für diese - auch als roborats bezeichneten - Ratten wurde das Erkunden unwirtlicher Gegenden, das Suchen
verletzter Menschen in zerstörten Gebäuden, oder das Auffinden von
Landminen genannt.28 In diesem Kontext lassen sich auch weitreichende
Visionen entwickeln, wie z. B. mithilfe von im Gehirn implantierten
Computer-Chips die Gedächtnis-Kapazitäten eines Menschen zu verbessern, neue Sprachen schnell verfügbar zu machen, schnellen Zugang
zu enzyklopädischen Datenbanken zu ermöglichen, Radio-, Piepseroder Telefonfunktionen direkt zu implantieren, oder Ähnliches.29
Wie sind entsprechende Verfahren zu bewerten? Zunächst gilt es generell, bei invasiven Verfahren die Gefahr eingriffsbedingter Schädigungen
25
26
27
28
29
C ochrane, Cows Horns to Implants (Anm. 18); E llen M . M cG ee/G erald Q. M aguire,
Implantable brain chips: ethical and policy issues, in: Lahey Clinic Medical Ethics
Newsletter (2001),1,2,8; R odney B rooks, Menschmaschinen (Amm. 18).
G. D euschl/W . F ogell M . H ahne et al., Deep-brain stimulation for Parkinson's disease,
in: Journal of Neurology 249 Suppl 3 (2002) III/36-39; R usselI]. A ndrew s, Neuroprotection Trek - The Next Generation: Neuromodulation I. Techniques - Deep Brain Stimulation, Vagus Nerve Stimulation, and Transcranial Magnetic Stimulation, in: Annual
New York Academy Science 993 (2003), 1-13.
Sanjiv K . T alw ariShaohua X u/E m erson S. H aw ley et al., Rat navigation guided by remote control: Free animals can be >virtually<trained by microstimulating key areas of
their brains, in: Nature 417 (2002), 37-38.
N ell B oyce, Enter the Cyborgs: Promise and peril in a marriage of brains and silicon, in:
D.S. News (13. Mai 2002).
C ochrane, A Future of Man, Woman and Machine, in: Yukon Medien (Dec. 1999);
D ers., Cows Horns To Implants (Anm. 18); R odney B rooks, Menschmaschinen
(Anm.18).
55
�des Gehirns oder der Sinnesorgane zu bedenken, so z. B. direkte Verletzungen durch das Operationsverfahren,
sowie mittel- und langfristige
Schädigungen durch implantierte Gerätschaften, immunologische Reaktionen oder Ähnliches. Im therapeutischen
Kontext wird mittels Gehirn-Computer-Interaktionen
angestrebt, Funktionen,
die normalerweise von Teilen des menschlichen Körpers (Gliedmaßen etc.), von Sinnesorganen oder vom Gehirn ausgeübt werden, durch Computer-Funktionen zu ersetzen. Diesem Ersetzen oder Wiederherstellen
verlorener
Körperfunktionen
kommt im therapeutischen
Kontext große Bedeutung zu, bspw. wenn Sehfähigkeit wiedererlangt
oder für vollständig
Gelähmte
eine Möglichkeit
zur Kommunikation
erschlossen wird.
Schwierigkeiten können jedoch dort auftreten, wo durch das Implantat
keine funktionale Äquivalenz mit dem >normalen<, üblichen Funktionszustand erzielt werden kann, sondern wo durch den Eingriff Veränderungen der körperlichen oder mentalen Charakteristika
einer Person zu
verzeichnen sind. Hier muss der angestrebte eingriffsbedingte Erfolg gegen das Risiko möglicherweise auftretender Veränderungen abgewogen
werden. So gesehen sind Ansätze, welche darauf ausgerichtet sind, zusätzliche bzw. veränderte Funktionen oder Fähigkeiten einzuführen, generell als wesentlich problematischer
zu betrachten als Ansätze, mit deren Hilfe bei körperlich beeinträchtigten
Personen gewisse Funktionen
lediglich möglichst weitgehend ersetzt werden sollen.
Insbesondere der Möglichkeit des beabsichtigten oder unbeabsichtigten
Auftretens von Veränderungen der Persönlichkeit der ein invasives, direkt in das Gehirn implantiertes System nutzenden Person kommt hier
Bedeutung zu. Man mag in diesem Zusammenhang
zweifeln, ob das
Verhalten der jeweiligen Person nach einem solchen Eingriff vollständig
ihr selbst zuzuschreiben
ist; Fragen nach der Identität der Person und
der Zuschreibbarkeit
von Verantwortung
treten hier aueo Zu fragen
wäre, inwieweit nach einem solchen Eingriff die jeweilige Person für
ihre Handlungen
vollständig verantwortlich
gemacht werden kann,
wenn durch das implantierte System eine gewisse Modifikation der Persönlichkeit erfolgte. Denn die vorgenommene Maßnahme kann als Faktor beschrieben werden, der auf die betreffende Person einen quasi von
außen zusätzlich implantierten,
in gewissem Sinne determinierenden
Einfluss ausübt. Unsicherheiten
bezüglich der Zuschreibbarkeit
von
Verantwortung für Handlungen treten nicht nur in Fällen auf, in denen
die Zurechnungsfähigkeit
der betreffenden Patienten zur Debatte steht.
30
56
E lisabeth H ildt, Hirngewebetransplantation
und personale
Identität,
Berlin 1996.
�Vielmehr mag man auch bei auffallenden Persönlichkeitsveränderungen,
etwa bei nach dem Eingriff bei der betreffenden Person einsetzender
auffälliger Heiterkeit, Antriebslosigkeit
oder Arbeitswut, zweifeln, ob
die jeweilige Verhaltensweise
tatsächlich dieser Person selbst zugeschrieben werden kann oder ob es sich nicht vielmehr um eine von außen aufgesetzte, charakterliche Modifikation handelt. So mag, nicht nur
im Falle einer missglückten medizinischen Maßnahme, u. U. weder der
außenstehende Beobachter noch die dem Eingriff unterworfene
Person
selbst in der Lage sein, die veränderten Persönlichkeitscharakteristika
in
das Gesamterscheinungsbild
der jeweiligen Person zu integrieren und
als genuin zu dieser Person gehörend zu betrachten.
Jedoch bringt diese Sichtweise angesichts der umfangreichen Modifikationen, denen die Persönlichkeit
eines jeden Menschen normalerweise
im Laufe der Zeit unterworfen ist, große Schwierigkeiten mit sich. Denn
die Beurteilung der Zuschreibbarkeit
von Verantwortung für Handlungen müsste demnach in starkem Maße in Abhängigkeit davon variieren,
ob der Beobachter über den an der betreffenden Person durchgeführten
Eingriff informiert ist oder nicht. Die Annahme, eine Person sei nach
einem solchen Eingriff nur noch für Verhaltensweisen
verantwortlich,
die nicht durch das Verfahren modifiziert wurden, scheint mit unakzeptablen Folgen verknüpft zu sein, müsste man doch auch bei anderen,
nicht durch direkte Eingriffe in das Gehirn hervorgerufenen Persönlichkeitsveränderungen
die genuine Zuständigkeit der betreffenden Person
für diese Veränderungen genauestens überprüfen - angesichts der Bedeutung und vielfältigen Vernetzung von genetischen Faktoren und
Umwelteinflüssen
ein aussichtsloses Unterfangen. Jedoch bleibt hiervon
unbeeinflusst das Problem der betreffenden Personen und ihrer Mitmenschen bestehen, in Alltagssituationen
mit eingetretenen Persönlichkeitsveränderungen
sowie mit der Unsicherheit
bezüglich der Zuschreibbarkeit von Verantwortung zurechtzukommen.
Wann lohnt es sich, das Risiko eines Auftretens von Persönlichkeitsoder Identitätsveränderungen
auf sich zu nehmen? Grundsätzlich
können zwei verschiedene Einsatzbereiche entsprechender Verfahren unterschieden werden. Zum einen der Einsatz für therapeutische Zwecke, um
das Wiedererlangen bzw. den Erhalt normaler Fähigkeiten zu erreichen,
was als Erhalt von gesundheitlichem
Wohlbefinden
und Autonomie
charakterisiert werden kann; und zum anderen ein - derzeit im Wesentlichen fiktiver - Einsatz entsprechender
Verfahren für enhancem entZwecke, d. h. zur Verbesserung menschlicher Fähigkeiten über das normalerweise übliche Maß hinaus. Im therapeutischen
Bereich hängt die
57
�jeweilige Einschätzung stark von der konkreten Situation und vom jeweiligen Nutzen-Risiko-Verhältnis ab. Generell ist hier jedoch große
Vorsicht geboten; der zu erwartende Nutzen muss sehr groß und die
entsprechenden Risiken äußerst gering sein. Im enhancem ent- Bereich
lässt sich vor dem beschriebenen Hintergrund meiner Ansicht nach kein
Zusammenhang finden, der ein In-Kauf-Nehmen entsprechender Risiken rechtfertigen könnte.
Obwohl entsprechende enhancem ent-V erfahren derzeit reine Spekulation darstellen, so spiegelt doch die intensive Auseinandersetzung in
den verschiedenartigsten wissenschaftlichen und Science-fiction-Überlegungen die große Bedeutung wider, die entsprechenden Überlegungen
derzeit zugemessen wird. Solche enhancem ent- Träume umfassen den
Wunsch nach besserem Gedächtnis, nach größerer geistiger Flexibilität
und umfassenderen geistigen Gestaltungs-Möglichkeiten; sie sind letztlich ausgerichtet auf das Ziel, einen größeren Handlungsspielraum,
mehr Selbstbestimmung zu erreichen. Entsprechende Spekulationen
über eine mit technischen Mitteln zu erzielende Verbesserung der Fähigkeiten des Menschen sind auch aus anderen Bereichen, insbesondere
der Genetik, bekannt.31 Während im Umfeld der Genetik solche enhancem ent-B estrebungen zur Verbesserung des Menschen zumeist rigoros
abgelehnt werden, besitzen derartige Überlegungen im Zusammenhang
mit Gehirn-Computer-Interaktionen
recht große Attraktivität, wie die
enthusiastischen Visionen der verschiedenen Autoren zeigen. Diese positive Sichtweise überrascht. Weshalb besitzen die auf anderen Gebieten
gegen enhancem ent vorgebrachten Argumente hier scheinbar nicht so
große Relevanz? Weil man eine Maschine jederzeit abstellen kann? Weil
keine Beeinflussung auf der genetischen Ebene erfolgt, die unkontrollierbar erscheint und eher irreversibel ist? Weil keine Auswirkungen auf
künftige Generationen auftreten? Weil die in der Fantasie ausgedachten
Ziele so anstrebenswert erscheinen?
Trotz faszinierender Visionen sind jedoch auch enhancem ent- Vorhaben
durch von außen gesteuerte Manipulation der Hirnfunktionen nicht unproblematisch.32 Insbesondere darf die Möglichkeit ernster kurz-, mit31
32
W. F rench A nderson, Human Gene Therapy: Scientific and Ethical Considerations,
in:
Journal of Medicine and Philosophy 10 (1985), 275-91.
E llen M . M cG ee/G erald Q. M aguire, Implantable brain chips: ethical and policy issues,
in: Lahey Clinic Medical Ethics Newsletter
(Winter 2001), http://www.lahey.org/
ethics/newsletterlwinter2001_html.stm;
D aniel C. D ennett, Implantable brain chips will they change who we are?, in: Lahey Clinic Medical Ethics Newsletter
(Spring
2001), http://www.lahey.org/ethics/newsletter/spring200Chtml.stm;
M artha J. F arah,
Emerging ethical issues in neuroscience, in: Nature Neuroscience
5 (2002),1123-1129.
58
�tel- oder langfristiger Nebenwirkungen nicht vernachlässigt werden.
Auch ist keineswegs selbstverständlich, dass sich die im Gedankenexperiment hoffnungsvoll vorweggenommenen großen Erfolge entsprechender Eingriffe tatsächlich unter realen Bedingungen verwirklichen lassen.
So ist etwa im Zusammenhang mit der Erweiterung des verfügbaren Bereichs der Sinneswahrnehmung, wie z. B. Sehen im Ultravioletten oder
Infraroten, eine starke Reizüberflutung zu befürchten. Darüber hinaus
mag man ein gewisses Unbehagen bei der Idee empfinden, zusätzliche
Wissensinhalte, stärkere Konzentrationsfähigkeit oder Ähnliches durch
Einsatz technischer Hilfsmittel erzielen zu wollen, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. So lässt sich als Einwand vorbringen, es sei wertvoll, seine Zufriedenheit, seinen Erfolg usw. selbst zu erarbeiten, anstatt
entsprechende Güter und Fähigkeiten durch Verwendung technologischer Verfahren dauerhaft abrufbar zur Verfügung zu haben. Eine wichtige Rolle bei dieser Problematik spielen die oben beschriebenen Verbindungen: Personen gelten im Allgemeinen als verantwortlich für ihre
Handlungen - dieser Zusammenhang wird durch entsprechende enhancem ent-A nsätze aufgeweicht. Ein weit verbreitetes enhancem ent würde
zudem unsere Vorstellungen von >Normalität< verändern, was für den
Einzelnen - will er Benachteiligungen vermeiden - u. U. einen indirekten Zwang zur Inanspruchnahme entsprechender Verfahren nach sich
ziehen könnte.
Aus heutiger Sicht scheint die Möglichkeit zur Verwirklichung von enhancem ent-A bsichten durch Gehirn-Computer-Interaktion
in weiter
Ferne zu liegen. Demgegenüber zeichnen sich im Bereich der Neuropharmakologie zunehmend bereits jetzt entsprechende Möglichkeiten
zur Steigerung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten ab, welche
ausgiebig diskutiert werden müssen. Deutlich wurde - nicht zuletzt
durch entsprechende Visionen und science Jiction-Ü berlegungen - das
im Zusammenhang mit neuro technologischen Ansätzen häufig anzutreffende Bestreben, selbstbestimmt über die eigenen Fähigkeiten zu
verfügen und ggf. durch Technologie-unterstütztes Verbessern der eigenen Fähigkeiten den Bereich der Gestaltungsmöglichkeiten auszudehnen. Deutlich wurden jedoch auch mögliche nachteilige Effekte solcher
Ansätze, nicht zuletzt auf die Persönlichkeit, die personale Identität
und die Möglichkeit zu Selbstbestimmung und Autonomie der betreffenden, ein solches System nutzenden Person. Insbesondere die Vision,
durch enhancem ent-A nsätze selbstbestimmt über die eigenen Eigenschaften zu verfügen, erweist sich vor diesem Hintergrund als ausgesprochen problematisch.
59
�3.
FAZIT
Im Rahmen dieses Aufsatzes wurde der Einfluss der innerhalb der Gesellschaft vorhandenen starken Autonomiebetonung
auf den medizinischen Bereich untersucht, und zwar sowohl generell bezogen auf die
Arzt-Patient-Beziehung
als auch bezogen auf neuere Entwicklungen in
Humangenetik
und Neurotechnologie.
In den beschriebenen Gebieten
zeigt sich deutlich ein >Aufgreifen< der innerhalb der Gesellschaft anzutreffenden Autonomiebetonung,
sowie ein entsprechendes
Umsetzen
dieses gesellschaftlichen Ideals mit medizinischen Mitteln. Autonomiebezogene Überlegungen kommen im medizinischen Kontext nicht nur
im Zusammenhang
wohlinformierter
und selbstbestimmter
Therapiebezogener Entscheidungen zum Tragen, sondern stehen auch bei Fragen
langfristiger selbstbestimmter
Lebensgestaltung
sowie der Kontrolle
über die eigenen Fähigkeiten im Mittelpunkt.
Vergangene, derzeitige und künftige Entwicklungen
in der Medizin
spiegeln auf die eine oder andere Weise immer auch gesellschaftliche
Grundkonzepte
wider. In gewisser Hinsicht erfolgt durch aktuelle Entwicklungen der Humangenetik
und der Neurotechnologie
darüber hinausgehend sogar eine Weitung des Einsatzbereichs des Autonomie-Ideals, indem mithilfe medizinischer Mittel der Umfang und die Reichweite
der Möglichkeiten von Autonomieverwirklichung
eine Erweiterung erfährt. So werden durch prädiktive genetische Diagnostik die Möglichkeiten selbstbestimmter
Lebens- und Familienplanung
erweitert; durch
Gehirn-Computer-Interaktionen
wird die - derzeit allerdings weitgehend fiktive - Möglichkeit eröffnet, mithilfe von medizinisch-technischen Verfahren sein eigenes Wesen in selbstbestimmter
Weise zu steuern. Jedoch zeigen die in beiden Bereichen beschriebenen Implikationen
und möglicherweise auftretenden Schwierigkeiten auch die Problematik
dieser Ansätze auf. Ein kritisches Hinterfragen entsprechender Ansätze
und Entwicklungen erscheint daher nötig, um ein unreflektiertes Transferieren und Verstärken des Autonomie-Ideals
in diesen medizinischen
Bereichen zu vermeiden.
60
�
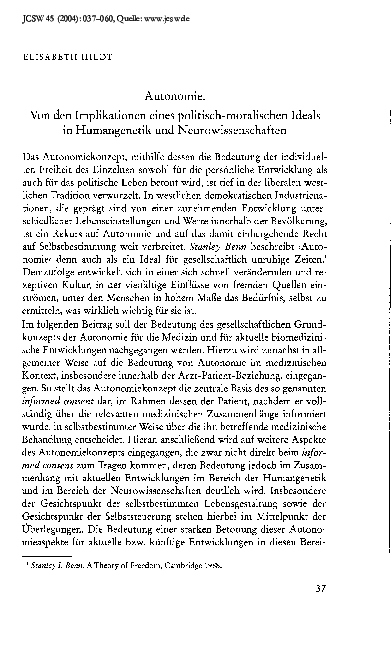
 Elisabeth Hildt
Elisabeth Hildt