Dommann, M. & Gugerli, D., 2011. Geschichtswissenschaft in
Begutachtung. Traverse, 18(2), pp.154–164.
Geschichtswissenschaft in Begutachtung
Acht Kommentare zur historischen Methode der Gegenwart1
Monika Dommann, David Gugerli
Das Ende eines Kartells
154
Firmenübergreifende Qualitätssicherung, klare Tarifstrukturen und souveräne
Selbstregulierung der Branche – kein Mensch denkt sich dabei etwas Böses. Von
Kartellen spricht man bekanntlich erst, wenn sie unter Druck geraten. Etwa dann,
wenn die Nachfrage rasant steigt, wenn neue Mitbewerber zu spät auf vertraute
Regeln verplichtet werden können oder wenn Technologien zur Anwendung
kommen, bei denen Qualitätsstandards, Leistungsvereinbarungen und Kontrollmechanismen nicht mehr in vertrauter Weise funktionieren. Genau das hat sich
in den letzten 10–15 Jahren in der Telekommunikation, bei der Paketpost, auf
dem Biermarkt und in jüngster Vergangenheit in der universitären Geschichtswissenschaft der Schweiz abgespielt.
Dass die Plafonierung universitärer Haushalte bei steigenden Studierendenzahlen die Nachfrage nach kompetitiv eingeworbenen Zweit- und Drittmitteln
gesteigert hat, ist verständlich. Wie anders hätten die Universitäten die Zahl der
verliehenen Doktortitel als Erfolgsausweis in ihre Jahresberichte aufnehmen, wie
mit der Publikationswut des Wissenschaftssystems mithalten können? Obwohl
der Schuh eigentlich schon lange bei der Lehre drückt, indet das Wachstum
in der Forschung statt, und zwar in einem Ausmass, das die funding agencies
nicht verkraften können. Allein 2010 sind die beantragten Mittel beim SNF
im Vergleich zum Vorjahr von 977 auf 1123 Millionen Franken (15 Prozent)
gestiegen, während die Bewilligungsquote von 61 auf 56 Prozent gesunken
ist und inzwischen für einzelne Projekte das Verdikt approved but not funded
eingeführt werden musste. Kleine gutachterliche Monita genügen, um ein
Gesuch abzulehnen. Die Forschungsräte können um jede noch so marginale
negative Bemerkung «froh» sein.2
Der verschärfte Wettbewerb trennt wettbewerbsfähige von wettbewerbsschwachen Disziplinen. Zu Letzteren gehören offenbar die Geschichtswissenschaften.
Dies lässt sich jedenfalls mit einigem Lektüreaufwand aus den Zahlen der Projektdatenbank des SNF ablesen.3 Eine Analyse der Projektförderung ergibt, dass
�Dommann, Gugerli: Geschichtswissenschaft in Begutachtung
die Historiker zwar nicht erfolglos operieren, aber seit Jahren auf dem gleichen
Niveau der SNF-Beiträge verharren und zwischen gut sieben und knapp 9 Millionen Franken pro Jahr zugesprochen erhalten. Vielleicht hat die Volatilität
etwas zugenommen, aber das Band, in dem sich die Gesamtzusprachen bewegen,
veränderte sich nicht. Bei den Förderprofessuren, einer Art Mitgift für Professoren von morgen, konnten sich die Geschichtswissenschaften im Wettbewerb
mit Nebenbuhlern gut halten.
Ganz anders sieht es bei der Gesamtsumme aus, die vom SNF den Geistesund Sozialwissenschaften jährlich zugesprochen wird. Sie ist zwischen 2003
und 2009 von 37 auf über 76 Millionen Franken gewachsen. Die Geschichts
wissenschaftler mit ihrem einigermassen konstanten Bezug gehören demnach
zu den relativen Verlierern des verschärften Marktspiels in der nationalen
Forschungsförderung. Ihr Anteil am gesamten Kuchen sank innert weniger
Jahre um 41 Prozent.
Auffällig sind dabei zwei Dinge: Erstens indet man die Wachstumsgewinner
im methodisch zunehmend homogenen Bereich der Psychologie, Soziologie,
Politologie und Wirtschaftswissenschaften. Das sind jene Disziplinen, deren
Forschungsstrategie als quantiizierende Methodenüberprüfung und Hypothesentest im rechnergestützten Modellbau umschrieben werden kann. Zweitens
sind seit 2003 bei den geschichtswissenschaftlichen Gesuchen die Beiträge
pro bewilligtes Gesuch um über 40 Prozent gestiegen. Mit der Anpassung der
Doktorandensaläre an die Teuerung kann das nicht erklärt werden. Vielmehr
bedeutet es, dass der SNF eher arbeitsteiligen Projekten den Vorrang gibt. Das
Nachsehen haben die hermeneutisch-historisch orientierten, einzelkämpferisch
aufgestellten Projekte, wie sie ausser in der Geschichte auch in der Literaturwissenschaft bislang üblich waren. Oder gelangen nur jene geisteswissenschaftlichen Antragsteller an den SNF, die bereit sind, aus ihren gemütlicheren und
grundauftraginanzierten Studierstuben herauszutreten? Schwierig zu beurteilen,
ob die Geschichtswissenschaft inzwischen dort angelangt ist, wo sie weiland
Hans Conrad Peyer schon lange vermutet hat, nämlich im Bereich des höheren
Journalismus ohne Publikum. Ihre handlungslegitimatorische Funktion hat sie
jedenfalls deinitiv an die Ökonomie, die Politikberatung an die Politologie
abgetreten, während gesellschaftliches Monitoring das Geschäft der Soziologie
ist und die Beantwortungskompetenz für die Frage nach der Selbstverortung des
Menschen einer mit Magnetresonanztomografen und Spiellaboratorien hochgerüsteten empirischen Psychologie übertragen werden musste – zusammen mit
dem Anspruch auf Forschungsmittel. Die einstigen Gutachter und Zitationskartelle der Narrationsspezialisten brachen offenbar zusammen, weil Historiker
es verpasst haben, mit ihren Methoden professionell zu verfahren: sprich alte
Methoden als Ausschliessungsmechanismen und Alleinstellungsmerkmale gegen
155
�Debatte / Débat
traverse 2011/2
Neueindringlinge zu verteidigen. Derweil fahren die Korrelationsspezialisten in
der stochastischen Wüste der Datenbankvorräte dieser Welt einen deutlichen, ja
bezifferbaren Proit ihrer Methode ein und bestätigen ihren Kollegen bei Bedarf
knapp und efizient, dass sie sich mit ihren Gesuchen an der methodischen
cutting edge bewegen und in top journals publizieren.
Profit der Methode
Mag sein, dass die Ziffern täuschen. Vielleicht sind ja die Gestehungskosten von
Einsichten, die aufgrund angestrengten Nachdenkens über gesellschaftliche und
kulturelle Entwicklung hervorgebracht werden, einfach tiefer als die Kosten jenes
Hochleistungsrechnens, dem sich die number crunchers im Bereich der Gesellschaftsphysik und des Entscheidungsverhaltens verschrieben haben. Schliesslich
muss ja auch das Spielgeld der Probanden irgendwie inanziert werden. Als His
torikerin könnte man sich dann beruhigt zurücklehnen, weil sich das budgetär
ungünstige Verhältnis zwischen Geschichtswissenschaft und Politologie dank
höherer Efizienz der Historiker im Resultat wieder ausgleichen liesse. Allerdings
darf die langfristige Wirkmächtigkeit der gegenwärtigen Entwicklung der Forschungsbudgets nicht unterschätzt werden. Wer am Wachstum nicht partizipiert,
wird quantité negligeable.
Der Verdacht lässt sich nicht aus der Welt schaffen: Der Methodenhype der
Soziologie ist vielleicht doch mehr als blosse Spekulation und leeres Versprechen, während der Anspruch auf Verstehen, den die Hermeneutiker ins
Feld führen, zwar solidem, aber antiquiertem Handwerk entspricht, das nicht
mehr nachgefragt wird. Dass Zahlen in die Irre führen, wissen wir seit all
den inhaltlich belanglosen Rechnereien der Kliometrie und der historischen
Sozialwissenschaft in den 1960er und 70erJahren. Aber im Zeitalter transdisziplinärer Begutachtungsgremien und standardisierter Evaluationskriterien
ist der Trend zu homogenen Forschungsdesigns offensichtlich. Im Vergleich
zu den Datenanalysetechniken der Sozialwissenschaften, die aus jedem noch
so wilden Rauschen stets eine darstellbare Einsicht iltern können und bereits
in den Forschungsanträgen mit einem Arsenal von Methoden glänzen, welche
mit der Hebelkraft von self-fulilling prophecies keine Zweifel mehr an der
feasibility ihres Vorhabens übrig lassen, steht die «historische Methode» nur
mehr ziemlich schwachbrüstig da. Dabei hatten wir doch einst einen so verlässlichen Methodenhaushalt.
156
�Dommann, Gugerli: Geschichtswissenschaft in Begutachtung
Die Zeitgeschichte auf der Überholspur
Welche Disziplinen und Subdisziplinen wann, womit und mit welcher Absicht auf
den Plan getreten sind und damit Erfolg hatten, ist eine historische Frage, welche
die Historiker für sich genauer sortieren sollten. Die Vermutung liegt nahe, dass
diejenigen, die später kommen, stets als Störenfriede wahrgenommen werden, oft
aber auch gewitzter sind als die Pioniere. Die Entwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsinstrumente zum historischen Gebrauch, wie sie die Historiker
in den 1960er- und 70er-Jahren betrieben haben, muss die Soziologen geärgert
haben. Und die Historiker ärgern sich heute über die Extrapolation sozialwissenschaftlicher Gegenwartsdiagnosen in die Vergangenheit, wohlwissend, dass das
alles gar nicht so einfach sein kann, dass für eine Untersuchung argumentativer
Zusammenhänge aber der Zugang zu den Archiven fehlt. Diese gehen bekanntlich
erst dann auf, wenn ihr Inhalt keine gravierenden Differenzen in der Gegenwart
mehr erzeugen kann.
Mitte des 19. Jahrhunderts avancierte die Geschichte im Zuge der Nationalstaatsgründungen zum staatstragenden Fach. Die national und regional ausgerichteten Editionen wurden zu einem Charakteristikum der Geschichtsschreibung in ihrer wissenschaftlichen Inkubationsphase. Dabei ist das Fach nicht stehen
geblieben, sondern hat als vielfältiges Konzert zwischen der Wirtschaftsgeschichte
(Sombart, Schumpeter), der Kunstgeschichte (Burckhardt), der Kulturgeschichte
(Lamprecht, Huizinga), der Geograie (Bloch, Fèbvre), der Begriffsgeschichte
(Brunner, Conze, Koselleck) bis hin zur historischen Sozialwissenschaft (Wehler,
Kocka) methodisch beachtliche und empirisch produktive Theorieschübe erlebt.
Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts mutierte dann auch die Geschichte zur ganz
normalen Wissenschaft: Es begann das Zeitalter der Forschungsprojekte, die von
Forschern einzeln und zunehmend auch in Gruppen beantragt, von Fachkollegen
begutachtet, von der scientiic community evaluiert und durch nationalstaatlich
(und neuerdings transnational) alimentierte Institutionen inanziert werden.
Originalität, Methodik, Machbarkeit und Leistungsausweis des Antragstellers
sind die Kategorien auf dem standardisierten Formular, welche den Experten als
Rahmen für die Begutachtung zur Verfügung gestellt werden. Die Methode ist das
wichtigste Verständigungskonzept für die Begutachtung von Projekten zwischen
den Disziplinen, sie wird deshalb auch zu ihrem grössten Zankapfel.
Die vorwiegend qualitative historische Methodik ist den Wachstumsgewinnern
im Forschungsförderungsmarkt Psychologie, Soziologie, Politologie und den
Wirtschaftswissenschaften fremd. Je quantitativer eine Disziplin arbeitet und
je mehr sie ihre eigenen qualitativen Überreste eliminiert, desto geringer ist
das Verständnis gegenüber dem, was in qualitativ-historischen Untersuchungen
getrieben wird. Manchmal artikuliert sich dieses Unverständnis dezent in den
157
�Debatte / Débat
traverse 2011/2
Kaffeepausen zwischen jenen Sitzungen der nationalen und transnationalen
Fördergremien, an denen die verschiedenen Fachvertreter gemeinsam über
die Projektanträge beinden. Gelegentlich manifestiert es sich auch ganz offen
während den Sitzungen, vorab dann, wenn die Fachgutachten voneinander abweichen. Dann wird das Feld frei für fachübergreifende Debatten und es öffnet
sich ein Raum für unangenehme Rückfragen aus anderen Disziplinen. Das
Unverständnis betrifft speziell die Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts und
insbesondere die Zeitgeschichte, seit sie ihr Untersuchungsinteresse von den
Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus auf Untersuchungsgegenstände
ausgeweitet hat, die auch von anderen Disziplinen bearbeitet werden. Die Sozialwissenschaftlerinnen sind zuweilen schon da, bevor die Historiker kommen:
Sie haben das Konsum-, Heirats- und Wahlverhalten bestimmter Zeitabschnitte
mittels quantiizierender Methoden erhoben, sie haben die sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kognitiven Prozesse analysiert, die dem Verhalten zugrunde liegen, und sie haben ihre Ergebnisse zu Theorien kleinerer, mittlerer
oder grösserer Reichweiten verarbeitet. Einst galt als Zeithistorikerin, wer sich
mit der Geschichte des Nationalsozialismus beschäftigte. Mediale Präsenz war
garantiert und beförderte Schweizer Historiker zu einem beliebten Angriffsziel
von Oppositionsparteien. Heute aber verlassen Gegenwartshistoriker eingezäunte
Themen und fangen da an, wo die Sozialwissenschaftler aufgehört haben. Indem
sie zu historisieren beginnen, werden sie zu Spielverderbern, weil sie die von den
Sozialwissenschaftlern erarbeiteten Resultate kontextualisieren und damit auch
die hart erarbeiteten Fakten (Konzepte, Kategorien und Theorien) zu historischen
Untersuchungsobjekten degradieren. Und je mehr sie das zu tun wagen, desto
grösser wird die Versuchung für Rückfragen: Hat das überhaupt Methode, was
Historiker tun, und wenn ja, welche?
Geschichte als Kunst?
158
Die Frage nach der Methode ist die ganz gefährliche Frage, die jedem Historiker
den Angstschweiss auf die Stirne treibt. Ja, natürlich sind das Methoden, ganz viele
sogar, mehr, als uns lieb ist, und die meisten haben wir mit guten Gründen schon
lange entsorgt. Nach wie vor werden in den Proseminaren und in textlich greifbaren
Einführungen in die Geschichtswissenschaft die Novizen mit den Standards der
Geschichtswissenschaft vertraut gemacht. Aber es lässt sich eine eigentümliche
didaktische Scheu feststellen, wenn es um Methodik geht. Der Begriff wird
sicherheitshalber kaum verwendet. Die Einführung in das historische Arbeiten
geht phänomenologisch vor und folgt der Chronologie des Forschungsprozesses.
Während unserer Ausbildung griffen wir auf den grünweissen «Borowski/Vogel/
�Dommann, Gugerli: Geschichtswissenschaft in Begutachtung
Wunder» zurück, der uns Uneingeweihten den Weg zur Geschichtswissenschaft
wies.4 Er führte über das Konsultieren der Handbücher und Nachschlagewerke
und über das Anlegen eines eigenen Karteikastens (ein erster Höhepunkt der Initiation) zum Bibliograieren, dem Arbeiten mit der Fachliteratur und schliesslich
in das Heiligtum der Arbeit mit den Quellen. Denn Historiker ist, wer bis in den
Kern der Quellenkritik vorgestossen ist.
Was die historische Methode seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnet, ist von
Geschichtstheoretikern von Johann Gustav Droysen bis Reinhard Koselleck relektiert worden: Es geht um ein Bekenntnis zum Empirismus und zum Veto der
Quellen, um eine Auseinandersetzung mit verschiedenen «Materialien» (Droysen
erwähnte «Schriftsteller, Akten, Monumente, Gesetze, Zustände, Überbleibsel
aller Art»),5 die es aufeinander zu beziehen gilt, und um die starke Gewichtung
von «Entwicklung» und «organischem Zusammenhang». Doch wäre damit die
von den Sozialwissenschaften geforderte Erklärung zu den Methoden geliefert?
Wohl kaum, zumal erschwerend hinzukommt, dass Marc Bloch, der grosse Mitbegründer der Annales, nicht der einzige Historiker blieb, der betont hat, dass
die Quellenkritik stets eine Kunst bleiben werde, «für die es eines besonderen
Fingerspitzengefühls» bedürfe und deshalb kein Rezeptbuch geben könne.6 Sozialwissenschaftler und Vertreterinnen der exakten Naturwissenschaften würden
wohl endgültig die Wissenschaftlichkeit der historischen Methode infrage stellen,
wenn man mit Marc Bloch weiterfahren und erwähnen würde, dass die Geschichte
«ganz besondere ästhetische Genüsse» zu bieten habe und sogar unterhaltsam
sei.7 Muss sich die Geschichtswissenschaft zur Kunst erklären und sich nicht
mehr beim Schweizerischen Nationalfonds, sondern beim Bundesamt für Kultur
um die Finanzierung ihrer Forschung bemühen?
Die historische Methode als Weg zur Sache (und zum Wissen)
Die Geschichtswissenschaft ist eine Wissenschaft, die Methoden ungern expliziert und sie im handwerklichen Stil vermittelt. Learning by doing, im besten
Fall ein Leben lang. Die Geschichtswissenschaft begreift Methode als Weg, als
ein Unterwegssein (μέθοδος) zur Sache und damit als Prozess, der während der
Arbeit (im Archiv) modiiziert und präzisiert wird. Die Geschichtswissenschaft
sucht nicht die weissen Flecken auf der Landkarte und sie versteht Forschen nicht
als das Füllen von Lücken. Sie begibt sich ins Archiv, um mit der Fragestellung
und dem Gegenstand angemessenen Methoden neues Wissen zu erarbeiten. Dabei
rechnet sie immer mit Umleitungen, Staus, Abkürzungen, Fahrzeugwechseln und
Boxenstopps. Auch deshalb sollten sich Historikerinnen nicht auf die Position
des genialen Künstlers zurückziehen und behaupten, ihre Methodik sei sprachlich
159
�Debatte / Débat
traverse 2011/2
nicht fassbar. Vielmehr sollten die Geschichtswissenschaften ihr methodisch
reichhaltiges Wissen explizit machen und darauf hinweisen, dass methodologische
Vorentscheidungen in Unkenntnis des Terrains und der Sache, die es im Hinblick
auf verallgemeinerbare Erkenntnisgewinne zu erkunden gilt, inefizient und in
den meisten Fällen unproduktiv wäre.8 Die historische Methodenvielfalt bietet
demgegenüber einen entscheidenden Vorteil: Sie kann situativ angepasst werden,
bleibt lexibel und verwendet die Werkzeuge und Vehikel, die in einer bestimmten
Archivsituation vernünftig sind. Das implizite und handwerkliche Können und
Wissen der Geschichtswissenschaften ist viel reicher und vielfältiger, als die
Historiker bislang in ihren Projektanträgen sagen wollten.
Das hat im Übrigen gute Tradition: Seit dem 19. Jahrhundert ist die geschichts
wissenschaftliche Methode durch einen differenzierten Umgang mit Quellen,
durch Fragen nach der Überlieferung und Übertragung gekennzeichnet. Sie
ist eine Medienwissenschaft avant la lettre und hat sich schon viele Jahre vor
Marshall McLuhans Diktum, dass das Medium die Botschaft sei, im Rahmen
der Quellenkritik (Was sagt die Quelle? Wie ist die Quelle hierhergekommen?
Wer hat sie produziert? Et cetera.) mit der Bedeutung der Medialität für die
Herstellung von Sinn beschäftigt. Der amerikanische Medienwissenschaftler
John Durham Peters hat unlängst darauf hingewiesen, dass Historiker gerade
deshalb Medienwissenschaftler seien, weil sie die Produktions- und Distributionsprozesse von Texten und Artefakten bei der Lektüre immer schon mit
berücksichtigt hätten9 – Prozesse, die Carlo Ginzburg als Semiotik der Spuren
und Paul Ricœur als Hermeneutik der Zeugenschaft bezeichnet haben. Dieses
Explizitmachen von tacit knowledge wäre dringend zu erweitern und in die
Anträge historischer Forschungsprojekte zu integrieren. Vielleicht wären Historiker dann sogar die besseren Soziologen (weil sie die Kontingenz immer
im Blick haben) oder die besseren Politologen (insbesondere wenn es um
Phasen politischer Unübersichtlichkeit geht, in denen Prognosen nicht mehr
das erzählen, was alle längst vermutet haben).
Organisierter Skeptizismus oder Neuheitsbehauptungen?
160
In den Statistiken des Bundesamts für Statistik für das Jahr 2009 ist nachzulesen,
dass die Naturwissenschaften 28,4 Prozent aller Beschäftigten an universitären
Hochschulen (gemessen in Vollzeitäquivalenten) stellen, vor der Medizin und
Pharmazie (18,7 Prozent) und den Geistes und Sozialwissenschaften (15,8 Prozent), die sich damit noch knapp vor den durch Universitätsreformen gestärkten «zentralen Bereichen» halten können.10 Innerhalb dieser dritten Gruppe
verfügen die Sozialwissenschaften über die meisten Stellenprozente (2448),
�Dommann, Gugerli: Geschichtswissenschaft in Begutachtung
gefolgt von Sprach und Literaturwissenschaften (1129) und den Geschichts und
Kulturwissenschaften (1070). Obwohl sie weniger Personal beschäftigen und
in zeitliche Epochen und geograische Räume aufgefächert sind, die autonom
funktionieren, werden die Geschichtswissenschaften von den anderen sozialund geisteswissenschaftlichen Fächern als ein grosses Fach wahrgenommen.
Die Geschichte gilt als arriviert, etabliert und – hier beginnt der Neid – dominierend. Die Wahrnehmung der Geschichte als grosses mächtiges Fach könnte
damit zu tun haben, dass sie ihre fachliche Identität auch in Phasen der Methodenstreitigkeiten gewahrt hat.11 Weder die historischen Sozialwissenschaften,
die Kliometrie noch der New Historism oder der Postrukturalismus konnten
das gemeinsame Selbstverständnis der Geschichtswissenschaften grundlegend
erschüttern. Die starke fachliche Identität äussert sich auch in einer hohen
Verantwortung gegenüber der Fachgemeinschaft im Begutachtungsprozess:
Die Rücklaufquote ist höher als bei den Nachbarn und die Gutachten sind
ausführlicher. Durch die Vorgabe der elektronischen Übermittelung wurde die
Gutachtertätigkeit jüngst zu einer Angelegenheit des Ausfüllens eines Formulars. Die neuen elektronischen Formulartechnologien begrenzen auch die
Erzählkunst der historischen Gutachten, sie werden im Zeitalter der Formulare
und check boxes wohl knapper werden. Vielleicht wird dies für die narrationslustigen Geschichtswissenschaften zu einem Problem werden und es wird in
Zukunft – bei Gutachtern wie bei Antragstellern – weniger in den Aufbau der
Argumentation investiert. Irgendwann werden sich auch die Historikerinnen
dem Diktat der knappen Aussagen und des zahlenbasierten Urteils unterworfen
haben. Die Geschichte, die nie eine galileische Wissenschaft geworden ist,12
die immer bedingungslos an das Konkrete gebunden war, wird dann zumindest
in der Gutachtertätigkeit kapituliert haben.
In der Geschichte sind die Gutachten eher auf den Forschungsgegenstand
denn auf den Theoriebezug ausgerichtet, Theoriedebatten werden in den
Gutachten selten ausgetragen. Dies hat möglicherweise damit zu tun, dass die
Geschichtswissenschaft eine Expertin für Vergänglichkeiten, Renaissancen
und Revolutionen von Theorien ist. Sie hat eine grosse Sensibilität dafür, dass
auch Theorien Konjunkturen und Zeitlichkeiten unterworfen sind: Wenn heute
Bourdieu als veraltet gilt, Latour à jour ist, Derrida als dépassé oder Luhmann
als up to date wahrgenommen wird, kann morgen schon wieder alles anders sein.
Historikerinnen sind aus methodologischen Gründen konservativer, vorsichtiger
und skeptischer als andere Disziplinen gegenüber Neuheitsbehauptungen. Was im
wissenschaftlichen Denken manchmal ein Vorteil ist, kann im wissenschaftlichen
Wettbewerb, wo Forschungsförderung an Innovationsversprechen gekoppelt
ist, jedoch zum Nachteil werden, vor allem wenn die gutachterliche Narrationslust
und Fantasie dazu neigt, Problemlagen weiter als nötig auszudifferenzieren und
161
�Debatte / Débat
traverse 2011/2
Gutachten durch zahlreiche Hinweise für den anstehenden Forschungs prozess
zu überladen. Das kann von normierungsfreundlichen Disziplinenvertretern
nur als methodische Unklarheit verstanden und moniert werden.
Die Geschichte hat sich nie professionalisiert
Das Markenzeichen der Geschichtswissenschaften sind auch in Zeiten der
Bibliometrie die Monograien geblieben, die alleine verfasst, teuer produziert
und in Gelehrtenstuben und Bibliotheken aufbewahrt werden, und die vom
Radar der Zitationsanalyse und auch von den Suchmaschinen nicht erfasst
werden (insbesondere dann, wenn restriktive Urhebergesetze die Massenerfassung von Bibliotheksware verhindern). Historische Monograien werden
jedoch keineswegs nur von Geschichtsforschenden mit akademischen Ambitionen oder Weihen geschrieben, sondern auch vom historisch ausgebildeten
Dorlehrer, vom Weltwochejournalisten oder gar von Autodidakten. Historiker
behandeln historisches Wissen mit guten Gründen als ein öffentliches Gut, für
das es keine durchsetzbaren geistigen Eigentumsrechte gibt. Wer das Diktum
des Vetorechts der Quellen (Koselleck) beachtet, muss nicht mit Ausschluss
aus der Forschergemeinschaft rechnen. Diese Offenheit des Feldes vermochte
die alte Disziplin während der letzten 150 Jahre immer wieder zu erneuern.
Doch nun könnte sie zum Problem werden, weil das Berufsethos, das durch
Einzelkämpfertum geprägt ist und sich der Markenplege des Berufsstands
verweigert hat, durch ein weiteres Charakteristikum der Historikerzunft verschärft wird: die Weigerung in Grossprojekten zu kooperieren und sich unter
die Führerschaft eines leading houses zu begeben. Wenn in Zukunft wie zu
Zeiten von heissen und kalten Kriegen ein grosser Teil der Forschungsgelder
in big science investiert werden wird, könnten die Eigentümlichkeiten der
Geschichtswissenschaften langfristig zum Überlebensproblem werden. Dass es
auch gross angelegte Forschungsprojekte jenseits der big science geben sollte,
wäre der Wissenschaft zu wünschen. Dies sollten auch die Sozialwissenschaften
bedenken: Immerhin wurde eine der wichtigsten theoretischen Erneuerungen
der Sozialwissenschaften der letzten Jahrzehnte dezidiert als Gegenprojekt zum
Aufstieg der an Förderungsgremien gekoppelten Projektmacherei Ende der
1960er-Jahre initiiert. Keinem Geringeren als Niklas Luhmann wird nachgesagt,
bei der Berufung nach Bielefeld ein Formular zu seinem Forschungsvorhaben
ausgefüllt zu haben. Luhmanns Meldung an die Ministerialbürokratie unterschritt
den verfügbaren Rahmen deutlich und lautete lakonisch: «Projekt: Theorie der
Gesellschaft, Laufzeit: 30 Jahre, Kosten: keine».
162
�Dommann, Gugerli: Geschichtswissenschaft in Begutachtung
Das Forschungsdesign steht zur Debatte
Die gegenwärtigen Wettbewerbsbedingungen zeichnen sich durch eine Präferenz
für arbeitsteilige, kurzfristige, modularisierte Formen der Forschungsorganisation aus, die auf methodische Konstanz setzen. Gleichzeitig schlägt sich die
akademische Produktion am gewinnträchtigsten im standardisierten Format
des kurzen Zeitschriftenbeitrags nieder. Die Logistik der wissenschaftlichen
Warendistributionsmaschinerie hat sich längst auf diese efiziente Artikelbewirtschaftung eingestellt und wird darin von den Ratingagenturen unterstützt. Wo
just in time production das Motto ist und lean production die ganze Kühlkette
vom Forschungsantrag bis zur Papierauslieferung charakterisiert, bleibt weder
Zeit für Langzeitvorhaben der Forschenden noch Raum für die Lagerhaltung von
Monograien. Selbst bei Habilitationen ist die sozialwissenschaftliche Bestelleinheit inzwischen auf ein halbes Dutzend oft von mehreren Autoren fabrizierte und
für den Begutachtungsprozess bloss provisorisch verklammerte Standardartikel
normiert worden, deren cutting edge Qualität sich nach dem impact factor der
vorgesehenen Publikationsform bemisst. Wer bloss mit kurzfristigen Überlebensstrategien auf den Wettbewerb der Wissenschaft reagiert, wird das Schicksal der
Mammuts wahrscheinlich nicht abwenden können. Will die Geschichtswissenschaft
langfristig ausserhalb eines Nischendaseins überleben, muss sie darüber nachdenken, ob eine Anpassung an das methodisch homogene Forschungsdesign der
Wachstumsgewinner zwingend ist, oder ob sie statt dessen den Zusammenbruch
des alten Kartells zum Anlass nehmen möchte, die Methodenfrage als Gegenstand
epistemologischer Erörterungen zu reaktivieren. Niemand sehnt sich in die «gute
alte Zeit» des (Bier)Kartells zurück. Attraktiver scheint uns eine Verständigung
über zukunftsträchtige Geschäftspraktiken: weder feindliche Übernahmen noch
methodische Raubkopien bei der Konkurrenz, sondern experimentierfreudiges,
kreatives Verhalten unter Offenlegung der stillen Reserven. Gefragt ist kein neues
Reinheitsgebot innerhalb der Branche, sondern eine Abkehr von der gegenwärtigen Praxis der kostenintensiven Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, weil wir
inzwischen gelernt haben sollten, dass nach den neuen Regeln des Forschungsförderungsmarktes die alten Geschäftspraktiken umgehend bestraft werden.
Um nicht in Traditionsrezepten zu verharren und die Geschichte als methodisch
vielfältige Veranstaltung erkenntnistheoretisch relektieren und explizieren zu
können, sind dringend Debatten gefragt. Geschichtswissenschaftliche Journals
reservieren zwar bisweilen eine Sektion für debattenähnliche Veranstaltungen,
aber die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, in diesem Graubereich der
Nestbeschmutzung zu publizieren, hält sich in engen Grenzen. Noch weniger sind
Historiker bereit, ihre Widersprüche und Konlikte in der weiteren Öffentlichkeit auszutragen. «Der Historikerstreit» ist kein institutionalisiertes Ritual, kein
163
�Debatte / Débat
traverse 2011/2
regelmässig auftauchendes Phänomen, sondern eine ganz bestimmte, selbstverständlich klar datierbare Debatte, die vor einem Vierteljahrhundert die Gemüter
erregt hat. Es wäre deshalb nicht verwunderlich, wenn jene zukunftsgerichtete
Debatte, die wir uns wünschen, gar nicht stattinden wird. Angesichts der mäs
sigen Aussichten, mit Erfolg eine neue Pressuregroup der Historiker aufzubauen,
angesichts des (etwa im Vergleich zur Volkskunde) geringen Leidensdrucks, und
angesichts des biedermeierlichen Wohlbehagens in der eigenen Studierstube könnte
es recht verlockend sein, sich auf das zu verlassen, was schon da ist. Auch wenn
es – relativ gesehen – immer weniger wird.
Anmerkungen
164
1 Wir danken Simon Egli für aufwendige Recherchen und Auswertungen der Forschungsdatenbank des SNF, Lea Haller für wertvolle Kommentare, sowie gegenwärtigen und ehemaligen
Forschungsratsmitgliedern des SNF und Mitarbeitern des SNF für Ihre Bereitschaft, ihre
Einschätzungen und Erfahrungen mit uns zu teilen.
2 Zur jüngsten Entwicklung der Bewilligungsquote beim SNF vgl. Dieter Imboden, «Sinkende
Erfolgsquoten beim SNF: Ein nicht beabsichtigter Erfolg der Forschung», in SNF-Info 12
(März 2011), 2.
3 Diese Angaben basieren auf einer Auswertung der Forschungsdatenbank, wie sie vom SNF
auf www.snf.ch publiziert wird.
4 Peter Borowski, Barbara Vogel, Heide Wunder, Einführung in die Geschichtswissenschaft
I: Grundprobleme, Arbeitsorganisation, Hilfsmittel, Opladen 1980 (1. Auf. 1975). Kürzlich
hat Martin Lengwiler eine rot-weiss-violette Einführung vorgelegt, welche das Projekt verfolgt, die etwas in Vergessenheit geratenen historischen Hilfswissenschaften (von Ahasver
von Brandt in den 1950erJahren als die «Werkzeuge des Historikers» bezeichnet) unter dem
Begriff der «Methoden» in der Ausbildung der Fachausbildung wieder zu verankern: Martin
Lengwiler, Praxisbuch Geschichte. Einführung in die historischen Methoden, Zürich 2011.
5 Johann Gustav Droysen, Historik, Bd. 1: Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung
der Vorlesungen (1857), Grundriss der Historik in der ersten handschriftlichen (1857–1858)
und in der letzten gedruckten Fassung (1882), Stuttgart 1977, 9.
6 Marc Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers, Stuttgart
2002 (Paris 1997), 124.
7 Ebd., 8.
8 Michael Polanyi, Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy, Chicago 1962
(1. Aul. 1958).
9 John Durham Peters, «Geschichte als Kommunikationsproblem», Zeitschrift für Medienwissenschaft 1 (2009), 81–92, hier 82 f.
10 Die Technischen Wissenschaften stellen 14%, die Wirtschaftswissenschaft 5,4%, das Recht
5,4%, «Interdisziplinäre und andere» 1,5%. Vgl. Bundesamt für Statistik (BFS) (Hg.),
Personal der universitären Hochschulen 2009, Neuenburg 2011, 10, 12.
11 Zur Selbstwahrnehmung der Geschichtswissenschaft in der Schweiz in den 1990er-Jahren
vgl. Ulrich Pister, Martin Leonhard, Evaluation der geisteswissenschaftlichen Forschung in
der Schweiz (Forschungspolitik 34), hg. von Schweizerischer Wissenschaftsrat, Schweizerische Akademie der Sozial und Geisteswissenschaften, Allgemeine Geschichtsforschende
Gesellschaft der Schweiz, Bern 1996.
12 Carlo Ginzburg, «Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt
die Lupe, Freud liest Morelli – Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst», in Ders.,
Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst, Berlin 1995, 19 f.
�
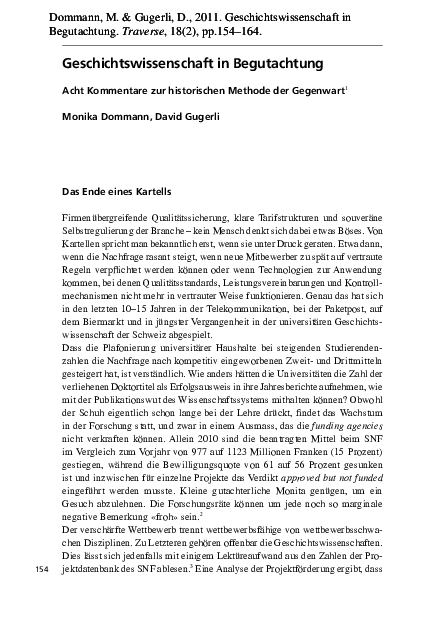
 David Gugerli
David Gugerli Monika Dommann
Monika Dommann