eikones
Herausgegeben vom Nationalen Forschungsschwerpunkt
Bildkritik an der Universität Basel
Denken mit dem Bild
Philosophische Einsätze des Bildbegriffs
von Platon bis Hegel
Johannes Grave | Arno Schubbach (Hg.)
Wilhelm Fink
�Inhalt
Vorwort
David Ambuel
Schutzumschlag:
Fra Angelico, Sacra Conversazione (Madonna der Schatten), um 1440-50, Florenz, San Marco (Detail).
13
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
43
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte,
Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten.
© 2010 Wilhelm Fink Verlag, München
(Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn)
Internet: www.fink.de
eikones NFS Bildkritik
www.eikones.ch
Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein Förderinstrument des Schweizerischen Nationalfonds.
Platon: In Bildern denken
Michel Fattal
Bild und Weltproduktion bei Plotin. Eine Kritik des
gnostischen Bildes
Johann Kreuzer
75
Was heißt es, sich als Bild zu verstehen?
Von Augustinus zu Eckhart
Thomas Leinkauf
99
Der Bild-Begriff bei Cusanus
Birgit Sandkaulen
131
Gestaltungskonzept eikones Publikationsreihe: Michael Renner, Basel
Layout und Satz: Marta Amigo, Basel
»Bilder sind«. Zur Ontologie des Bildes
im Diskurs um 1800
Johannes Grave und Arno Schubbach
153
Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
Zur bildtheoretischen
Relevanz der Philosophiegeschichte
ISBN 978-3-7705-5010-4
183
Autorinnen und Autoren
�Vorwort
Bilder geben zu denken. Ihnen liegen oftmals mehr oder weniger
reflektierte Überlegungen zugrunde, und sie regen ihrerseits Betrachter zum Denken an. So sehr das Bild zunächst das Sehen anspricht, ist es doch immer schon in ein Denken verstrickt. Lässt
sich deshalb aber schon von einem Denken mit dem Bild sprechen – von einem Denken, das nicht nur vom Bild ausgeht, von ihm
angestoßen wird, sondern auf das Bild angewiesen ist und sich an
ihm vollzieht?
Der vorliegende Band will diese Frage zum Ausgangspunkt nehmen und vor Augen führen, dass sich das Denken tatsächlich auf ausgesprochen produktive Weise des Bildes bedient hat.
Insbesondere in der Antike und im Mittelalter konnte das Bild
ins Zentrum philosophischer Reflexionen rücken und zu einem
wichtigen Begriff ausgearbeitet werden, der kaum mehr Bezüge zu
den uns geläufigen, sichtbaren und materiell manifesten Bildern
aufzuweisen scheint. Zwar ließe sich punktuell – das scheint in allen Beiträgen des vorliegenden Bandes auf – auch das abstrakteste
Denken mit dem Bild immer wieder auf Erfahrungen mit sinnlichen und sichtbaren Bildern beziehen, um schließlich die Grundfrage zu stellen, warum das Bild das Denken in so produktiver
6|7
�Form herausfordern kann. Die Aufmerksamkeit soll im Folgenden
jedoch auf den Begriff des Bildes und seine Bedeutung im Vollzug
des philosophischen Argumentierens gelenkt werden. Ein solches
Denken mit dem Bild löst sich zwar von Bildern im engeren Sinne.
Gerade dadurch kann es aber zu bedenken geben, dass unsere heutigen Vorstellungen über Bilder keineswegs selbstverständlich sind.
Der Annäherung an exemplarische Fälle eines Denkens
mit dem Bild dienen fünf Rückblicke in die Geschichte der Philosophie. Mit dem Brückenschlag zwischen der Bildfrage und der
Philosophie verbindet sich auf diese Weise zugleich eine historische Rückbesinnung, die dazu anleiten kann, scheinbar vertraute
Begriffe fremd erscheinen zu lassen, sie in neuer Komplexität zu erschließen und dadurch das eigene Denken um ungewohnte Ansätze
zu bereichern. Tatsächlich erweist sich die Ausblendung historischer
Tiefendimensionen für die bildtheoretische Reflexion als besonders
folgenreich. Verbreitete Generalthesen über die platonische Bilderfeindlichkeit oder über das biblische Bilderverbot drohen komplexe
historische Konstellationen zu verschütten, bevor sie für die Schärfung systematischer Fragen genutzt werden können. Gerade aber
die theoretische Erörterung allgemeiner Bestimmungen des Bildes
bedarf gezielter Rückgriffe auf die Bild- und Theoriegeschichte. Der
vorliegende Band versucht daher in bildtheoretischer Perspektive Philosophen zur Geltung zu bringen, die dem Begriff des Bildes
in ihren Texten eine zentrale Stellung eingeräumt haben: Platon,
Plotin, Augustinus, Eckhart, Cusanus, Kant, Fichte und Hegel.
Bei allen erheblichen Differenzen ist den genannten Denkern gemeinsam, dass sie sich des Bildbegriffs bedient haben, um
den Menschen und sein Verhältnis zur Wirklichkeit zu konzipieren.
Das bildtheoretische Potential ihrer philosophischen Entwürfe wäre
daher nicht ausgeschöpft, wenn man allein exemplarische Ref lexionen zum Bild im engeren Sinne oder zu den bildenden Künsten
rekonstruierte. Es gilt vielmehr nach dem operativen Einsatz des
Bildbegriffs zu fragen: Welche Funktion nehmen die eikon, das eidolon, die imago, die icona oder das Bild im jeweiligen Denkvollzug
ein? Wann und auf welche Weise wird auf das Bild zurückgegriffen? Welche Relationen und Konstellation werden im Rückgriff
auf die Kategorie des Bildes beschrieben? Die Aufsätze von David
Ambuel, Michel Fattal, Johann Kreuzer, Thomas Leinkauf und Birgit Sandkaulen zeichnen eindrucksvoll nach, welche gedankliche
Komplexität sich im Zuge eines Denkens mit dem Bild entfalten
kann. Sie lassen darüber hinaus erkennen, dass in einigen Fällen
Denken mit dem Bild
allein der Begriff des Bildes Relationen zu konzipieren erlaubt, die
sich mit dem sonstigen begrifflichen Instrumentarium des philosophischen Denkens kaum erfassen lassen.
Indem die fünf Beiträge Einblicke in den operativen Einsatz und den theoretischen Mehrwert des Bildbegriffs eröffnen, beantworten sie jedoch nicht sogleich die Frage, welche Folgerungen
sich aus dem philosophischen Rückgriff auf den Begriff des Bildes
für die aktuelle Beschäftigung mit dem Bild ziehen lassen. Das
Nachwort greift diese Frage auf und entwickelt einige Überlegungen
zur Relevanz der Philosophiegeschichte für heutige bildtheoretische
Probleme. Die Skizze versteht sich jedoch nur als ein erster, vorläufiger Vorschlag. Es wird weiterer, intensiver Bemühungen bedürfen, um das Verhältnis zwischen dem Begriff des Bildes in der
Philosophie und dem Bild im umfassenden Sinne und in all seinen
Erscheinungsformen genauer zu klären. Viel wäre aber bereits erreicht, wenn der vorliegende Band dazu einladen könnte, auch an
unvermuteten Stellen nach produktiven Bezügen zwischen philosophischen Bildbegriffen und der aktuellen Frage nach der Bedeutung
der Bilder zu suchen.
Den skizzierten Fragen konnten die Herausgeber in einem
Umfeld nachgehen, das an der Bilddebatte wie am philosophischen
Denken gleichermaßen stark interessiert ist. Der Nationale Forschungsschwerpunkt »Bildkritik« der Universität Basel unter der
Leitung von Gottfried Boehm bot einen idealen Rahmen, um einen
Philosophen und einen Kunsthistoriker auf gemeinsame Interessen
stoßen zu lassen, so dass im Gespräch die Idee zu einer philosophiehistorischen Spurensuche mit Sensibilität für das Bild reifen konnte.
Ohne die Bereitschaft auswärtiger Gastreferenten, sich im Rahmen
einer Vortragsreihe unter dem Titel »Denken mit dem Bild« auf die
zunächst vage und vielleicht auch gewagte Thematik einzulassen,
hätte sich diese Idee nicht verfolgen lassen. Aus der Vortragsreihe,
zu der u. a. Johann Kreuzer und Thomas Leinkauf beigetragen hatten, erwuchs der Plan zu einem Buch, für das sich mit David Ambuel und Michel Fattal auch Kollegen aus den USA und Frankreich
gewinnen ließen. Ein Seminar im Rahmen der eikones Summer
School 2008 bot nicht nur eine Gelegenheit, erste Überlegungen gemeinsam mit Doktorierenden aus ganz Europa sowie mit Christoph
Asmuth zu diskutieren. Dem Anlass verdanken wir vielmehr auch
einen Vortrag von Birgit Sandkaulen, den sie in leicht überarbeiteter Fassung dankenswerterweise für diesen Band zur Verfügung
gestellt hat. Die Einladung durch Andreas Beyer und Danièle Cohn,
Vorwort
8|9
�eine vorläufige Bilanz unseres Projekts im Deutschen Forum für
Kunstgeschichte (Paris) vorzustellen, hat schließlich geholfen, die
im Nachwort skizzierten Gedanken in der Diskussion mit den
dortigen Stipendiaten und Mitarbeitern zu schärfen. Bei allen erwähnten Veranstaltungen haben wir von vielfältigen Anregungen
zahlreicher Gesprächspartner profitiert. Unser Dank gilt Orlando
Budelacci und dem organisatorischen Team von eikones für die
praktische Unterstützung unseres Projektes sowie Marta Amigo
und Michael Renner von der Hochschule für Gestaltung und Kunst
in Basel für die ebenso präzise wie reibungslose graphische Realisierung dieser Seiten. Ganz besonders danken möchten wir schließlich
Florian Wöller, der das Vorhaben mit kritischem Interesse begleitet
und vor allem zum Schluss tatkräftig gefördert hat.
Paris und Basel, März 2010
Johannes Grave und Arno Schubbach
Denken mit dem Bild
10 | 11
�Begriffe des Bildes vor dem
Zeitalter der Ästhetik?
Zur bildtheoretischen Relevanz
der Philosophiegeschichte
Johannes Grave und Arno Schubbach
I
Vorüberlegungen
Philosophische Einsätze des Bildbegriffs – dem sperrigen Untertitel
des vorliegenden Bandes liegt eine keineswegs selbstverständliche
These zugrunde: Das Bild, so suggeriert die Formulierung, kann
nicht nur zum Gegenstand philosophischen Denkens werden, sondern fungiert zugleich als ein begriffliches Instrument der Philosophie. Will sie einen eigenständigen Beitrag zum Nachdenken über
Bilder erbringen, so darf sich die Philosophie nicht allein auf die
Bestimmung und Klärung des Bildbegriffs beschränken. Vielmehr
gilt es gerade im operativen Einsatz dieses Begriffs, im Denken
mit dem Bild, die Produktivität einer Vollzugsform der Philosophie wiederzugewinnen, um auf diese Weise nicht zuletzt über die
Möglichkeiten und Grenzen des Bildes nachzudenken.
Die These erscheint verlockend. Doch ein erster, kursorischer Rückblick in die Philosophiegeschichte dürfte rasch Zweifel an diesem optimistischen Programm aufkommen lassen. Schon
Platon wollte die Maler aus seinem Idealstaat verbannen,1 und allzu
vertraut scheint uns die Skepsis der begrifflich arbeitenden Philosophen gegenüber dem Bild. Auch angesichts der Sprachphilosophie
des 20. Jahrhunderts will es so scheinen, als hätte die Philosophie
152 | 153
�wenig zur Bildfrage beizutragen oder als würde sie sich gar gegen
das Bild wenden. Bei näherer Betrachtung erweist sich die Lage
freilich als komplizierter. Denn Platon hatte keineswegs allein artifizielle, von Menschenhand gemachte Bilder, etwa Gemälde oder
Zeichnungen, vor Augen, als er über das Bild nachdachte. Ebenso
wenig nahm die ihm folgende philosophische Tradition eine solche
Einschränkung vor. Wenn dennoch der Eindruck entstehen konnte, mit der philosophischen Kritik an der Malerei oder an sichtbaren Bildern sei das Bild generell diskreditiert, dann kommt ein
deutlich späteres Erbe zum Tragen: die implizite Gleichsetzung des
Bildes mit dem künstlerischen Bild. Es verdankt sich der Kunsttheorie der frühen Neuzeit und dem ästhetischen Diskurs des 18.
und 19. Jahrhunderts, dass das als Kunstwerk verstandene Gemälde zum paradigmatischen Fall des Bildes aufrücken konnte und
Bilder zunehmend an den selbstreflexiven Potentialen des Kunstwerks gemessen wurden.
Derartige geschichtliche Bedingungen teilt Platon selbstverständlich nicht. Ihm musste es daher auch keinerlei Mühe
bereiten, den Begriff des Bildes in gänzlich anderer Weise zu verwenden, um die Welt als »ein bewegtes Bild der Ewigkeit« (εἰκώ
[...] κινητόν τινα αἰῶνος) 2 zu bezeichnen. Platon, so zeigt sich bei
näherem Hinsehen, schlägt aus dem Begriff des Bildes philosophisches Kapital, indem er die sinnliche Wirklichkeit als – wenn
auch mangelhafte – Darstellung einer intelligiblen Ordnung begreift, auf die seine Philosophie insgesamt ausgerichtet ist. Er
steht mit dieser Perspektivierung des Bildbegriffs nicht allein. Auf
ähnliche Weise hat die christliche Tradition an das biblische Verständnis der Gottesebenbildlichkeit des Menschen angeknüpft,
um mittels des Bildbegriffs das intrikate Verhältnis des Geschöpfs
zu seinem Schöpfer in ebenso anspruchsvollen wie variantenreichen Diskussionen zu reflektieren. Von Bildern im heute gebräuchlichen, engeren Sinne ist auch hier gewiss nicht die Rede.
Dennoch sollten diese operativen Einsätze des Bildbegriffs und
die damit einhergehenden begrifflichen Reflexionen nicht vorschnell aus der Diskussion der Bildfrage ausgeschlossen werden.
Eine solche Grenzziehung setzt nämlich einen durch die Ästhetik
geprägten Bild- und Kunstbegriff voraus, der als solcher zuallererst zur Diskussion zu stellen wäre. Mit ihr verbindet sich zudem
die Gefahr, Aspekte von Bildlichkeit auszublenden, die unter ästhetischen Prämissen nicht fassbar oder allenfalls von geringem
Interesse sind.
Johannes Grave und Arno Schubbach
Die Auseinandersetzung mit der Philosophiegeschichte
verspricht daher gleich aus mehreren Gründen für die Bildtheorie
fruchtbar zu sein: Indem das Verhältnis der Bildfrage zur Ästhetik
in die Diskussion einbezogen wird, eröffnet sich die Möglichkeit,
Potentiale des Bildes erneut in den Blick zu nehmen, die durch
die Ästhetik in den Hintergrund gedrängt wurden und dennoch
bis heute ihre bildtheoretische Relevanz behaupten können. Zudem
kann sich die Bildtheorie auf diesem Wege ihrer historischen Bedingungen versichern und ihre systematischen Prämissen reflektieren.
Diese Reflexion ist umso notwendiger, als sich die Ästhetik ihrerseits in einem Klärungsprozess befindet: Viele Theoretiker stellen
das überkommene Verständnis einer Kunstlehre, als die sich die
Ästhetik zu Beginn des 19. Jahrhunderts etablierte, in Frage, um
sich auf deren Anfänge im 18. Jahrhundert zu besinnen. Verstärkt
orientiert sich die aktuelle Ästhetik daher wieder an einem weiten
Begriff von sinnlicher Erfahrung, der sich nicht auf die Kunst beschränkt. Und es dürfte nicht allein einem Zufall zu verdanken sein,
wenn diese Diskussion mit der Forderung nach einer Revision des
Bildbegriffs koinzidiert, der nachdrücklich von der lange prägenden
Orientierung am künstlerischen Bild abgesetzt wird.
Das Gespräch zwischen Bildtheorie und Philosophiegeschichte muss sich daher gleich mehreren Herausforderungen
stellen, um produktive Anregungen in die Debatte um das Bild einbringen zu können. Zum einen sieht sich der bildkritische Diskurs
der Aufgabe gegenüber, seine eigenen historischen, oft impliziten
und mit der Ästhetik verknüpften Bedingungen zu reflektieren.
Zum anderen gilt es, historische Begriffe des Bildes in ihrer Spezifik, aber auch Eigenwilligkeit zu erfassen, um sie dann auf die eigenen bildtheoretischen Fragestellungen beziehen zu können. Um
beiden Herausforderungen gerecht zu werden, gehen die folgenden
Überlegungen zunächst vom aktuellen Interesse am Bild aus. Dabei
ist nachzuzeichnen, wie sich die Diskussion der ›Bilderfrage‹ von
kunsthistorischen und -theoretischen Prämissen zu lösen versucht,
und dennoch weiterhin in Denkfiguren der Ästhetik verhaftet ist
(Abschnitte 2 – 5). Erst in der Abgrenzung zu diesen Positionen
werden sich Grundzüge einer Theorie des Bildes umreißen lassen,
die tatsächlich nicht mehr innerhalb des Paradigmas der Ästhetik
verbleibt. In einem kurzen Resümee der vorangehenden Beiträge
dieses Bandes sollen daher einige grundlegende Bestimmungen
des Bildes zusammengefasst werden, die durch das philosophische
Denken im Ausgang von Platon entwickelt worden sind (Abschnitt
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
154 | 155
�6). Dem Aspekt der bildlichen Darstellung soll abschließend ein
besonderes Augenmerk geschenkt werden, um die systematischen
Potentiale des bildphilosophischen Denkens vor dem Zeitalter der
Ästhetik anzudeuten (Abschnitt 7).
Dieses Vorhaben unterliegt jedoch unvermeidlich bestimmten Einschränkungen. Weder für diese Skizze noch für den
gesamten vorliegenden Band kann das Ziel leitend sein, die Philosophiegeschichte einer über 2 000 Jahre währenden Tradition darzustellen. Der bildtheoretische Nutzen der Philosophiegeschichte
soll indes in der bewussten Beschränkung auf philosophische Konstellationen, in denen ein Denken im Ausgang von Platon eine
wesentliche Rolle spielte, und in der Konzentration auf vorästhetische Bildbegriffe, die in dieser Tradition eine gewisse Kohärenz
ausbildeten, erprobt werden.3 Dabei wird es gleichermaßen darauf
ankommen, den sachlichen Differenzen und systematischen Konvergenzen gerecht zu werden. Nur wenn die vorästhetischen Begriffe des Bildes von der gegenwärtigen Debatte abgehoben, in ihrer
Differenz aber zugleich auf die aktuell drängenden Fragen bezogen
werden, dürfte das Gespräch zwischen Philosophiegeschichte und
Bildtheorie tragfähige neue Einsichten eröffnen. Die Bildbegriffe,
die in den vorangehenden Beiträgen des vorliegenden Bandes rekonstruiert werden, sind gerade deshalb von bildtheoretischer Relevanz,
weil sie unter vorästhetischen und damit unter anderen Bedingungen stehen als unser heutiges Denken. Sie können daher keine
unmittelbaren Antworten auf gegenwärtige Fragen geben, versprechen aber doch produktive Infragestellungen und Anregungen.4
II
Bilder jenseits des Kunstbildes
Die »Bilderflut« der Gegenwart, die oftmals als Ausgangspunkt des iconic turn gilt, erweist sich bei näherem Hinsehen vielleicht weniger als substantielle quantitative Zunahme der Bilder
denn vielmehr als Effekt einer geschärften Aufmerksamkeit. Wo
lange Zeit niemand explizit nach Bildern geforscht hat, entdeckt ein
neues Interesse immer mehr Gegenstände und Phänomene, denen
der Status von Bildern zugesprochen wird: wissenschaftliche Visualisierungen, virtuelle Welten, Metaphern, Schriftbilder, ja selbst
›mentale Bilder‹ beanspruchen, genuine Gegenstände einer bildwissenschaftlichen Forschung zu sein, die sich nicht mehr innerhalb der klassischen Disziplinengrenzen organisiert. Das ›Reich
der Bilder‹ ist weit größer und umfassender als lange vermutet, und
seine Konturen zeichnen sich erst langsam ab. In jedem Fall aber hat
Johannes Grave und Arno Schubbach
es die Grenzen jenes Faches, das traditionell als Wissenschaft von
den Bildern gelten durfte, mithin die Grenzen der Kunstgeschichte,
längst weit überschritten.5
Mit der Erkundung immer neuer Bildwelten geht zugleich
eine Kritik an der älteren, kunsthistorisch geprägten Perspektive
auf das Bild einher. Als fragwürdig gelten vor allem zwei implizite Vorentscheidungen, die für die Kunstgeschichte charakteristisch
sind: Kritisiert wird zum einen die scharfe Trennung zwischen jenen Bildern der Kunst, denen das Interesse des Fachs vornehmlich
gilt, und den übrigen nicht-künstlerischen Bildern, die der Analyse
von Kunstwerken bislang allenfalls als Kontrastfolie gedient haben
sollen. Zum anderen wird aber auch der spezifische Blick in Frage
gestellt, mit dem die Kunstgeschichte an ihre Gegenstände herangetreten ist. Nicht als Bilder, sondern als Kunstwerke, mithin als
Artefakte mit einer besonderen Dignität und einem entsprechenden
hermeneutischen Anspruch, habe die Kunstgeschichte ihre Gegenstände betrachtet und es dabei versäumt, das Bild im umfassenden
Sinne zu problematisieren. Wo die Kunstgeschichte sich nicht auf
einen fragwürdigen, oftmals historisch unangemessenen Werkbegriff 6 konzentriert habe, seien Bilder im Zuge der kulturgeschichtlichen Öffnung des Fachs allein als historische Zeugnisse verstanden
und gelesen worden. Die vorsichtige Lösung vom ästhetischen Paradigma, die etwa mit Erwin Panofskys Ikonologie vollzogen worden
sei, habe die Werke allein als zeichenhafte, sprachanaloge Dokumente gelten lassen, statt das Fach an eine grundlegende Reflexion
des Bildes heranzuführen.7
All das wäre eingehend und kritisch zu diskutieren.
Doch wollen wir dieser Sicht auf das problematische Verhältnis
der Kunstgeschichte zum Bild nur einen Moment folgen. Orientiert man sich zumindest in den Grundzügen an diesem Szenario, so hat die Kunstgeschichte die Frage nach dem Bild gleich in
zweifacher Hinsicht ausgeblendet: indem das Fach eine Vielzahl
von Bildern ausgrenzte und indem es den Bildstatus der von ihm
untersuchten Kunstwerke nicht eigens thematisierte. Angesichts
dieser kritischen Infragestellung des Fachs konnte es nicht ausbleiben, dass die Kunstgeschichte ihrerseits inzwischen verschiedene
Erzählstrategien entwickelt hat, um ihre eigene Fachgeschichte mit
Blick auf die ›Bilderfrage‹ neu zu justieren.8 Neben schroffen Abgrenzungen von der eigenen Disziplin (so etwa bei Hans Belting) 9
finden sich Versuche, Teile der Kunstgeschichte als Bildwissenschaft
avant la lettre zu beschreiben (Horst Bredekamp)10 oder zumindest
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
156 | 157
�Schlüsselwerke der Kunstgeschichte als zentrale Gegenstände einer
Reflexion über das Bild auszuweisen (Gottfried Boehm).11
Wie auch immer man das Verhältnis der Kunstgeschichte
zum Bild genau beschreiben will: Die aktuelle Diskussion scheint
sich unwiderruflich aus dem Bann einer ästhetisch geprägten
Kunstgeschichte zu lösen. Die Frage nach den Spezifika und Potentialen des Bildes steht nicht mehr im Schatten des Kunstbegriffs.
Zumindest auf den ersten Blick erscheint der iconic turn wie die gelungene Emanzipation einer grundlegenden Fragestellung von der
verengten Perspektive einer fragwürdigen disziplinären Tradition.
III
Das neue Interesse der Philosophie am Bild
Die Lösung der ›Bilderfrage‹ aus der disziplinären Tradition der Kunstgeschichte geht mit einem gestiegenen Interesse
anderer Fachdiskurse am Bild einher. In der Geschichte, den Sozialwissenschaften, der Literaturwissenschaft und der Wissenschaftsgeschichte wird Bildern vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt.12 Die
Hinwendung zum Bild gilt dabei nicht nur einem Untersuchungsgegenstand unter vielen, sondern führt mitunter zu tiefgreifenden
Modifikationen der jeweiligen Disziplin. Besonders bemerkenswert
erscheint das erhöhte Interesse am Bild, das sich in der Philosophie
äußert. Spätestens mit der Grundfrage »Was ist ein Bild?« scheint
eine fundamentale begriffliche Klärung durch die Philosophie unumgänglich geworden zu sein. Von verschiedener Seite wurden daher genuin philosophische Bestimmungen des Bildes vorgeschlagen;
die wirkmächtigsten Positionen hat Lambert Wiesing als anthropologische, semiotische bzw. wahrnehmungstheoretische Ansätze
charakterisiert.13 So verschieden, ja einander widersprechend diese Ansätze auch sind, dokumentieren sie doch die unverkennbare
Konjunktur des Bildes in der Philosophie.
Dass das Bild (wieder) zum Gegenstand anspruchsvoller
philosophischer Reflexion geworden ist, erscheint nur folgerichtig,
wenn man sich den Anspruch des iconic oder pictorial turn vor Augen führt. Sowohl William J. T. Mitchell als auch Gottfried Boehm
knüpften mit ihrer programmatischen Hinwendung zum Bild an
Richard Rortys linguistic turn an.14 Hatte Rortys Formel die Unhintergehbarkeit der Sprache für jegliche, auch philosophische
Reflexion markieren sollen, so behauptet der iconic oder pictorial
turn einen ebenso fundamentalen Status für das Bild. Während
Boehm unter anderem auf die Unvermeidbarkeit der metaphorischen
Rede verwies, mit der immer schon ein bildliches Moment in der
Johannes Grave und Arno Schubbach
Sprache niste, versuchte Mitchell eine grundsätzliche Theoriefähigkeit der Bilder plausibel zu machen, die sich bereits im Doppelsinn
seines Buchtitels Picture Theory (1994) ankündigt. In beiden Fällen
wird der ›Bilderfrage‹ eine grundsätzliche Relevanz zugesprochen,
die sie geradezu notwendig zum Gegenstand philosophischer Reflexion macht und jede prätendierte rein begrifflich orientierte Arbeit
der Philosophie in Frage stellt.
Zu einer prinzipiellen Herausforderung für das philosophische Denken kann das Bild jedoch nur werden, wenn es unabhängig von der ästhetischen Sonderstellung des Kunstwerks gedacht
wird. Die Frage nach einem genuin ikonischen Logos oder einer
spezifischen bildlichen Episteme greift weit über die Grenzen einer Kunsttheorie oder -philosophie hinaus. Nur deswegen kann sie
überhaupt beanspruchen, zu einer Grundfrage der Philosophie zu
werden, und nicht allein die Ästhetik zu betreffen. Auch die aktuelle
philosophische Reflexion des Bildes scheint daher eine Emanzipation von traditionellen ästhetischen Diskursen vorauszusetzen.
IV
Die aisthetische Revision der Ästhetik
Dass der ›Bilderfrage‹ gerade in jenem Moment eine zentrale Relevanz für die Philosophie zukommt, in dem sie entschieden
aus kunsttheoretischen Diskursen gelöst wird, koinzidiert in auffälliger Weise mit einer grundlegenden Öffnung und Ausweitung der
Ästhetik. Die lange verbindliche Ausrichtung der philosophischen
Ästhetik auf die Leitbegriffe ›Kunst‹ und ›Schönheit‹ wird nicht nur
zusehends fragwürdig, sondern bisweilen mit geradezu emanzipatorischer Geste für obsolet erklärt. So haben u. a. Joachim Küpper
und Christoph Menke einen »aesthetic turn« diagnostiziert, der
darauf ziele, »durch eine Umstellung der basalen Begrifflichkeit
das Feld des Ästhetischen radikal von seiner Zentrierung um den
Begriff der Kunst zu befreien«15. In ganz ähnlicher Wortwahl, wenngleich mit deutlich anderer, primär ethischer Begründung, formulierte Alan Singer seine programmatische Forderung: »rescuing
aesthetics from aestheticism« 16.
Ähnlich wie die ›Bilderfrage‹ scheint sich somit auch die
philosophische Ästhetik aus dem ›Bann‹ des Kunstbegriffs zu lösen.
Sie wird zunehmend als »allgemeine Wahrnehmungslehre« 17 verstanden oder in ein umfassendes »ästhetisches Denken«18 überführt,
das unseren Weltbezug auf Wahrnehmung gründen und sich selbst
ästhetisch vollziehen soll. Auffällig häufig rekurrieren programmatische Äußerungen zu dieser aisthetischen Revision der Ästhetik auf
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
158 | 159
�eine Gründungsschrift dieser philosophischen Disziplin: Alexander
Gottlieb Baumgartens Aesthetica (1750 / 58). Baumgarten hatte die
Ästhetik in einer bemerkenswert vielfältigen Definition als »theoria
liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulchre cogitandi, ars
analogi rationis« und schließlich als »scientia cognitionis sensitivae«
bestimmt.19 Bei Baumgarten, so scheint es, ist noch jene Offenheit
gewahrt und zugleich jener Bezug auf die sinnliche Wahrnehmung
im umfassenden Sinne betont, der in der weiteren Geschichte der
Ästhetik mit der zunehmenden Verengung auf die Kunst verdrängt
wurde.20 Das aktuelle Interesse an Baumgartens Ästhetik erweist
sich vor diesem Hintergrund als folgerichtig.
Doch deutet sich im Rückbezug auf Baumgarten bereits
die Frage an, inwieweit sich die aisthetische Revision der Ästhetik
tatsächlich von der engeren Kunsttheorie und -philosophie lösen
kann. Denn immerhin bleibt zu klären, ob sich Baumgartens Begründung und Aufwertung der sinnlichen Erkenntnis ohne einen
impliziten Rekurs auf die Kunst und vor allem die Dichtung denken
lässt. Baumgarten war auf die Kunst als einen zentralen Gegenstand
seiner Ästhetik angewiesen, um sein Projekt, die cognitio sensitiva
als eigenständige Erkenntnis auszuweisen, überzeugend vorbringen zu können. Bildende Kunst und Dichtung sind für Baumgarten keineswegs die alleinigen Gegenstände der Ästhetik, mit ihrer
sinnlichen Evidenz stehen sie aber exemplarisch dafür ein, dass es
auch unterhalb des Verstandesvermögens und jenseits eines begrifflich artikulierten Wissens Erkenntnis geben kann. Und es ist diese
Unterscheidung vom begrifflich bestimmten Wissen, die es erlaubt,
die Ästhetik von der Logik abzugrenzen. Wenn aber Baumgartens
Ästhetik trotz ihrer Offenheit und ihres umfassenden Anspruchs
letztlich kaum ohne den exemplarischen Fall des Kunstwerks zu
denken ist, so erscheinen auch die aktuellen, programmatischen
Rückbezüge auf Baumgarten in einem etwas anderen Licht: Es stellt
sich die Frage, ob nicht auch die reformulierte Ästhetik immer noch
von ihrer einstigen Nähe zur Kunst zehrt, um überzeugend für eine
nicht-substituierbare Leistung der genuin sinnlichen Erkenntnis argumentieren zu können.
V
Die ästhetische ›Mitgift‹ der Bilderfrage
Der Verdacht, dass sich ein Denken, das programmatisch
die Emanzipation von einem engeren, traditionellen Begriff des
Ästhetischen sucht, nicht gänzlich aus seiner Befangenheit zu befreien vermag, drängt sich aber nicht allein für die aisthetische ReJohannes Grave und Arno Schubbach
vision der Ästhetik auf. Auch die aktuelle Diskussion um das Bild
scheint bei näherer Betrachtung stärker traditionellen ästhetischen
Paradigmen verpflichtet zu sein, als ihre Programmatik glauben
macht. Dass sich der Bilddiskurs von der Ästhetik abgrenzt, schließt
eben nicht die fortdauernde Wirkung von Denkfiguren aus, die
maßgeblich in der ästhetischen Reflexion über Kunstwerke geprägt
worden sind.
Dass die Ästhetik solcherart fortwirkt, lässt sich an
einem der Leitgedanken des gegenwärtigen Bilddiskurses, der
Charakterisierung des Bildes als Ort und Gegenstand einer nichtpropositionalen Erkenntnis, exemplarisch nachvollziehen. Mit guten Gründen gilt das Bild als Gegenstand, an dem sich Einsichten
gewinnen lassen, ohne dass sich diese Erkenntnisse umstandslos in
Begriffe oder Propositionen transferieren ließen. Phänomenologisch orientierte Bildtheorien spitzen diese Eigenschaft des Bildes
zu, indem sie zu zeigen versuchen, dass sich der Sinn des Bildes
nur im sinnlichen Vollzug der Wahrnehmung aktualisieren und
allein auf diese Weise überhaupt gewinnen lässt. Die konstitutive
Unbestimmtheit des Bildes wird dabei als ein ›Grund‹ ikonischer
Potentialität verstanden, 21 deren Entfaltung ohne die sinnliche
Anschauung nicht zu denken ist. 22 Die daraus resultierende ›Unsagbarkeit‹ des Bildes ist jedoch nicht allein ein zentraler Topos
wahrnehmungstheoretischer Konzeptionen. Vielmehr beschreiben auch semiotische Ansätze die Spezifik des Bildes auf der
Grundlage einer Abgrenzung zur begrifflich-prädikativen Sprache. Nelson Goodman hat zwar versucht, der »Ahnung der Unsagbarkeit« 23 des Bildes ihre mysteriösen Untertöne zu nehmen,
als er sie auf die syntaktische und semantische Dichte sowie die
relative semantische Fülle des Zeichensystems Bild zurückgeführt
hat.24 Indem Goodman – und mit ihm ein Gutteil der Bildsemiotik – das Fehlen syntaktischer Disjunktheit im Zeichensystem Bild
diagnostiziert, operiert er jedoch ebenfalls mit der klassischen
Gegenüberstellung von Bild und Begriff bzw. Proposition. So unterschiedlich die Beschreibungsansätze der phänomenologischen
und semiotischen Bildtheorien auch sind, führen doch beide die
spezifischen Leistungen des Bildes auf einen Mangel an begrifflicher Bestimmtheit oder Artikuliertheit zurück – ein Mangel, der
freilich grundlegend verschieden situiert wird: im einen Fall innerhalb eines Zeichensystems, im anderen Fall auf der Ebene einer
Wahrnehmungserfahrung, die nicht zwangsläufig eine Funktionalisierung des Bildes als Zeichen impliziert.
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
160 | 161
�Dass diese Charakterisierungen des Bildes eine gewisse
Verwandtschaft zu klassischen Denkfiguren der Ästhetik aufweisen, kann keinem Zweifel unterliegen. Bereits bei Baumgarten
lässt sich beobachten, wie den Gegenständen der Ästhetik – gerade
mit Blick auf deren Komplementarität zur Logik – eine eigene Erkenntnis jenseits des begrifflich artikulierten Wissens zugeordnet
wird. Das Ästhetische zeichnet sich demnach durch eine Fülle von
sinnlichen Eindrücken und Vorstellungen aus, die noch nicht bis
zur Deutlichkeit des Begriffs artikuliert worden sind. Es ist diese
Fülle der undifferenzierten Merkmalsbestimmungen (repraesentatio clara et confusa), die nun – in einer bemerkenswerten Umwertung der von Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff
geprägten Gnoseologie – als venusta plenitudo verstanden wird.25
Baumgarten legt den Akzent darauf, dass die Fülle der Eindrücke
und Vorstellungen in der ästhetischen Erkenntnis noch nicht zu einer deutlichen und bestimmten Artikulation gefunden hat, in der
die Komplexität der venusta plenitudo unvermeidlich durch begriffliche Abstraktionen eingeschränkt würde.26 Kant sollte später sein
Konzept der »ästhetischen Idee« auf ähnliche Weise von der begrifflichen Bestimmtheit abgrenzen, beschrieb dabei jedoch Phänomene, die sich grundsätzlich einer erschöpfenden begrifflichen
Artikulation entziehen. Die »ästhetische Idee« zeichnet sich durch
Eigenschaften aus, mit denen im aktuellen Diskurs auch das Bild
beschrieben wird – mit dem Unterschied freilich, dass sich Kant auf
Darstellungsformen bezieht, durch die sich die Kunst auszeichnet:
»[…] unter einer ästhetischen Idee aber verstehe ich diejenige Vorstellung der Einbildungskraft, die viel zu denken veranlaßt, ohne
daß ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke, d. i. Begriff adäquat
sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen kann.« 27
Baumgartens venusta plenitudo lässt sich keineswegs
problemlos mit Goodmans »Dichte« und »Fülle« des Bildes identifizieren, und ebenso wenig können Kants ästhetische Idee und
die Rede von der Unbestimmtheit des Bildes parallelisiert werden.
Dennoch drängt sich der Eindruck auf, dass eine klassisch ästhetische Denkfigur in den Diskurs über das Bild transferiert worden
ist. Diese Vermutung liegt nicht zuletzt deshalb nahe, weil aus der
begrifflich nicht einholbaren Unbestimmtheit des Bildes im aktuellen Diskurs Schlussfolgerungen gezogen werden, die in auffälliger
Weise einigen Grundgedanken der klassischen Ästhetik entsprechen. Aktuelle Bildtheorien betonen ebenso wie bereits die Ästhetik
Johannes Grave und Arno Schubbach
im Gefolge Baumgartens, dass sich das Bild bzw. das Ästhetische
nicht substituieren lässt. In beiden Fällen wird der Vollzug der
Wahrnehmung des Bildes oder des Kunstwerks als dessen eigentliches Telos beschrieben. In der Ästhetik ist der unhintergehbare
Vollzugscharakter der Erfahrung des Kunstwerks schon früh betont 28 und sowohl von Kant als von Schiller mit dem Begriff des
Spiels konzeptualisiert worden.29 Für das Bild sind in durchaus
analoger Weise – etwa mit Max Imdahls Gegenüberstellung von
wiedererkennendem und sehendem Sehen 30 – genuin performative
Qualitäten hervorgehoben worden.31
Mit diesen Hinweisen auf eine ästhetische ›Mitgift‹ des
gegenwärtigen Bilddenkens sei keineswegs in Frage gestellt, dass es
überzeugend und weiterführend ist, das Bild über eine konstitutive
Unbestimmtheit oder seine syntaktische und semantische Dichte
zu beschreiben. Es zeichnet sich aber ab, dass auch die gegenwärtige Debatte um das Bild tiefer in ästhetische Denkfiguren verstrickt sein dürfte, als es ihre Programme vermuten lassen. Umso
aufschlussreicher können philosophiehistorische Rückblicke sein,
die in die Zeit vor der Epoche der Ästhetik zurückgehen, um sich
auf ältere Einsätze des Bildbegriffs in der Philosophie zu beziehen.
VI Bildbegriffe der vorästhetischen
philosophischen Tradition
Die Ästhetik hat seit ihrem Beginn mit Baumgarten nicht
nur die Wahrnehmung ins Zentrum gerückt, um sie als eigenständige Form der Erkenntnis zu rehabilitieren. Vielmehr hat sie spätestens mit Kants einflussreicher Besinnung auf die subjektiven
Vermögen und mit seiner Lehre vom ästhetischen »Reflexionsurteil« 32 auch die Reflexivität zum Maßstab alles Ästhetischen erhoben und in den Künsten in einzigartiger Weise verkörpert gesehen.
Diese »Subjektivierung der Ästhetik« 33 hat auch die Diskussion
von Bildern erfasst: Bilder wurden nun an ihrem reflexiven Potential gemessen, in dessen Zentrum das ästhetische Subjekt stehen
sollte. Im Zuge dieser Neubestimmung sind nicht nur wesentliche
Aspekte vieler Bilder wie ihre darstellende Funktion an den Rand
gedrängt worden, vielmehr bedeutete diese Entwicklung auch einen tiefgreifenden Bruch mit traditionellen Bildbegriffen. Die philosophische Tradition war seit der Antike in ihrem Wortgebrauch
wie in ihren begrifflichen Überlegungen selbstredend davon ausgegangen, dass Bilder einen gegenständlichen Bezug aufweisen. Das
Bild war immer schon Bild von etwas. So verschieden die zahlreichen
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
162 | 163
�griechischen und lateinischen philosophischen Begriffe auch sind,
die sich auf problematische und heuristische Weise als ›Bild‹ übersetzen lassen, ist ihnen doch der Bezug des Bildes auf das, wovon es
ein Bild sein soll, gemeinsam. Nur aufgrund dieser Prämisse erklärt sich, dass sich die Philosophie der Wirklichkeit zu versichern
suchte, indem sie den Menschen und seine Welt als Bilder höherer
Seinsinstanzen verstand.
Die Abkehr von diesem überkommenen Verständnis des
Bildes vollzog sich weder plötzlich noch ohne Konflikte. Um 1800
geriet der philosophische Bildbegriff unter den Einfluss der Ästhetik und der Moderne, zugleich war er aber noch nicht völlig des
tradierten Anspruchs beraubt, die Wirklichkeit stelle sich ›in Bildern‹ dar. Deshalb konnte sich noch im Deutschen Idealismus die
Diskussion um den Wirklichkeitsgehalt der Erkenntnis am Begriff
des Bildes entzünden, wie Birgit Sandkaulen in ihrem Beitrag zeigt.
Kants Kritik der reinen Vernunft rekurriert gerade dort auf den Begriff des Bildes, wo die erfolgreiche Synthese des durch die Sinne Gegebenen und der begrifflichen Leistungen des Subjekts beschrieben
werden soll. Das Bild interessiert mithin im Zusammenhang einer
Erkenntnis, in der sich die Wirklichkeit darstellt.34 Fichte knüpft an
diese Bestimmung an, riskiert aber mit der Zuspitzung der transzendentalen Begründung der Erkenntnis allein in den bildenden
Leistungen des Subjekts den Einspruch Jacobis, dass sich in solcherart hergestellten Bildern nichts mehr wirklich darstellen könne.
Dieser Streit um das freie oder gebundene Walten der Einbildungskraft kann heute wie ein Vorspiel auf Jean Baudrillards These vom
Weltverlust in der allumfassenden Sphäre der Bilder und Simulacra
erscheinen.35 Er ist aber vor allem auch der Epilog einer Tradition,
die seit der Antike und durch das Mittelalter hindurch den Bildbegriff mit einer – wenn auch stets bedrängten und bedrohten – Referenz versehen und ihn von ihr sogar abhängig gemacht hatte.
Dieser relationalen Bestimmung des Bildes liegen seit
der Antike und vor allem in der platonischen Tradition historische
Voraussetzungen zugrunde, die unserem heutigen Denken fremd
sind: Die Funktion von Bildern, etwas darzustellen, wurde nicht auf
Leistungen des Subjekts und der Kultur oder auf technische Medien
und Verfahren zurückgeführt, sondern im Zusammenhang einer
Wirklichkeit gesehen, die den Bildern vorausgeht, von ihnen unabhängig ist und ihre ›Abbilder‹ letztlich selbst hervorbringt. Oftmals
mit Verweis auf paradigmatische, natürliche Spiegelungsphänomene wurde das Bild einer hierarchischen Stufung der Seinsweisen
Johannes Grave und Arno Schubbach
eingeschrieben, in der es von ontologischer Zweitrangigkeit sein
musste: Der Gegenstand, den das Bild insofern darstellt, als es ihm
sein eigenes Sein verdankt, ist dem Bild vorgängig und genießt daher eine ontologische Vorrangigkeit.
Diese möglicherweise trivial erscheinende Bestimmung
des Bildes war in verschiedenen systematischen Zusammenhängen nicht nur nützlich, da sie philosophische Probleme zu formulieren half. Sie erwies sich auch als ungemein produktiv, weil sie
selbst zu einem philosophischen Problem wurde, so dass der Begriff des Bildes und dessen gegenständlicher Bezug unterschiedliche anspruchsvolle Ausführungen erfahren konnten. Verglichen
mit den gegenwärtigen, oft ästhetisch geprägten, mitunter kulturpessimistisch gefärbten und repräsentationskritisch orientierten
Debatten um den Weltverlust in der Bildgesellschaft erscheinen die
historischen Diskussionen um die Bestimmung des Bildbegriffs
überraschend differenziert und komplex. Sie versprechen daher
einen Gewinn an historischer wie systematischer Tiefe der Argumentation, wenn es gelingt, sie unter veränderten Vorzeichen in die
aktuellen bildtheoretischen Debatten einzubringen.
Wie David Ambuel in seinem Beitrag zeigt, dient die Entfaltung des relationalen Bildbegriffs bereits in Platons Philosophie
als einer jener Leitfäden, die das komplexe Gewebe seiner Dialoge
zusammenhalten. Bei Platon ist nicht nur das Bild im engeren
Sinne ein Beispiel dafür, dass die intelligible Ordnung dem Werden
und seiner Wirklichkeit vorgängig ist wie einem gegenständlichen
Bild der dargestellte Gegenstand. Vielmehr wird der Bildbegriff
auch zum Schlüssel, um die Wirklichkeit unter der Maßgabe jener
Ordnung zu denken, nämlich als deren Bild im erweiterten und abstrakten Sinne. 36 Platons Postulat einer intelligiblen Ordnung, die
selbst ewig ist, aber das Werdende regiert und dadurch dessen Erkennbarkeit zumindest bis zu einem gewissen Grade gewährleistet,
schließt letztlich die Behauptung ein, dass sich diese Ordnung auch
tatsächlich im Werdenden zeigt und das Werden als ihr bewegtes
Bild begreifen lässt. Folglich rückt die Frage ins Zentrum, inwiefern es einem Bild gelingen kann, in den ihm eigenen Beziehungen
der Struktur desjenigen zu entsprechen, dessen Bild es sein soll.
Platon verwebt in diesem Gedanken der Isomorphie von Bild und
Gegenstand – wie sich unter Rückgriff auf ein modernes Vokabular
formulieren ließe – nicht nur die ontologischen Grundannahmen
mit den gnoseologischen Intentionen seiner Philosophie. Er führt
damit vielmehr auch eine Definition des Bildes ein, auf die noch
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
164 | 165
�bis heute immer wieder zurückgegriffen wird, 37 und diskutiert sie
mit Bezug auf sichtbare Bilder und Gemälde ebenso wie mit Blick
auf das Werden als bewegtes Bild einer zeitlosen Ordnung.
Platon setzt mittels des Bildbegriffs somit die sinnliche
Wirklichkeit mit einer kategorialen Ordnung ins Verhältnis, um
beider Erkennbarkeit zu gewährleisten. Dieses Verhältnis schließt
aber eine spannungsvolle Differenz ein, da jedes Bild der Zeit und
dem Werden unterworfen und daher mangelhaft ist. Von der Welt
als Bild ist kein zwangloser Übertritt ins Reich der Ideen möglich,
und ein solcher Übertritt würde das Wissen von der Welt auch
gegen die Erkenntnis der Wahrheit eintauschen müssen. Die Bildhaftigkeit der Welt eröffnet der menschlichen Erfahrung der sich
verändernden Wirklichkeit jedoch den Bezug auf eine kategoriale
Ordnung als maßgebliches Vorbild für die Erkenntnis. Dieser Situation versuchen auch Platons eigene Dialoge Rechnung zu tragen: Wo
sie von der sinnlichen Wirklichkeit handeln, haben sie es mit einem
zeitlichen Bild zu tun, und doch versuchen sie auf dessen Wahrheit
hinzublicken. Sie können dabei aber nicht Platons Anforderungen
einer direkten Erkenntnis der Wahrheit als solcher entsprechen und
folgen deshalb einem eigenen Modus: Naturphilosophische Dialoge wie der Timaios nehmen selbst die Form von erzählenden und
gleichnishaften Bildern an, die wie ihr Gegenstand Teil des Werdens sind und an dessen Ungewissheiten teilhaben, aber auch auf
die Wahrheit in ihrem Gegenstand abzielen, an der sie sich messen
lassen müssen.38
Diese Diagnose ist zwar mit der Begründung und Beschränkung der Erkenntnis verknüpft, weist aber über den Bereich
der Erkenntnis hinaus. David Ambuel lenkt deshalb die Aufmerksamkeit auf den Begriff der Nachahmung, der sowohl die Fassbarkeit des sinnlich Erfahrbaren im Rekurs auf die vorgängige Ordnung
begründet als auch das menschliche Bemühen beschreibt, zur Erkenntnis jener Ordnung zu gelangen. Mit diesem Bemühen verbindet sich eine ›ethische‹ Orientierung des Menschen: Weil sich
in der bewegten Wirklichkeit das sinnliche Bild ewiger Ordnung
darstellt, ist sie bei Platon auch als eine Aufforderung an den Menschen zu sehen, sich vom Sinnlichen ab- und dem Intelligiblen
zuzuwenden. Dass sich das Sinnliche intelligibel zeigt, ist folglich
sowohl für die Erkenntnis als auch für die menschliche Lebensführung maßgeblich.
Plotin greift diese Grundgedanken auf, verbindet den
Bildbegriff aber weitaus entschiedener mit einem dynamischen
Johannes Grave und Arno Schubbach
Geschehen von kosmologischer Dimension. Bereits Platon hatte
in dem bekannten Gleichnis aus dem Timaios die Erschaffung der
Welt als Tätigkeit eines Demiurgen geschildert, der die ihm vorgegebenen Formen in die bereits existierende Materie so gut als möglich
hineinzubilden versuche. Diese Durchbildung des Sinnlichen mit
intelligiblen Formen erscheint bei Plotin dagegen als ein kosmologischer Prozess, der vom Einen als Ursprung und Quelle ausgeht, sich in die Mannigfaltigkeit der sinnlichen Welt entfaltet und
letztlich wieder auf die Einheit ausgerichtet sein soll.39 Wie Michel
Fattal in seinem Beitrag ausführt, fungieren Bilder in diesem gestuften Hervorgehen aus dem Einen in die artikulierte Einheit des
Ganzen nicht nur als Produkte der Vermittlung, sondern auch als
Instanzen der Erzeugung: Sie gehen zum einen aus dem ›höheren
Sein‹ hervor, dessen Bilder sie sind, haben aber zum anderen ihrerseits ein bildendes Potential bzw. die Kraft, neue Bilder niederen
Ranges hervorzubringen.
Plotin hält damit an der relationalen Bestimmung des
Bildes fest, führt sie aber zugleich auf neue Weise aus. Diese Relation zeigt sich nicht mehr primär darin, dass das Bild höhere Formen in sich nachbildet. Vielmehr beweist sie sich in der bildenden
Kraft des Bildes, in seiner dynamischen Potenz, als ein neuer, wenn
auch niederrangiger Ausgangspunkt der Genese wirken zu können.
Die vermittelnde Teilhabe des Bildes akzentuiert bei Plotin somit
das dynamische Potential der Wirklichkeit und nicht wie bei Platon deren unveränderliche Ordnung. Folgerichtig erfährt auch die
Beziehung des Bildes zu dem, dessen Bild es ist, eine grundlegende
Veränderung: Ein Bild ›ähnelt‹ seinem Gegenstand nicht mehr allein dahingehend, dass es in seinen internen Bezügen vorgegebene
Beziehungen und Verhältnisse widerspiegelt, sondern vor allem insoweit, als es an der genetischen Fähigkeit des Prinzips teilhat, dem
es sein eigenes Sein verdankt. Diese Konzeption der Ähnlichkeit
hält zwar an der ontologischen Nachrangigkeit des Bildes gegenüber
seinem Ursprung fest, weil das Bild seinem Prinzip ebenso wenig
an Mächtigkeit gleichkommen kann, wie das zeitliche und sinnliche
Bild eine ewige und intelligible Ordnung ohne Mangel nachzubilden in der Lage ist. Plotins Einsatz des Bildbegriffs lässt es aber auch
zu, eine ›Steigerung‹ zu denken, weil ein Bild seinem Prinzip umso
›ähnlicher‹ werden kann, als es die ihm anteilig gewordene bildende
Potenz tatsächlich ausübt.
Die platonischen und neuplatonischen Entfaltungen des
Bildbegriffs wurden in der christlichen Philosophie aufgegriffen
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
166 | 167
�und anverwandelt, um die biblische Vorgabe von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen philosophisch zu klären. Maßgeblich
Augustinus führte sie in De trinitate aus, indem er die ternären
Strukturen herausarbeitete, die der menschliche Geist mit der Trinität Gottes gemeinsam hat. Insofern sich der Mensch als ein solches
›isomorphes‹ Bild Gottes versteht, wird es ihm möglich, sich durch
sich selbst hindurch auf Gott zu beziehen, ohne die kategoriale
Differenz zu ihm in Frage zu stellen. In den folgenden Jahrhunderten wurden die konzeptionellen Spielräume des Bildbegriffs
dazu genutzt, das sich verändernde Selbstverständnis des kreatürlichen Menschen im Bezug zu seinem Schöpfer zu artikulieren.40
Wie Johann Kreuzer in seinem Beitrag herausarbeitet, wurde die
Ebenbildlichkeit des Menschen dabei nicht als einfach gegebener
Zustand verstanden, wie es Augustinus’ Analysen noch mitunter
glauben machen können. Vielmehr realisiert sich diese Bildlichkeit nur in der Selbsterkenntnis des Menschen als Gottes Ebenbild.
Diese Selbsterkenntnis führt so nicht in erster Linie auf eine Gegebenheit zurück, die in der einstigen Hervorbringung des kreatürlichen Bildes gründen würde. Jedoch eröffnet sich dem gläubigen
Christen ein inneres, dynamisches Geschehen, das zum Ziel hat,
Selbstreflexion und Gottesbezug zu verknüpfen und sich in der tätigen Erkenntnis Gott anzunähern.
Dieser zentrale Gedanke, dass die Ebenbildlichkeit des
Menschen vorrangig in seiner Fähigkeit beruht, Gott immer ähnlicher zu werden, baut auf der Dynamisierung des relationalen
Bildbegriffs durch Plotin auf und wird durch Cusanus in der Konzeption des »lebendigen Bildes« nochmals zugespitzt. Wie Thomas
Leinkauf in seinem Beitrag ausführt, radikalisiert Cusanus die ›Anähnlichung‹ des geschaffenen Bildes an seinen Schöpfer im Rückgriff auf die seit der Antike bekannte Figur der Gottwerdung des
Menschen. Er löst sie aber auch aus der rein inneren Reflexion,
um sie zur gestaltenden Tätigkeit in der Welt hin zu öffnen. Der
Mensch verliert sich nicht in der Welt, die er zu begreifen und zu
gestalten sucht. Vielmehr eignet und ähnelt er sie sich gemäß seinen Bedingungen und seinen Mitteln an. Darin gleicht er Gott, der
sich Cusanus zufolge zugleich ausfaltet und einfaltet, indem er die
Welt schafft und sie im selben Moment in sich fasst. Der Mensch
schafft zwar nicht wie Gott die Dinge, er begreift und gestaltet
sie vielmehr nur. Aber diese Tätigkeit ist wie Gottes Schöpfung
Ausdruck des Tätigen, so dass ihr Vollzug den Weg zur menschlichen Selbsterkenntnis eröffnet. Dass der Mensch Bild Gottes ist,
Johannes Grave und Arno Schubbach
heißt bei Cusanus deshalb nicht nur, dass er sich in der Erkenntnis
seiner selbst zum Bild dessen macht, wovon er ein Bild ist. Diese
Selbsterkenntnis ist vielmehr auch in dem Sinne wirksam, dass sie
nicht allein dem Selbst und seinem innerlichen Bezug zu Gott gilt,
sondern auch die Gestaltung der Welt mit einschließt.
Thomas Leinkaufs Ausführungen zu Cusanus, aber auch
Johann Kreuzers Rekonstruktion des Wegs von Augustinus bis Meister Eckhart arbeiten aber noch eine weitere wesentliche bildphilosophische Pointe heraus. In der Debatte um die Ebenbildlichkeit des
Menschen wird die Gotteserkenntnis zunehmend in der ihr eigenen
Bildlichkeit konzipiert: Sie vollzieht sich durch das Bild und löst
sich nicht gänzlich vom Bild, solange wir von diesseitigen Bedingungen ausgehen. Die ontologische Abkünftigkeit des Bildes wird
so überlagert von der Ordnung der Erkenntnis, in der der ›Gegenstand‹ nicht mehr vorgängig und unabhängig vom bildlichen Erkennen gegeben ist. Alles Erkennbare ist indes aus der Erkenntnis
des Bildes als Bild zu begreifen, in der die Differenz zwischen dem
Bild und dem, wovon es ein Bild sein soll, tatsächlich vollzogen wird.
Diese im theologischen Kontext durchaus gefährliche Konsequenz
zieht, wie Johann Kreuzer zeigt, bereits Meister Eckhart mit Blick
auf Gott und den ebenbildlichen Menschen: Das ›Urbild‹ unterscheidet sich zwar vom ›Bild‹ – wie in später entstehenden Begriffen
zu formulieren wäre – , ist aber trotz der Kluft zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit selben Wesens, weil das ›Urbild‹ nur in Differenz zum Bild, mithin durch das Bild und im Bild fassbar wird.
VII Die tradierten Bestimmungen des Bildes
und die Frage der bildlichen Darstellung
Die historischen Reflexionen auf den Bildbegriff, die in
den Beiträgen dieses Bandes rekonstruiert werden, beziehen sich
nicht oder äußerst selten auf Bilder im heutigen, engeren Sinne
von Zeichnungen, Gemälden oder Photographien. Sie gehen vielmehr von abstrakten Begriffen des Bildes aus, die sich freilich auf
zeitgenössische Erwartungen an die darstellenden Leistungen von
Bildern im engeren Sinne beziehen können.41 Im Folgenden soll jedoch nicht den möglichen Bezügen zwischen historischen Begriffen
des Bildes und ihren jeweiligen Bildkulturen nachgegangen werden,
sondern das philosophische Potential dieser Bildbegriffe im Rahmen der gegenwärtigen Diskussionen der Bildfrage im Zentrum
stehen. Potentiale einer bildtheoretischen Aktualisierung zeichnen sich vor allem dort ab, wo das von Platon ausgehende Denken
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
168 | 169
�den gegenständlichen Bezug des Bildes diskutiert hat: Im Zuge
einer philosophiehistorischen Rückbesinnung kann die antike
und mittelalterliche Philosophie dazu anregen, das Verhältnis des
Bildes zu seinem Gegenstand komplexer zu konzipieren, als es aktuelle Bildtheorien nahelegen. Nicht zuletzt aufgrund ihrer impliziten Prägung durch die Ästhetik geht die gegenwärtige Diskussion
meist davon aus, dass ›gegenständliche Bilder‹ von geringem Interesse sind, weil sie eine vorgängig gegebene Wirklichkeit lediglich
nachzeichnen oder abbilden sollen. Mit der Überwindung des Mimesiskonzepts und der traditionellen Forderung nach Ähnlichkeit
ist jede Problematisierung der referentiellen Funktion von Bildern
scheinbar weitgehend obsolet geworden. Insbesondere angesichts
der modernen Kunst wurde der gegenständliche Bezug von Bildern
nicht nur oft für uninteressant befunden, sondern geradezu bildtheoretisch diskreditiert: Wenn das Bild einen Gegenstand zeigt, so
die Annahme, droht es selbst verloren zu gehen. ›Gegenständlichen
Bildern‹ wird so eine ikonoklastische Tendenz zugeschrieben, die allein ex negativo von bildtheoretischer Relevanz wäre. Wird die Frage
nach der Darstellung des Bildes dennoch einmal ernst genommen,
dann wird sie sogleich mit Rekurs auf den Zeichenbegriff beantwortet, der seit dem linguistic turn als Passepartout zu gelten scheint,
um alle möglichen referentiellen Bezüge auf Gegenstände zu konzipieren.42 Die Frage, wie ein solcher Bezug im Falle von Bildern
beschaffen ist und in verschiedenen Bildern durch Verfahren der
Herstellung und Formen der Darstellung realisiert wird, ist damit
freilich eher vorschnell abgetan als geklärt. Denn mit dem Rekurs
auf allgemeine semiotische Konzepte unterbleibt eine genauere Beschreibung der verschiedenen bildlichen Darstellungen, die nötig
wäre, um die Frage des Bezugs von Bildern auf dargestellte Gegenstände tatsächlich zu erhellen.
Jenseits von zeichentheoretischen Ansätzen und dem bildtheoretisch diskreditierten Konzept der Ähnlichkeit 43 gibt die bildphilosophische Tradition jedoch zu bedenken, dass die Konzeption
des Bezugs des Bildes auf Gegenstände große Spielräume mit sich
bringt. Das Bild und sein Gegenstand dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Der Behauptung, dass das Bild nur unter Aufopferung seines Gegenstandes und der Gegenstand nur unter Preisgabe
des Bildes zu haben ist, liegt oft die Annahme eines Gegensatzes von
repräsentierend-transitiven und präsentierend-reflexiven Aspekten
von Bildern zugrunde. Gegen diese Annahme sprechen vielfältige
bildtheoretische Argumente, im Rückblick auf die im vorliegenden
Johannes Grave und Arno Schubbach
Band rekonstruierten philosophischen Positionen zeigt sich aber,
dass auch die bildphilosophische Tradition bereits Selbst- und
Fremdbezug zusammen gedacht hat: Indem der Mensch sich selbst
als Bild versteht, bezieht er sich zugleich auf den, dessen Bild er ist,
und eröffnet sich die Möglichkeit, sich ihm anzuähneln. Damit
ist zunächst sicherlich kein bildtheoretisches Problem im engeren
Sinne umrissen, und dennoch scheint die Frage interessant, ob
sich ein solcher Gedanke nicht auch auf bildliche Formen der Darstellung übertragen lässt. Gibt es nicht Bilder, die gerade dadurch
etwas darstellen, dass sie auch auf sich selbst verweisen? Es wäre
hier nicht nur an Beispiele aus der bildenden Kunst zu denken,44
sondern auch an Visualisierungen, die zwar etwas sichtbar machen sollen, sich dabei aber nicht mit dem Gegenstand identifizieren, sondern sich selbst als Bilder zeigen.45 Derartige Bilder halten
sich in respektvollem Abstand zum Gegenstand und öffnen sich
auf weitere Bilder desselben Gegenstandes hin.
Eine solche Reaktualisierung der in den Beiträgen des
vorliegenden Bandes behandelten Positionen bezieht nicht nur abstrakte Bestimmungen des Bildbegriffs auf konkrete Formen bildlicher Darstellungen. Sie lässt sich auch auf einen Anachronismus
ein, wenn sie antikes und mittelalterliches Denken im Zusammenhang bildtheoretischer Fragestellungen fruchtbar zu machen versucht. Denn begriffliche Bestimmungen, die Bilder abhängig sein
ließen von einer vorgängigen Wirklichkeit und höheren Formen des
Seins, sind unter modernen Bedingungen nur noch als mögliche
Charakterisierungen von bildlichen Darstellungen und ihres gegenständlichen Bezugs zu verstehen und zu erproben. Der Begriff der
Darstellung wurde jedoch entscheidend in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts geprägt und ist daher eng mit den modernen Bedingungen der Debatte um das Bild verknüpft.46 Dieser Anachronismus ist aber nicht nur unvermeidbar, wenn philosophiehistorische
Argumente, Konzepte oder Gedanken in gegenwärtige Debatten
eingebracht werden sollen. Er könnte sich auch als systematisch
fruchtbar erweisen.47
In heuristischer Hinsicht ist die Vielzahl von anspruchsvollen Konzeptionen des Bezugs des Bildes zu seinem Gegenstand
von großem Interesse: Neben die strukturelle Isomorphie, die bei
Platon wie bei Augustinus anklingt, tritt in den Beiträgen des vorliegenden Bandes Plotins Vorstellung einer Wirkmächtigkeit, die
das Bild mit seinem Gegenstand teilt, sowie der Gedanke, dass das
Bild dem Gegenstand nur insofern ähnlich sein kann, als es die
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
170 | 171
�Fähigkeit hat, ihm ähnlicher zu werden. Es scheint durchaus vielversprechend, solche Modelle in heuristischer Absicht heranzuziehen, um die Frage nach bildlicher Repräsentation zu differenzieren:
Verschiedene Verfahren und Formen von bildlichen Darstellungen
und Visualisierungen können die strukturellen Eigenschaften oder
die dynamische Potenz der Gegenstände zum Vorschein bringen,
aber auch das Dargestellte zugleich in der Differenz und Ähnlichkeit zum wirklichen Gegenstand zeigen. Eine solche deskriptive Reaktualisierung philosophiehistorischer Konzeptionen müsste stets
im Zusammenhang mit der sorgfältigen Beschreibung konkreter
Formen und Verfahren zur Darstellung stehen.
Die Relektüre vorästhetischer Bildbegriffe wirft aber darüber hinaus die prinzipielle Frage nach der Referenz von bildlichen
Darstellungen auf. Wenn nicht von vornherein die weit verbreitete Annahme zugrundegelegt wird, dass sich die Wirklichkeit nur
jenseits ihrer Darstellung zeigen könnte, weil jede Darstellung auf
Kosten der unverstellten Wirklichkeit des Dargestellten geht, dann
gilt es Formen der Vermittlung zu denken, die die Darstellung eng
und bis zur Identität auf die Wirklichkeit beziehen und doch beide strikt voneinander unterscheiden.48 Ähnlich anspruchsvolle
Probleme der Vermittlung waren jedoch oftmals der Grund, weshalb Philosophen auf den Bildbegriff zurückgegriffen haben: Was
sich in Bildern zeigte, sollte mit demjenigen übereinstimmen, was
sich auf diese Weise zeigt, und musste doch zugleich von ihm unterschieden sein, weil nicht zusammenfallen konnte und durfte,
was es zu vermitteln galt.49 Ins Zentrum der Untersuchung traten
so ›bildliche‹ Vermittlungen und Mischformen, mit denen es der
Mensch in der Welt zu tun hat. In Platons Sophistes stoßen die Gesprächspartner auf die Aporie, dass Bilder nicht wirklich sind – d. h.
unabhängig von den Dingen, von denen sie ihr Sein ableiten – , dass
sie aber ebenso wenig wirklich nicht oder nichts sind.50 Für Platon
zeigt sich darin die Verflechtung (συμπλοκή) des Seins mit dem
Nicht-Sein, der ewigen Ideen mit dem zeitlichen Werden. Unter
modernen Vorzeichen wäre das Argument ›umzudrehen‹ und von
Bildern auszugehen, die Wirklichkeit zugänglich machen, indem
sie diese darstellen und sie zugleich von sich selbst als Darstellung unterscheiden. Die Wirklichkeit zeigt sich nicht unvermittelt
als solche, aber sie zeigt sich vielleicht vermittels ihrer bildlichen
Darstellung und nach deren Maßgaben wirklich. Meister Eckhart
spitzt diesen Gedanken insofern zu, als der Mensch in der Situation
des endlichen Geschöpfs nur durch sich selbst als Ebenbild Zugang
Johannes Grave und Arno Schubbach
zu seinem Schöpfer findet, ihn damit aber auch nur im Bild und
gemäß dem Bild erfahren kann. Ist es aber nicht zumindest der
Anspruch von vielen bildlichen Darstellungen, nicht nur ein Bild
zu zeigen, sondern auch den dargestellten Gegenstand, freilich
im Bild? Wäre damit nicht eine bildliche Erschließung von Welt
bezeichnet, die zwar ebenso wenig wie im Fall der Sprache durch
einen direkten Zugriff auf die Wirklichkeit zu umgehen wäre, aber
deshalb mitnichten allen Ansprüchen auf die Darstellung von Wirklichkeit abschwören muss?
Eine solche Aneignung der philosophischen Tradition
muss keine Umkehrung der ontologischen Prämissen in ein konstruktivistisches Paradigma implizieren, gegen das sich Jacobi bereits in seiner Auseinandersetzung mit Fichtes Bildbegriff gewandt
hat. Nichts spricht dagegen, den Rückgriff auf vorästhetische Bildbegriffe mit dem Gedanken der Vorgängigkeit einer Wirklichkeit
zu verbinden, die durch und in Bildern zugänglich gemacht wird.
Wie die Beiträge des vorliegenden Bandes vor Augen führen, wurde der Bildbegriff gerade auch zur Vermittlung der Wirklichkeit
mit Seinsformen benutzt, die als vorgängig zu charakterisieren sind.
Zudem hat Hegel, wie Birgit Sandkaulen zeigt, den Bildbegriff in
strikter Absetzung von Fichte zur Beschreibung von vorgängigen
Erfahrungen herangezogen, die den dunklen Grund des Bewusstseins bilden und in einem Prozess von historischem Zuschnitt
durchzuarbeiten sind, um schließlich in ihrer begrifflichen Durchdringung zu Bewusstsein zu gelangen. Im Rahmen einer Bildphilosophie wird man diese Vorstellung einer Entwicklung vom Bild zum
Begriff kaum unhinterfragt teilen wollen. Doch gibt Hegels Auffassung des Bildbegriffs zu bedenken, dass das Verstehen von Welt
zwar konstruktive Leistungen einschließt, zugleich aber auch als
Durcharbeitung von Vorgängigem zu verstehen ist – ob nun durch
Begriffe oder Bilder.
Die Entwicklung des neuplatonischen Bildbegriffs im
Christentum scheint einem solchen Gedanken durchaus zugeneigt.
Die Transzendenz Gottes wird dem Menschen nur insofern zugänglich, als er sich als abhängiges und diesseitiges Bild Gottes zu
sehen lernt. Diese ›Erkenntnis im Bild‹ verknüpft unter Annahme
der religiös gesetzten Gottesebenbildlichkeit ihre eigene Nachträglichkeit mit der radikalen Vorgängigkeit Gottes gegenüber seinem
Geschöpf – eine Vorgängigkeit, die sich freilich, solange der Mensch
als endliches Wesen seinen Platz in der Welt hat, nur im Modus
der endlichen, abhängigen und nachträglichen Bildlichkeit zeigen
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
172 | 173
�kann. Ist damit aber nicht auch angesprochen, dass uns die Welt nur
durch Darstellungen in ihren unterschiedlichsten Formen zugänglich wird? Und geht nicht auch die Welt so in unsere nachträglichen
Bemühungen um Erkenntnis und Darstellung ein, dass sie sich nur
durch die Darstellung zeigen kann? Die vorästhetischen Bildbegriffe
sind zwar insofern ›unkritisch‹, als sie über das von Kant eingeführte
Reich der Erscheinungen hinausgreifen. Sie können aber auch noch
nach Kant die Frage aufwerfen, ob die kritische Grenze zwischen
dem Ding an sich und unseren Vorstellungen so unpassierbar ist, wie
Kant sich erhoffte, um jede Spekulation auszuschließen. Gerade die
vorästhetischen Bildbegriffe eignen sich dazu, einen geheimen, unterirdischen Grenzverkehr zu denken, der unsere Repräsentationen
je schon auf das hin geöffnet hat, das es zu erkennen gilt. Auch wenn
es nicht möglich ist, diese Grenze zu kreuzen, um die Wirklichkeit
selbst unabhängig von jeder Repräsentation vor Augen zu haben:
Vielleicht zeigen uns bildliche Darstellungen gemäß ihren eigenen
Vor- und Maßgaben doch etwas von der Wirklichkeit im Bild und
setzen uns so ins Bild über eine Wirklichkeit, die uns nur durch Darstellungen zugänglich ist.
Johannes Grave und Arno Schubbach
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
174 | 175
�Anmerkungen
1 Vgl. Platon, Politeia X, 595ff. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Platons Kritik
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
an der Malerei im Zusammenhang seiner Auseinandersetzung mit der Dichtung steht,
vgl. einführend Stephen Halliwell, The Republic’s Two Critiques of Poetry (Book II
376c-III 398b, Book X 595a – 608b), in: Ottfried Höffe (Hg.), Platon: Politeia (Klassiker
auslegen, Bd. 7), Berlin 1997, S. 313 – 332. Vor dem Hintergrund der kulturellen Konkurrenz von Philosophie und Dichtung geht es Halliwell zufolge dabei jedoch nicht
um eine Ästhetik im modernen Sinne, sondern um »an aesthetics that has no room
for aestheticism« (ebd., S. 311). Dasselbe gilt für die Beiträge des vorliegenden Bandes,
insofern sie die Frage der Ästhetik berühren.
Vgl. Platon, Timaios 37d.
Zugunsten der Kohärenz lassen wir mit der Geschichte des Bildbegriffs, wie er im
Kontext von Theorien der Wahrnehmung und Intentionalität verwendet wurde, eine
zweite, ungemein einflussreiche und historisch bedeutsame Tradition unberücksichtigt, obwohl sie im Mittelalter vielfältige Verbindungen mit dem Neuplatonismus eingegangen ist. Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass die neuplatonische
Tradition des Bildbegriffs mit der Etablierung der Ästhetik keineswegs gänzlich abreißt.
So lässt sich zumindest vermuten, dass Henri Bergsons Einsatz des Bildbegriffs in Matière et Mémoire, Paris 1896, unter dem Einfluss von Plotin steht, mit dem sich Bergson
intensiv auseinandergesetzt hat, vgl. dazu Émile Bréhier, Images Plotiniennes, Images
Bergsoniennes, in: Les Études Bergsoniennes 2 (1949), S. 107 – 128; und Rose-Marie
Mossé-Bastide, Bergson et Plotin, Paris 1959, bes. S. 52 – 85. Bergsons Bildbegriff wiederum ist zentral in Gilles Deleuzes bekannten Arbeiten zum Kino, vgl. Gilles Deleuze,
Cinéma, Paris 1983 und 1985, sowie Anne Sauvagnargues, L’image. Deleuze, Bergson et
le Cinéma, in: Alexandre Schnell (Hg.), L’image, Paris 2007, S. 157 – 176.
Mit diesem bildtheoretisch orientierten Zugriff, aber auch in der Wahl einer vorästhetischen Traditionslinie unterscheidet sich der vorliegende Band von anderen Anthologien zur Philosophie des Bildes; vgl. Schnell 2007 (wie Anm. 3) sowie Simone Neuber
und Roman Veressov (Hg.), Das Bild als Denkfigur. Funktionen des Bildbegriffs in der
Philosophiegeschichte von Platon bis Nancy, München 2010 (im Erscheinen) – ein
Band, der im Anschluss an den Kurs »Das Bild als Denkfigur« der eikones Summer
School 2008 entstanden ist.
Vgl. etwa James Elkins, Art History and Images That Are Not Art, in: ders., The Domain of Images, Ithaca 1999, S. 3 – 12; William J. Thomas Mitchell, Bildtheorie, hg. von
Gustav Frank, Frankfurt a. M. 2008, bes. S. 15 – 77 (Was ist ein Bild?); Martina Heßler,
Bilder zwischen Kunst und Wissenschaft. Neue Herausforderung für die Forschung, in:
Geschichte und Gesellschaft 31 (2005), S. 266 – 292.
Vgl. Hans Beltings Kritik an der kunsthistorischen Perspektive auf die Bildkultur des
Mittelalters; Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter
der Kunst, München 1990, S. 19.
Vgl. etwa Georges Didi-Huberman, Devant l’image. Question posée aux fins d’une histoire de l’art, Paris 1990.
Vgl. Johannes Grave, Die Kunstgeschichte als Unruhestifter im Bilddiskurs. Zur Rolle
der Fachgeschichte in Zeiten des iconic turn, in: Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal 2009 (http://www.kunstgeschichte-ejournal.net/discussion/2009/grave;
letzter Zugriff: März 2010).
Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren, 2. Aufl.
München 2002.
Horst Bredekamp, A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft, in: Critical
Inquiry 29 (2003), S. 418 – 428.
Vgl. Gottfried Boehm, Die Wiederkehr der Bilder, in: ders. (Hg.), Was ist ein Bild?,
München 1994, S. 11 – 38; zustimmend dazu Martin Seel, Ästhetik des Erscheinens,
Frankfurt a. M. 2003, S. 269; sowie Danièle Cohn, Une logique des images, in: Critique 65 (2009), H. 740 / 741, S. 39 – 48; vgl. ferner Bernadette Collenberg-Plotnikov, Die
Johannes Grave und Arno Schubbach
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Funktion der Kunst im Zeitalter der Bilder, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine
Kunstwissenschaft 50 / 1 (2005), S. 139 – 153; Susanne von Falkenhausen, Verzwickte
Verwandtschaftsverhältnisse: Kunstgeschichte, Visual Culture, Bildwissenschaft, in:
Philine Helas u. a. (Hg.), Bild / Geschichte. Festschrift für Horst Bredekamp, Berlin
2007, S. 3 – 13.
Vgl. den Überblick über das weite Spektrum der mit der Bildfrage befassten Disziplinen bei Klaus Sachs-Hombach (Hg.), Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden, Frankfurt a. M. 2005.
Lambert Wiesing, Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt
a. M. 2005, S. 17 – 38; Wiesing bezieht sich u. a. auf Studien von Hans Jonas, Jean-Paul
Sartre, Nelson Goodman, Klaus Sachs-Hombach, Edmund Husserl. – Vgl. ferner Stefan Majetschak, »Iconic Turn«. Kritische Revisionen und einige Thesen zum gegenwärtigen Stand der Bildtheorie, in: Philosophische Rundschau 49 (2002), S. 44 – 64;
Eva Schürmann, Was will die Bildwissenschaft?, in: Philosophische Rundschau 53
(2006), S. 154 – 168; Tania Vladova, Les débats sur l’image dans l’esthétique contemporaine. Remarques autour de l’autonomie et du réalisme des images visuelles, in:
Schnell 2007 (wie Anm. 3), S. 189 – 208; sowie Wiebke-Marie Stock, Eine fortdauernde
Verwirrung. Bildwissenschaftliche Zwischenbilanz, in: Philosophische Rundschau 55
(2008), S. 24 – 41.
Vgl. Boehm 1994 (wie Anm. 11), S. 13; und William J. Thomas Mitchell, Pictorial Turn,
in: ders. 2008 (wie Anm. 5), S. 101 – 135, bes. S. 101f.
Joachim Küpper und Christoph Menke, Einleitung, in: dies. (Hg.), Dimensionen
ästhetischer Erfahrung, Frankfurt a. M. 2003, S. 7 – 15, hier S. 9. – Eine ähnliche Programmatik ist vielerorts formuliert worden; vgl. stellvertretend etwa Carole TalonHugon, L’esthétique, 2. Aufl. Paris 2008, S. 118 – 120.
Alan Singer, Aesthetic Community. Recognition as an Other Sense of Sensus Communis, in: boundary 24 / 1 (1997), S. 205 – 236, hier S. 210.
Gernot Böhme, Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, München 2001.
Wolfgang Welsch, Ästhetisches Denken, 6., erw. Aufl. Stuttgart 2003.
Alexander Gottlieb Baumgarten, Ästhetik. Lateinisch-Deutsch, Hamburg 2007, Bd. 1,
S. 10 (§ 1).
Diese Verschiebung der Ästhetik von Baumgarten über Kant bis hin zu Hegel lässt sich
folgendermaßen skizzieren: Die Kunst kommt bei Baumgarten deshalb ins Spiel, weil
er sie als das Feld der Einübung und Ausbildung der sinnlichen Erkenntnisfähigkeit
begreift, deren Rehabilitation im Zentrum seiner Ästhetik steht. Kant geht es um sinnliche Erfahrungen und Darstellungen der Bedingungen von Erkenntnis und Moralität
überhaupt, wobei die Kunst nur eine Möglichkeit neben anderen ist. Erst bei Hegel ist
die Ästhetik definitorisch als Kunstphilosophie verstanden, vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke,
Bd. 13), Frankfurt a. M. 1997, bes. S. 13, und Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 3., erw. Aufl. Tübingen 1972,
S. 52 – 55. Vgl. darüber hinaus zu Baumgarten Ursula Franke, Kunst als Erkenntnis.
Die Rolle der Sinnlichkeit in der Ästhetik des Alexander Gottlieb Baumgarten (Studia Leibnitiana Supplementa, Bd. IX), Wiesbaden 1972, S. 26 – 29; zu Kant Rodolphe
Gasché, The Idea of Form. Rethinking Kant’s Aesthetics, Stanford 2003, S. 2 – 8, und
Heinz Paetzold, Ästhetik des deutschen Idealismus. Zur Idee ästhetischer Rationalität
bei Baumgarten, Kant, Schelling, Hegel und Schopenhauer, Wiesbaden 1983, S. 58 – 60
u. S. 95 – 101; vgl. zu Hegel ebd., S. 174ff.
Vgl. Gottfried Boehm, Unbestimmtheit. Zur Logik des Bildes, in: ders, Wie Bilder Sinn
erzeugen. Die Macht des Zeigens, Berlin 2007, S. 199 – 212.
Vgl. Gottfried Boehm, Bildsinn und Sinnesorgane, in: Neue Hefte für Philosophie
18 /19 (1980), S. 118 – 132.
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
176 | 177
�Anmerkungen
23 Nelson Goodman, Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie, Frankfurt a. M.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1997, S. 233.
Vgl. dazu auch Oliver R. Scholz, Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien
bildlicher Darstellung, 2., vollst. überarb. Aufl. Frankfurt a. M. 2004, bes. S. 125 u. S. 135;
Stefan Majetschak, Bild und Sichtbarkeit. Überlegungen zu einem transdisziplinären
Bildbegriff, in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 48 /1 (2003),
S. 27 – 45.
Baumgarten, Ästhetik (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 562 (§ 585); vgl. Franke 1972 (wie
Anm. 20), S. 107.
Franke 1972 (wie Anm. 20), S. 48.
Kant, Kritik der Urteilskraft, A 190 / B 192f.; vgl. ebd., A 191 / B 194: »[…] und es ist
eigentlich die Dichtkunst, in welcher sich das Vermögen ästhetischer Ideen in seinem
ganzen Maße zeigen kann.«
Ansätze zu einer Akzentuierung prozessualer und performativer Qualitäten von Kunst
finden sich bei Moses Mendelssohn und Johann Georg Sulzer; vgl. Christoph Menke,
Kraft. Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie, Frankfurt a. M. 2008, S. 80.
Vgl. Kant, Kritik der Urteilskraft, A 28 / B 28 (freies Spiel der Erkenntnisvermögen);
Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in: ders., Sämtliche Werke, Bd. 5: Erzählungen, theoretische Schriften, hg. von Gerhard Fricke und Herbert G. Göpfert, 9. Aufl. München 1993, S. 570 – 669, bes. S. 614 – 619
(15. Brief). – Christoph Menke hat darauf hingewiesen, dass Kants Spielbegriff ein aporetisches Moment eigen ist; vgl. Menke 2008 (wie Anm. 28), S. 97f.
Max Imdahl, Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik, 3. Aufl. München
1996, bes. S. 92.
Zuletzt dazu Ludger Schwarte, Die Wahrheitsfähigkeit des Bildes, in: Zeitschrift für
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 53 /1 (2008), S. 107 – 123.
Kant, Kritik der Urteilskraft, A 73 / B 74.
Gadamer 1972 (wie Anm. 20), S. 39, vgl. auch Paetzold 1983 (wie Anm. 20), S. 80f.
Bei einem genaueren Blick erweist sich die Frage nach der Darstellung ›im Bild‹ bei
Kant jedoch als durchaus komplizierter, vgl. Arno Schubbach, Von den Gründen des
Triangels bei Kant, in: Gottfried Boehm und Matteo Burioni (Hg.), Der Grund. Das
Feld des Sichtbaren, München (im Erscheinen).
Vgl. Jean Baudrillard, Agonie des Realen, Berlin 1978, z. B. S. 14f.
Vgl. zu Platons Bildbegriff auch den Abschnitt »Theorie des Bildes« in Gernot Böhme,
Platons theoretische Philosophie, Stuttgart 2000, S. 178 – 200, und ders., Theorie des
Bildes, München 2004, S. 13 – 25.
Vgl. Ludwig Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung. Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt a. M. 2003, S.14 – 17; David Lewis, On the Plurality of Worlds, Oxford 1986, S. 165f.
Vgl. zum »εἰκὼς λόγος« und »εἰκὼς µῦϑος« (Timaios 29b – d) bereits Ernst Howald,
ΕΙΚPΣ ΛΟΓΟΣ, in: Hermes 57 (1922), S. 63 – 79; Klaus Michael Meyer-Abich, Eikos
Logos: Platons Theorie der Naturwissenschaft, in: Einheit und Vielheit. Festschrift für
Carl Friedrich von Weizsäcker, hg. von Eduard Scheibe und Georg Süßmann, Göttingen 1973, S. 20 – 44; Gernot Böhme, Idee und Kosmos. Platons Zeitlehre. Eine Einführung in seine theoretische Philosophie, Frankfurt a. M. 1996, S. 27 – 67, bes. S. 56f.,
sowie Karen Gloy, Studien zur platonischen Naturphilosophie im Timaios, Würzburg
1986, S. 11ff.
Vgl. dazu auch Werner Beierwaltes, Realisierung des Bildes, in: ders., Denken des Einen.
Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt
a. M. 1985, S. 73 – 113.
Zu Augustinus’ prägender Rolle für die mittelalterliche Bildphilosophie vgl. auch
Olivier Boulnois, L’image parfaite. La structure augustino-porphyrienne des théories médiévales de l’image, in: Maria Cândida Pacheco und José F. Meirinhos (Hg.),
Johannes Grave und Arno Schubbach
41
42
43
44
45
46
47
48
Intellect et imagination dans la philosophie médiévale. Intellect and imagination in
medieval philosophy. Actes du XIe Congrès international de philosophie médiévale
de la Société internationale pour l’étude de la philosophie médiévale, Turnhout 2006,
S. 731 – 758. Boulnois weist insbesondere auf die bildbegrifflichen Konsequenzen hin,
die das theologische Problem der Gottesebenbildlichkeit zur Folge hat. So kann das
Bild im Allgemeinen nicht mehr durch seine Abkünftigkeit definiert sein, wenn die
relationale Bestimmung des Bildes ausgehend von der innertrinitarischen Beziehung
begriffen wird, in der der Sohn das Bild des Vaters, mit diesem aber zugleich eins ist,
vgl. ebd., S. 737f.
Vgl. für ein solches Forschungsprogramm Thomas Lentes, Von der Wirklichkeit und
Wahrheit des Bildes im Mittelalter. Transdisziplinäre Bildforschung in der VW-Nachwuchsgruppe »Kulturgeschichte und Theologie des Bildes im Christentum« an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, in: kritische berichte 29 (2001), S. 34 – 46,
bes. S. 43f. Das Verhältnis von philosophischen und theologischen Begriffen des Bildes
zur Bildkultur des Mittelalters steht auch im Zentrum der Arbeiten von Olivier Boulnois und Jean-Claude Schmitt, vgl. etwa Olivier Boulnois, Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge, Paris 2008; sowie Jean-Claude Schmitt, La culture
de l’imago, in: Annales. Histoire, sciences sociales 51/1 (1996), S. 3 – 36.
Nur unter der Annahme, dass Darstellung und Referenz immer auf Zeichen angewiesen sind, ist aus der Kritik an der Ähnlichkeit umstandslos zu schließen, dass Bilder
als besondere Klasse von Zeichen zu konzipieren sind, vgl. exemplarisch Scholz 2004
(wie Anm. 24), S. 79.
Vgl. die einschlägige Kritik an der Konzeption der Ähnlichkeit bei Goodman 1997 (wie
Anm. 23), S. 15ff.
Vgl. etwa – anhand von Beispielen aus der Kunst der Frührenaissance – Klaus Krüger,
Das Bild als Schleier des Unsichtbaren. Ästhetische Illusion in der Kunst der Frühen
Neuzeit in Italien, München 2001; oder Johannes Grave, Reframing the ›finestra aperta‹. Venetian Variations on the Comparison of Picture and Window, in: Zeitschrift für
Kunstgeschichte 72 (2009), S. 49 – 68.
Vgl. z. B. Arno Schubbach, »… a display (not a representation)…« Zur Sichtbarmachung von Daten, in: Navigationen. Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften
7 (2007), Themenheft: Display II, hg. von Tristan Thielmann und Jens Schröter, S. 13 – 27,
bes. S. 24 – 27.
Vgl. zur Einführung des Begriffs der Darstellung durch Klopstock und Kant Winfried
Menninghaus, »Darstellung«. Friedrich Gottlieb Klopstocks Eröffnung eines neues Paradigmas, in: Christiaan L. Hart Nibbrig (Hg.), Was heißt »Darstellen«?, Frankfurt a. M.
1994, S. 205 – 226.
Zwar hat die philosophische Tradition zwischen Bild und Wort kaum so scharf unterschieden, wie es in der gegenwärtigen bildtheoretischen Debatte mitunter versucht
wird. Sie hat sich aber insbesondere auf den Bildbegriff gestützt, wenn es darum ging,
sich der entscheidenden Bezüge zur Ordnung des Werdens, zum kosmologischen Ursprung der Welt oder zur Heilsgeschichte zu versichern. Vielleicht ist gerade deshalb
der Bildbegriff in der Philosophie nach 1800 aus der Mode geraten.
Diese Frage wäre in ihrer Weite natürlich nicht philosophisch zu entscheiden, sondern
im interdisziplinären Zusammenhang anzugehen und insbesondere im Gespräch mit
der Wissenschaftsforschung zu diskutieren, die sich nach den so genannten science
wars der 1990er Jahre längst von simplen Konstruktivismen und deren vermeintlicher
Opposition zum Realismus verabschiedet hat, vgl. stellvertretend Bruno Latour, Die
Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Frankfurt
a. M. 2002, S. 10 – 16 u. S. 84 – 95; Hans-Jörg Rheinberger, Experimentalsysteme und
epistemische Dinge. Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas, Frankfurt
a. M. 2006, S. 126 – 140; Ian Hacking, Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften, Stuttgart 1996, S. 219 – 229 u. S. 245f.
Begriffe des Bildes vor dem Zeitalter der Ästhetik?
178 | 179
�Anmerkungen
49 Die intelligible Ordnung Platons musste das Werden beherrschen, um deren Erkennt-
nis zu gewährleisten und zugleich in ihr erkennbar zu sein, ohne mit dem Werden
identisch sein zu dürfen. Das Eine im Sinne Plotins umfasst per definitionem alles und
bildet sich durch seine Emanationsstufen allem Mannigfaltigen ein, kann aber kein
einzelnes solches Mannigfaltiges sein. Im Christentum schafft Gott den Menschen
nach seinem Ebenbild und wird dem Menschen insofern zugänglich, als der Mensch
sich selbst als Bild Gottes begreifen lernt und sich ihm in der eigenen Endlichkeit annähert, ohne jemals die unendliche Distanz zu Gott minimieren oder Gott unabhängig
von seiner eigenen Bildlichkeit erlangen zu können.
50 Vgl. Platon, Sophistes 239c – 240c und zur Erläuterung der Stelle Böhme 2000 (wie
Anm. 36), S. 182ff.
Johannes Grave und Arno Schubbach
180 | 181
�
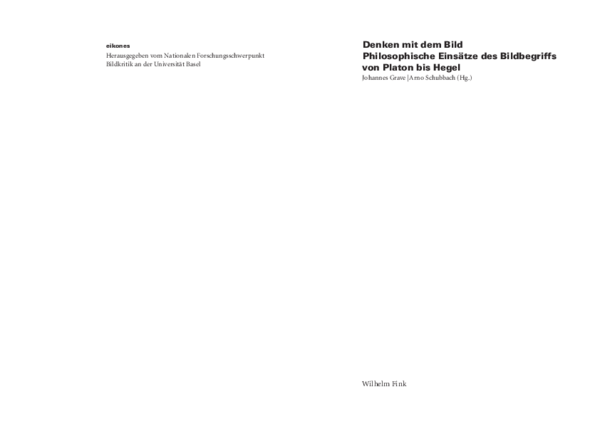
 Johannes Grave
Johannes Grave