Alexandra Heimes
Dramen der Verkennung: Untergänge
(erschienen in: Sage Anderson, Sebastian Edinger, Jakob Heller, Emanuel John (Hg.):
Übergänge. Perspektivierungen aus Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft und
Philosophie, Würzburg: Königshausen & Neumann 2017, S. 201‐217)
I. Paradoxien des Vorauswissens
„[...] besonders Unglücks‐ oder Todesfälle ereigneten sich nur selten,
ohne eine Weile vorher durch ihre Gedanken gehuscht zu sein.“
Sigmund Freud, Das Unheimliche
Die Untergänge, um die es hier gehen soll, stehen zum ‚Übergang’ in einem zweideutigen
Verhältnis. Denn zur Diskussion steht ein Typus von Ereignis, der sich nicht allein durch ein
böses Ende auszeichnet, sondern eine spezifische Komplikation aufweist: Es geht um solche
Fälle, in denen sich das Unglück einerseits überraschend und scheinbar übergangslos
ereignet, während sein Eintreten andererseits doch eine gewisse Folgerichtigkeit oder
Zwangsläufigkeit nahelegt und möglicherweise sogar ewartet wurde. Ich möchte diese
Struktur gleich zu Beginn mit einem – vielleicht etwas buchstäblichen und fraglos sehr
plakativen – Beispiel verdeutlichen: dem Untergang der Titanic, des seinerzeit größten
Passagierschiffes weltweit, das während seiner Jungfernfahrt Richtung New York im
April 1912 mit einem Eisberg kollidierte und im Atlantik versank. Es geht mir dabei weniger
um die historischen Umstände und Folgen dieser Katastrophe, als um einen bestimmten
Aspekt ihrer Wahrnehmung. Der Untergang der Titanic stellte einerseits ein Unglück von
erschütternden Ausmaßen dar, das etwa 1500 Menschen das Leben kostete. Zum anderen
besaß das Schiff, das danach als monströses Wrack auf dem Meeresboden überdauerte, bei
seiner Fertigstellung alle Eigenschaften, um als Populärmythos in die Geschichte einzugehen:
Der fast 270 Meter lange Passagierdampfer repräsentierte technischen Fortschritt und
exklusiven Luxus; er brachte gesellschaftliche Eliten zusammen und hielt die 2. und 3.
Passagierklasse von diesen fern. So formierte das Schiff eine Art Mikrokosmos, oder
genauer, das idealisierte und zugleich rückständige Bild einer Welt, das mit den Ideologien
1
�des späten 19. Jahrhunderts mehr zu tun hatte als mit der Gegenwart der
Vorkriegsgesellschaft.1
Folgt man der Einschätzung Slavoj Žižeks, so ging die allgemeine Bestürzung, die der
Schiffbruch der Titanic auslöste, nicht allein auf den Schock der unerwarteten Katastrophe
zurück. Sondern dieser Schock war zugleich auch derjenige einer bestätigten Vorahnung, die
das Nicht‐Absehbare, kontingent Hereinbrechende in gewisser Weise erwartbar erscheinen
ließ. Es wäre entsprechend nicht nur das Ausmaß der Katastrophe, das in einer breiten
Öffentlichkeit Widerhall fand, sondern die Überdeterminierung an Sinn, mit der das Ereignis
auf eine Gesellschaft am Übergang in eine neue, krisenhafte Epoche traf.2
Im Nachhinein, so könnte man sagen, nimmt der Schiffbruch die Struktur einer erfüllten
Prophezeiung an, wobei es relativ unerheblich ist, inwiefern es tatsächlich mehr oder minder
zutreffende Voraussagen des Unglücks gegeben hat. Von Interesse ist hier die paradoxe
Logik eines Vorauswissens, das in dem Moment, in dem es sich bewahrheitet – also durch
das Eintreten des Erwarteten bestätigt wird –, zugleich in seiner Gewissheit erschüttert wird.
Nichts ist irritierender, schreibt der Philosoph Clément Rosset, als eine Prophezeiung, die
sich tatsächlich erfüllt:
A is announced, A happens, and we are lost, at least to some extent. Between the
event such as it has been announced, and the event such as it was fulfilled, there is a
kind of subtle difference that suffices to baffle the very person who has been
expecting precisely that what he is witnessing. He recognizes it all right, but no
3
longer recognizes himself in it.
Das hier benannte Problem betrifft nicht die eminente Unwahrscheinlichkeit von
Vorauswissen und Erfüllung, sondern deren besondere epistemische Struktur. Das vorab
schon Erwartete in der bzw. als Realität wiederzuerkennen, bringt demnach eine
fundamentale Desillusionierung mit sich: Es lässt eine Wirklichkeit in Erscheinung treten, die
differenzlos mit sich selbst koinzidiert, und die derart das illusionäre Bild zerreißt, das wir
uns gewöhnlich von der Welt machen. Für gewöhnlich, so jedenfalls Rosset, sind wir einer
solchen Illusion bedürftig – wir verdoppeln die Welt um ein Bild von ihr, das uns einen
1
Vgl. dazu u. a. Steven Biel, Down with the Old Canoe: A Cultural History of the Titanic Disaster. New
York/London 1996.
2
Slavoj Žižek, Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und die Medien. Berlin 1991,
S. 20ff. – Vgl. auch Eva Horn, Zukunft als Katastrophe. Frankfurt a.M. 2014, S. 303: „Das katastrophische Wissen
von der Zukunft entsteht [...] immer über dem Abgrund eines Ereignisses, das man zugleich gewusst und (doch)
nicht erwartet hat.“
3
Clément Rosset, „The Oracular Illusion: The Event and its Double“, in: Ders., The Real and its Double. Chicago
2012, S. 1‐27, hier S. 19f.
2
�gewissen Spielraum oder Latenzschutz gewährt im Umgang mit dem, was wir sonst als „das
Reale schlechthin“4 annehmen müssten. Selbst dann also, wenn wir uns wünschen, dass eine
Voraussage wahrwerden möge, sind wir enttäuscht, wenn sie nicht doch minimal von dem
abweicht, was wir erwartet haben.
Rossets Auffassung des „Realen“ mag fragwürdig erscheinen; sein epistemisches Konzept
aber enthält eine Pointe, die sich produktiv wenden lässt. Denn ergiebig erscheint die These,
dass die erfüllte Prophezeiung – erstens – als Chiffre einer epistemischen Spaltung zu lesen
ist, sowie zweitens, dass das scheinbar entbehrliche und irreführende Verkennen dabei von
konstitutiver Bedeutung ist. Gespalten ist das Vorauswissen, weil es in eins mit seiner
Bestätigung auch grundlegende Irritation und Zweifel stiftet, und zwar im Hinblick auf die
Verfasstheit des Wirklichen selbst. Indem es sich entzweit, initiiert dieses Wissen einen
Übergang vom epistemischen zum ontologischen Register, der seinerseits erst durch das
Verkennen ermöglicht und vermittelt wird; in einer Weise, die im Folgenden, mit und gegen
Rosset, genauer zu betrachten ist. Die Verunsicherungen des Wissens, wie er sie schildert,
sind erklärtermaßen nicht einer Welt geschuldet, die von Kontingenzen durchdrungen und
insofern ungewiss wäre. Wenn sich das Rosset’sche Reale dem erkennenden Zugriff
entzieht, dann aufgrund seiner bei sich verschlossenen Einfachheit und Singularität, die als
solche nur indirekt zu erschließen sind. Darin liegt dann auch die konstitutive Funktion des
Verkennens: Es ist der notwendige Umweg zur richtigen Erkenntnis, denn erkennen zu
müssen, dass das illusionäre Double der Welt nicht existiert, heißt umgekehrt auch zu
erkennen, dass das Reale existiert.5
Nun lässt sich allerdings einwenden, dass gerade Rossets bevorzugtes Beispiel, die erfüllte
Prophezeiung, eine andere Schlussfolgerung nahelegt, die diesen Perspektivenwechsel
anders justiert. Das Irren und Verkennen wäre dann nicht lediglich die Folge jener
unzureichenden Illusionen, die wir uns von der Realität machen; es stellt umgekehrt die
Konsistenz dieser Realität selbst, ihre ontologische Abgeschlossenheit, zur Disposition.6 In
diesem Sinn ließe sich gegenläufig zu Rossets „principle of sufficient reality“7 das Prinzip
4
Clément Rosset, Das Reale in seiner Einzigartigkeit. Berlin 1995, S. 18.
Ebd., S. 37. – In Anlehnung an die negative Theologie spricht Rosset hier von einer „negativen Ontologie“, der
Überzeugung folgend, „daß ‚man nur durch Blindheit sehen kann, nur durch Nichtwissen erkennen kann und
nur durch Unvernunft verstehen kann’, wie Meister Eckart sinngemäß sagte“ (ebd., S. 38).
6
Vgl. auch Alenka Zupančič, „The Double and Its Relationship to the Real”, in: Markus Klammer u. Stefan
Neuner (Hg.), Die Figur der Zwei. Zürich 2010, S. 94‐99, hier S. 96.
7
Clément Rosset, „Reality and the Untheorizable“, in: Thomas M. Kavanagh (Hg.): The Limits of Theory.
Stanford 1989, S. 76‐118, hier S. 78.
5
3
�einer „insufficient reality“ ins Feld führen – das Prinzip einer Realität, die nicht vollständig
bestimmt ist, die auf der anderen Seite aber auch nicht einfach als kontingent zu
beschreiben ist. Um auf das Beispiel der Titanic zurückzukommen: Bemerkenswert ist, dass
das Schiff, mit all seinen Insignien des Luxus und des Fortschritts, zu einem wirklichen
Populärmythos erst dann wurde, als es untergegangen war. Die symbolische Überfrachtung,
die der Schiffbruch in der Folge erfahren hat, führt eine eigene Analytik des
„katastrophischen Imaginären“8 mit sich: Indem man sich in der Katastrophe wiedererkennt
– sie als Zeichen und Botschaft missversteht –, lässt man sie zum Prisma werden, durch das
die eigene Gegenwart plötzlich anders entziffert und erkannt werden kann. Die Fäden dafür
liegen alle schon bereit, doch erst der unerwartete, völlig kontingente und inkommensurable
Vorfall schafft die Bedingungen, sie zusammenzuführen und auf diese Weise so etwas wie
Notwendigkeit zu erzeugen. 9 Das gesunkene Schiff wird so, qua Verkennung, zum
entscheidenden Knotenpunkt, der das Feld der gegebenen Realität neu strukturiert. Denn
nicht allein die kollektive Wahrnehmung, die Realität selbst scheint ein anderes Gepräge
erhalten zu haben.
Es ist dieser eigentümliche, objektivierende Effekt der Verkennung, dem ich im Folgenden
weiter nachgehen möchte. Dabei geht es vor allem um die spezifische Form von Kausalität,
die hier am Werk ist und die anhand von modernen Konfigurationen des Tragischen bzw. des
‚Schicksals’ erhellt werden soll.10 Es folgt zunächst ein Blick auf Walter Benjamin, der den
Begriff des Schicksals als eine zeitdiagnostische Kategorie der Moderne reformuliert hat.
Diesen Begriff möchte ich anhand von Benjamins Aufsatz über Goethes Die
Wahlverwandtschaften diskutieren, einem Roman, der den „Schiffbruch [...] auf dem festen
Lande“11 in Szene setzt. Gleichermaßen soll auch der Roman selbst herangezogen werden:
Denn während Benjamin das schicksalhafte Verkennen als ein Problem falschen
Bewusstseins auffasst, das er gegen ein selbstbestimmtes Dasein in Freiheit stellt, wird
dieser Dualismus, wie gezeigt werden soll, bei Goethe unterlaufen. Augenfällig an den
8
Horn, Zukunft als Katastrophe, S. 255.
Vgl. Žižek, Liebe Dein Symptom, S. 29f.
10
Schicksal meint dabei zunächst nichts anderes als die Verbindung von Einzelhandlungen zu einem stimmigen
und notwendigen Folgezusammenhang. Eben dies besagt auch die aristotelische Konzeption: Anhand der
Gefügtheit – der „Zusammenfügung der Geschehnisse“ – in der Tragödienhandlung entwirft sie ein Muster
dramatischer Konsistenzbildung, das eine ihr eigene Kausalität und damit Schicksal impliziert. Siehe Aristoteles,
Poetik, übers. und hg. von Manfred Fuhrmann. Stuttgart 2005, S. 25f. Vgl. dazu Anselm Haverkamp, „Medea,
Dea ex Machina. Aristoteles über Euripides“, in: Lore Hühn u. Philipp Schwab (Hg.), Die Philosophie des
Tragischen: Schopenhauer – Schelling – Nietzsche. Berlin 2011, S. 143‐154, hier S. 147f.
11
Johann Wolfgang von Goethe, Die Wahlverwandtschaften, in: Werke. Hamburger Ausgabe [HA], Bd. 6.
München 1982, hier S. 428.
9
4
�Wahlverwandtschaften ist nicht allein der Umstand, dass die Romanfiguren sich in
beständigen Fehleinschätzungen ihrer Realität ergehen, sondern dass ihre Verkennungen
selbst wiederum auf diese Realität zurückwirken. Was der Roman als ‚Schicksal’ in Szene
setzt, wäre dann weniger als ein unverfügbarer Determinismus zu begreifen, denn als ein
kausaler Zusammenhang, dem das subjektive Verkennen gleichsam implementiert ist.
II. Schicksal in der Moderne: Walter Benjamin über Die Wahlverwandtschaften
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gewinnen Spielarten einer Metaphysik des
Tragischen an Boden, die Begriffe wie „Tragik“ und „Schicksal“ für eine konservative bis
reaktionäre Modernekritik dienstbar machen. Diese Apologien eines unverfügbaren, von
höheren Mächten bestimmten Weltlaufs hat Walter Benjamin einer weitreichenden Kritik
unterzogen. Zugleich hat er seinerseits einen spezifischen Bezug zwischen Schicksal und
Moderne hergestellt: Namentlich den Schuldzusammenhang des natürlichen Lebens, seine
Verfallenheit an eine mythische, scheinbar vorgeschichtliche Natur, deren paradigmatische
moderne Instanzen das Recht und der Kapitalismus darstellen.
12
Gegen eine
„geschichtsfremde Metaphysik“ 13 , die das Schicksal zu ihrem raunenden Orakel macht,
wendet Benjamin den Begriff zum Symptom jener „homogenen und leeren Zeit“14, als die er
den Fortschritt – das eigentliche ideologische Substrat der Moderne – charakterisiert.
In Benjamins Analyse von Goethes Wahlverwandtschaften, entstanden zwischen 1919
und 1922, 15 wird der Roman von 1809 zu einer Art Testfall, der die Errungenschaften
moderner Rationalität mit der ihnen immanenten, persistierenden Macht von
schicksalhafter Verstrickung konfrontiert. Für eine solche Betrachtung bietet sich Goethes
Text in der Tat an: Das Geschehen ist im historischen Kontext der Reformprozesse
angesiedelt, die im frühen 19. Jahrhundert den modernen Verwaltungsstaat auf den Weg
bringen, und es exponiert diesen Übergang als krisenhafte Zersetzung aller Ordnungsmuster,
die das individuelle und soziale Leben organisieren. Dabei liegt eine zentrale Provokation des
12
Vgl. Werner Hamacher, „Schuldgeschichte. Benjamins Skizze Kapitalismus als Religion“, in: Dirk Baecker
(Hg.): Kapitalismus als Religion. Berlin 2004, S. 77‐120. – Ich beschränke mich hier auf die Auffassung, die sich
im Kontext von Benjamins Arbeiten der späten 1910er Jahre herausbildet. Zu Benjamins Auseinandersetzung
mit dem Schicksalsbegriff insgesamt vgl. Lorenz Jäger, „Schicksal“, in: Michael Opitz u. Erdmut Wizisla (Hg.):
Benjamins Begriffe, Bd. 2. Frankfurt a.M. 2000, S. 725‐739.
13
Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, in: Gesammelte Schriften [GS], Bd. I.1. Frankfurt a.M.
1991, S. 203‐430, hier S. 291.
14
Walter Benjamin, „Über den Begriff der Geschichte“, in: GS I.2, S. 691‐704, hier S. 704.
15
Vgl. Walter Benjamin, „Goethes Wahlverwandtschaften“, in: GS I.1, S. 123‐201. Der Text wurde 1924/25
erstmals publiziert.
5
�Romans darin, dass er einerseits einen weitgehend handlungsarmen und beinahe
unmotivierten Ablauf schildert, diesen jedoch zugleich mit aller Konsequenz auf den
Untergang zusteuern lässt – ohne dass sich dies auf einsehbare Gründe, etwa auf schwere
Vergehen des Romanpersonals, zurückrechnen ließe.
Der Roman lässt bekanntlich vier Figuren – die Eheleute Charlotte und Eduard, sowie
deren Gäste, den Hauptmann und Charlottes Nichte Ottilie – auf einem adligen Landgut
zusammenkommen; die Neuordnung ihrer amourösen Bindungen, überfällig genug, steht
unmittelbar ins Haus. Eduard und Ottilie sind schnell in wechselseitiger Liebe entflammt,
zwischen Charlotte und dem Hauptmann bahnt sich eine stille, aber innige Zuneigung ihren
Weg. Das berühmte „chemische Gleichnis“, das das Figuren‐Quartett mit chemischen
Elementen analogisiert, stellt diese Verwicklungen in das sterile Licht einer Laborsituation, in
der die unbefragbare, unzweideutige Macht naturgesetzlicher Attraktionen zu regieren
scheint. 16 Doch anstelle der konstant ausgewogenen Verhältnisse, die das Gleichnis
suggeriert, verzeichnet die Bilanz des Romans eine Zerrüttung von tragischen Ausmaßen: Die
unschlüssig verfolgten Pläne der Figuren sind gescheitert und das erhoffte Liebesglück nie
eingetreten; zwei der Protagonisten sowie das in der Zwischenzeit geborene, rätselhafte
Kind Otto sind gestorben; Charlotte und der Hauptmann schließlich, die der Roman
überleben lässt, bleiben am Ende wie „Schatten in der Vorhölle“17 zurück. Zugleich bleibt der
Text es schuldig, diesem katastrophischen Ausgang eine narrative Plausibilität zu geben.
Stattdessen handelt er über weite Strecken von kontingenten und eher belanglosen
Begebenheiten – man kümmert sich um Schloss und Park, empfängt Gäste und führt
zwanglose Gespräche. Dabei lässt man sich von Gewohnheiten ebenso leiten wie von
Zufällen oder den individuellen Launen. Nachdem die beiden Gäste, Ottilie und der
Hauptmann, in das Schloss eingezogen sind, hat man Laune zu umfassenden Umbau‐ und
Modernisierungsarbeiten: Mit Hilfe vor allem des sachkundigen Hauptmanns werden der
Park und seine Seen umgestaltet, ein neues Gebäude wird errichtet sowie die gesamte
ökonomische Einrichtung des Landguts auf den aktuellen frühkapitalistischen Stand
gebracht.18
16
Vgl. Goethe, Die Wahlverwandtschaften, S. 270‐277.
Benjamin, „Goethes Wahlverwandtschaften“, S. 188.
18
Siehe dazu Joseph Vogl, Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen. Zürich/Berlin 2004, S.
289ff.
17
6
�Dass es ein unheilvolles Schicksal ist, das über die Romanwelt regiert, hat kaum jemand
so nachdrücklich herausgestellt wie Benjamin. Sämtliche Vorkommnisse, so Benjamin, alle
Schauplätze und selbst noch einzelne Gegenstände sind von einer „verborgene[n] Macht“19
durchdrungen, die dem Roman von Beginn an seinen untergründigen, unaufhaltsam
katastrophischen Zug einzeichnet. Getragen wird dieser Zug durch ein weitgespanntes Netz
„vorverkündender“20 Momente, das alles Tun der Figuren überschattet und selbst noch ihre
Anstrengungen, das gemeinsam bewohnte Anwesen herzurichten, zu einem implizit
unheilvollen Geschehen werden lässt: „So rückt hier im Maße wie das Haus vollendet wird
das Schicksal nah. Grundsteinlegung, Richtfest und Bewohnung bezeichnen ebenso viele
Stufen des Unterganges.“21 Was immer die Figuren unternehmen, um den Übergang zu einer
neuen und besseren Zukunft herzustellen, wird unter der Hand zu einem weiteren Schritt in
bodenloses Unheil.
Sinnfällig kontrastiert Benjamin den festen Grund, den die Figuren in jeder Hinsicht
verfehlen, mit dem archaischen Element des Wassers, das schließlich ihr Zugrundegehen
herbeiführt.22 Die Verfallenheit an eine mythische Natur, in seinen Augen der Keim des
Schicksals, ist dabei nicht allein den Täuschungen des Romanpersonals geschuldet. Ihnen
korrespondiert eine Durchdringung von Mythos und Rechtsnorm, wie sie hier in der
Institution der Ehe bzw. in deren Verfall zutage tritt. Dass die Ehe zwischen Charlotte und
Eduard dem Verfall überlassen ist, anstatt zur rechten Zeit aufgelöst zu werden, setzt
demnach die mythischen Gewalten frei, die dem Recht per se innewohnen.23 Wenn also der
Roman keinerlei große Taten oder Fehler erkennend lässt, die unmittelbar tödliche
Konsequenzen erwarten ließen, so zeigt sich Benjamin zufolge in genau diesem
Missverhältnis das moderne Gesicht des hier waltenden Schicksals, oder mehr noch seine
abstrakte Gesichtslosigkeit: Das Schicksal lauert in den Fugen der aufgeklärten Rechts‐ und
Sozialstaatlichkeit, die das Leben des Einzelnen unhintergehbar einfasst und konditioniert.
Die Protagonisten des Romans jedoch, versunken in die Schein‐Autonomie ihrer privaten,
19
Benjamin, „Goethes Wahlverwandtschaften", S. 133.
Ebd., S. 135
21
Ebd., S. 139.
22
Über die Umgestaltung der Seenlandschaft im Park heißt es: „Das Wasser als das chaotische Element des
Lebens droht hier nicht in wüsten Wogen, das dem Menschen den Untergang bringt, sondern in der
rätselhaften Stille, die ihn zu Grunde gehen lässt. Die Liebenden [Eduard u. Ottilie] gehen, soweit Schicksal
waltet, zu Grunde. Sie verfallen, wo sie den Segen des festen Grundes verschmähen, dem Unergründlichen, das
im stehenden Gewässer vorweltlich erscheint. Buchstäblich sieht man dessen alte Macht sie beschwören. [...]
In alledem ist es die Natur selbst, die unter Menschenhänden übermenschlich sich regt. [...] Die Menschen
selber müssen die Naturgewalt bekunden. Denn sie sind ihr nirgends entwachsen.“ (Ebd., S. 133)
23
Ebd., S. 130f.
20
7
�hermetischen Welt, lassen sich von diesen Strukturen nur insoweit betreffen, als ihre
jeweiligen Interessen es erfordern. Unter diesen Vorzeichen präsentiert sich das Leben auf
dem Lande zunächst als ein idyllischer Bilderbogen, dessen lockere, episodische Reihung sich
als fortschreitender Untergang erst noch offenbaren muss. Derweil, so der Roman, „scheint
[alles] seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf
dem Spiele steht, noch immer so fortlebt, als wenn von nichts die Rede wäre.“24
Das unmerklich waltende Schicksal tritt spätestens dann hervor, als das Kind Otto bereits
wenige Monate nach seiner Geburt zu Tode kommt. Der kleine Otto – legitimer Sohn der
Eheleute Eduard und Charlotte, der das Pfand auf die Zukunft hätte sein können – ertrinkt,
als Ottilie, seine liebevolle „Pflegerin“25, ihn bei einer Kahnfahrt versehentlich in den See
fallen lässt. Ottos Existenz, die eine von Beginn an verworfene ist, wird derart zum
Brennpunkt des gesamten schicksalhaften Schuldzusammenhangs. Otto wird gezeugt, als die
Eheleute aus Versehen des Nachts aufeinandertreffen und imaginär vor allem mit ihren
jeweiligen Geliebten, mit Ottilie und dem Hauptmann, beschäftigt sind. 26 Das kuriose
Resultat dieser Nacht ist, dass das hier entstandene Kind, seinen leiblichen Eltern zum Trotz,
das Aussehen von deren imaginären Partnern geerbt hat.27 Anstatt sich in die familiäre
Erbfolge einzureihen, treten in Ottos Existenz die symbolische und biologische Reproduktion
des Lebens vor aller Beteiligten Augen auseinander: Das Kind wird zur unmöglichen
Verkörperung einer „Divergenz von physis und nomos“, die zurückverweist auf die
Gebrechlichkeit einer Welt, in der „die Satzung des Rechts und die Setzungskraft des Wortes
gleichermaßen versagen“28.
Nach Benjamins Ansicht ist es der Rückfall in einen Zustand der mythengläubigen
Verblendung, durch den sich die Figuren, blind in ihren Leidenschaften verfangen, zum
willfährigen Handlanger jener morschen Einrichtung machen. So zeigt nicht erst der Tod,
sondern die bloße Existenz des Kindes die schuldhafte Verstrickung an, die das
Romanpersonal längst schon eingegangen ist: Als ein „Geschöpf der Lüge“ ist Otto demnach
24
Goethe, Die Wahlverwandtschaften, S. 331.
Ebd., S. 425.
26
Vgl. ebd., S. 321.
27
Dies schildert der Roman in der Szene, in der die – ihrerseits von Zwischenfällen durchkreuzte – Taufe des
Jungen bevorsteht: „Die Feier des Taufakts sollte würdig, aber beschränkt und kurz sein. [...] Das Gebet war
verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah, erschrak sie
nicht wenig an seinen offenen Augen; denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen [...]. Mittler, der zunächst das
Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Ähnlichkeit, und zwar
mit dem Hauptmann, erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.“ (Ebd., S. 421).
28
Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 299 u. 297.
25
8
�bereits qua Zeugung und Geburt „zum Tode verurteilt“, da „es ganz der Schicksalsordnung
entspricht, wenn das Kind, das neugeboren in sie eintritt, nicht die alte Zerrissenheit
entsühnt, sondern deren Schuld ererbend vergehen muss.“29 In diesem Sinn hat auch das
augenscheinlich harmlose Dahintreiben des Romangeschehens alle Unschuld verloren.
Anstatt ihr Geschick durch „Entschluß und Handlung” selbst in die Hand zu nehmen,
verspielen die Figuren es, wie Benjamin ihnen vorrechnet, durch „Säumen und Feiern”30. All
ihr planloses Tun stellt nicht lediglich ein beständiges Verfehlen und Unterlassen dar,
sondern schuldhaftes Versäumnis. Dass ihre Absichten selbst dann scheitern, wenn sie, wie
Eduards Liebe zu Ottilie, mit aller Leidenschaft angegangen werden, liegt demnach an genau
dieser falschen Alternative von Antriebsarmut und leidenschaftlicher Hingabe. Beiden, so
Benjamin, fehlt das Moment der Entscheidung und der entschlossenen Tat, die über eine
bloße Wahl hinausgehen würden – dies macht das Versäumnis zu einem schuldhaften.31 Und
schicksalhaft ist diese Schuld, weil sie zutiefst zweideutigen Prämissen unterliegt: Denn das
Schicksal bestraft nicht für begangene Untaten, es verurteilt allererst zur Schuld.32 Somit ist
jede Regung, die die Figuren unternehmen, der unauflösbaren Ambivalenz bzw.
„dämonischen Zweideutigkeit“ unterstellt, die Benjamin zufolge die Ordnung des Schicksals
im Kern ausmacht. Das Dämonische stellt „das vage Zeichen einer Unentschiedenheit und
Ungeschiedenheit“ dar, „in der der Mensch sich seiner Freiheit – der Freiheit, die allein in
der Entscheidung liegt – noch nicht versichert hat“ 33 und sich stattdessen einer
heteronomen, mythischen Gewalt überantwortet.
Benjamin liefert hier die Konzeption einer genuin modernen Form des Schicksals. Anders
als in der antiken Tragödie, die den tragischen Konflikt an einen vorausliegenden Mythos
bindet und seine Folgen als unausweichliches Verhängnis auftreten lässt, tritt diese
29
Benjamin, „Goethes Wahlverwandtschaften“, S. 138. – Die Möglichkeit einer Entsühnung und damit der
Auflösung des Banns hat Benjamin dem tragischen Schicksal, im Unterschied zum mythischen, vorbehalten.
Entsprechend besitzt Goethes Roman für ihn einen entschieden untragischen Charakter (vgl. ebd., S. 177). Dass
Benjamin diese Einschätzung daran bindet, wie der Roman ausgeht, ist dem hegelianischen Erbe seiner
Auffassung des Tragischen geschuldet. Als tragisch kann der Untergang des Helden nur dann gelten, wenn
dieser zuvor den Teufelskreis seiner Verstrickung zu durchbrechen vermag, was zwar ihn selbst nicht mehr
retten wird, wohl aber seine Nachwelt. Vgl. dazu Eva Geulen, Das Ende der Kunst. Lesarten eines Gerüchts nach
Hegel. Frankfurt a.M. 2002, S. 94ff.
30
Benjamin, „Goethes Wahlverwandtschaften“, S. 139.
31
Vgl. ebd., S. 189. – Benjamins strikte Entgegensetzung von Entscheidung und bloßer Wahl hat Spekulationen
über eine strukturelle Nähe zum Schmitt’schen Dezisionismus provoziert. Zur Kritik dieses Arguments vgl.
Christoph Menke, Recht und Gewalt. Berlin 2011, S. 63f.
32
Schicksal, so Benjamin, „zeigt sich [...] in der Betrachtung eines Lebens als eines Verurteilten, im Grunde als
eines, das erst verurteilt und darauf schuldig wurde.“ Benjamin, „Schicksal und Charakter“, in: GS II.1, S. 171‐
179, hier S. 175.
33
Hamacher, „Schuldgeschichte. Benjamins Skizze Kapitalismus als Religion“, S. 94.
9
�Rückbindung in der Neuzeit bzw. Moderne zurück, um den Konflikt als einen geschichtlichen
auszuweisen – als einen sowohl historisch bestimmten, als auch seinerseits den Stand des
Historischen bestimmenden. Wie Benjamin zeigt, heißt das nicht, dass ‚Geschichte’ jene
mythische Gewalt überwunden hätte – sie lässt sie zurückkehren als „zweite Natur“: als eine
Verselbständigung etwa der politisch‐rechtlichen Sphäre, deren Gewalt darin besteht, „als –
wie das – Schicksal zu wirken“.34 Das Schicksal im modernen Sinn markiert demnach jene
Wendung, durch die das Normative selbst von naturhafter Gewalt, und seine praktische
Notwendigkeit vom Kontingenten ununterscheidbar wird. Was sich in diesem Horizont als
Fortschritt ausgibt, ist nichts als die „ewige Wiederkunft alles Gleichen“ 35 , die bloße
Aufrecht‐ bzw. Selbsterhaltung des Bestehenden um seiner selbst willen.
Fraglich aber ist, ob die intrikate Verstrickungslogik, als deren Chiffre das Schicksal
firmiert, damit erschöpfend beschrieben ist. Mit Benjamin lässt sich eine prägnante
Aktualisierung dieser Chiffre gewinnen, die sie an die abstrakte Gegebenheit von quasi‐
naturhaften, für sich selbst blinden Gesetzen rückbindet. Zugleich aber fußt sie auf einem
Dualismus von Mythos und Freiheit, der möglicherweise zu kategorisch ausfällt. Benjamin
schildert einen in sich geschlossenen Kreislauf der Wiederholung, der der subjektiven
Erfahrung vorausliegt und sie mit Ohnmacht und passiver Verfallenheit schlägt – letztlich
also die Totalität einer Immanenz, die als entfremdete Substanz des Sozialen über die
Innerlichkeit von Menschen verfügt, die selbst wiederum erst im letzten Moment ihres
marionettenhaften Daseins gewahr werden. 36 So verstanden, meint Schicksal eine zwar
diesseitige, aber abstrakte Gewalt, die wesentlich negativ und exkludierend auf das
menschliche Leben bezogen ist. In Goethes Roman jedoch wird, gegenläufig zu diesem
Szenario von Privation, Mangel und Verfall, eine andere Kräftekonstellation ablesbar, die
zudem ein Licht darauf wirft, inwiefern die Figuren selbst in die Konstitution der
schicksalhaften Ordnung investieren. Das wirklich Fatale in den Wahlverwandtschaften, so
wäre zu zeigen, besteht weniger in der schlechten Unendlichkeit einer nicht überwundenen
Naturverfallenheit; vielmehr besitzt das notorische Verkennen, wie der Roman es vorführt,
eine positive ontologische Dimension. Anstatt an den realen Gegebenheiten einfach vorbei
34
Menke, Recht und Gewalt, S. 52 (Hervorhebung im Text, A.H.).
Benjamin, „Goethes Wahlverwandtschaften“, S. 137.
36
Vgl. in diesem Sinne auch Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente. Frankfurt a.M. 1996, S. 18: „Das Prinzip der Immanenz, der Erklärung jeden Geschehens als
Wiederholung, das die Aufklärung wider die mythische Einbildungskraft vertritt, ist das des Mythos selber [...];
die Sanktion des Schicksals, das durch Vergeltung unablässig wiederherstellt, was je schon war.“
35
10
�zu zielen, werden die Verfehlungen der Figuren als – freilich unabsehbare – Intervention in
die materielle Realität wirksam. Sie zeitigen manifeste und irreversible Effekte, so dass die
Weise, in der sich die Figuren erkennend und verkennend auf ihre Außenwelt beziehen,
dieser selbst nicht äußerlich sein kann.
Damit stellt sich auch die Zurechenbarkeit von Schuld weit weniger eindeutig dar, als
Benjamin es nahelegt. Zwar lässt der Roman eine ganze Parade an individuellen
Missgeschicken und Versäumnissen aufziehen, die in der Gesamtschau allesamt ihren
Beitrag zur Bahnung des Unheils leisten. Doch keines davon kann als entscheidender Fehler
gelten – auch nicht die „Nachlässigkeit“37 Ottilies, die den Tod des Kindes zur Folge hat –, so
dass Scheitern und Schuld, überhaupt die entscheidenden Etappen des Ablaufs, keineswegs
klar zu lokalisieren sind. Das aber heißt nicht, dass die Figuren alle Handlungsmacht an das
Performativ eines anonymen ‚Waltens’ abgetreten hätten. Eher zeichnet sich ab, dass der
Text jeglichen Dualismus von selbstbestimmten Vermögen und fremdbestimmenden Kräften
konsequent untergräbt. Tragisches Unheil, so ließe sich sagen, findet allemal statt, doch es
handelt sich um eine Katastrophe im Aufschub, die umwegig und retardierend verläuft, und
dabei um Übergänge, die sich ihrerseits in der Schwebe von Hemmung und Potenzierung des
Geschehens halten.
III. Positivität des Verkennens
Benjamins Analyse ist darin überzeugend, dass sie das dämonische Walten aus dem
Geflecht der krisenhaften gesellschaftlichen – sozialen, normativen, institutionellen –
Beziehungen hervorgehen sieht, in denen die Romanwelt mehr oder minder sichtbar
eingebettet ist. In der Immanenz dieser Welt befangen zu sein, heißt gleichwohl nicht, sich
einer übermächtigen, letztlich prädeterminierenden Gewalt ausgeliefert zu sehen, die sich
der subjektiven Sphäre von außen bemächtigen würde. Während Benjamins Schicksal den
Subjekten als renaturalisierte, „vollendete Faktizität der historischen Dinge“38 entgegentritt,
scheint Goethe es gerade auf eine wesentliche Unbestimmtheit abgesehen zu haben, die
dieser Faktizität innewohnt: Auf eine ontologisch inkonsistente Textur des Wirklichen, die
37
So die Bezeichnung von W. Menninghaus, der darauf hinweist, dass „in der Gesamtökonomie des Werkes“
auch diese Fehlleistung notwendig dämonischen Charakter annimmt. Demnach wird Ottilie ohne Wissen und
Absicht zur Agentin des Schicksals, sie ist „nur die Erfüllungsgehilfin, nicht aber der Grund“ für die abschüssige
Bahn der Entwicklung. Vgl. Winfried Menninghaus, Schwellenkunde. Walter Benjamins Passage des Mythos.
Frankfurt a.M. 1986, S. 84.
38
Walter Benjamin, „‚Es mayor monstruo, los celos’ von Calderon und ‚Herodes und Mariamne’ von Hebbel.
Bemerkungen zum Problem des historischen Dramas“, in: GS II.1, S. 246‐276, hier S. 269.
11
�Schicksal dort produziert, wo sie mit dem seinerseits inkonsistenten Wissen der Figuren eine
gleichsam kurzschlüssige Verbindung eingeht. Kausalität ist dabei keineswegs außer Kraft
gesetzt, doch es tritt ein anderes, supplementierendes Moment hinzu, das in die bruchlose
Verknüpfung der Ursachen und Wirkungen interveniert.
Die dämonische Zweideutigkeit, die Benjamin als die Signatur des Schicksals ausweist,
ließe sich in diese Richtung umdeuten. Sie wäre dann der Index einer Ordnung des Seins, in
der der Abstand zwischen ‚faktischer’ und ‚erkannter’ Wirklichkeit zu einer Frage der inneren
Beschaffenheit dieser Wirklichkeit selbst wird. Subjektives Erkennen und objektive
Außenwelt treten hier in eine Binnenrelation, die in die materiellen Phänomene selbst, als
erkannten und im selben Zug verkannten, eingesenkt ist. In einer so verstandenen
Immanenz gibt es zwar kein Jenseits der Phänomene, allerdings auch keine Wirklichkeit, die
mit sich selbst identisch wäre und so der Gegenstand einer im klassischen Sinn
wahrheitsfähigen Erkenntnis werden könnte.39 Dass die Welt stets nur bedingt erkennbar ist
– also notwendig Verkennungen entstehen lässt –, ist daher nicht allein den begrenzten
menschlichen Kapazitäten geschuldet. Sie ist das strikte Korrelat einer in sich ‚löchrigen’
Konfiguration, die das unabsehbare Enthaltensein des eigenen Selbst in der erfahrenen
Wirklichkeit anzeigt. Was Goethes Roman verhandelt, wäre in dieser Hinsicht die alltägliche
oder auch dramatische Tatsache, dass in jedem „Gezählten ein Zählendes schon da ist“40, als
eine Form der Selbstimplikation, die hier als schicksalhafte Verstrickung ausbuchstabiert
wird.
Augenfällig im Roman ist zunächst der Zerfall der tradierten sozialen Rituale, wie
Grundsteinlegung und Richtfest des neuen Gebäudes und die Taufe des Jungen, die der
Reihe nach spektakulär misslingen und so die fundamentale Zersetzung anzeigen, die die
rechtlichen und die symbolischen Institutionen erfasst hat.41 Gleichermaßen jedoch sind es
die unscheinbaren Bagatellen des häuslichen Alltags, in die der Text den Schauplatz seiner
katastrophischen Entwicklung verlegt. In dem Maße, wie die heimische Welt aus den Fugen
39
Es handelt sich um die Struktur einer säkularisierten Immanenz oder auch der „immanenten Transzendenz“.
Vgl. Eric L. Santner, Zur Psychotheologie des Alltagslebens. Betrachtungen zu Freud und Rosenzweig.
Zürich/Berlin 2010, S. 19: „Der ‚Tod Gottes’ ist zu einem Gutteil genau dies: der Tod dieses Anderswo, dieses
‚Jenseits’ des Lebens, das irgendwie ‚höher’ oder wirklicher wäre als dieses Leben. Was sowohl Freud als auch
Rosenzweig zu begreifen helfen, ist, dass mit dem ‚Tod Gottes’ die ganze Problematik der Transzendenz
tatsächlich viel stärker auf das Alltagsleben einwirkt. Was mehr als Leben ist, entpuppt sich aus der post‐
nietzscheanischen Perspektive als immanent im und konstitutiv für das Leben selbst.“
40
Jacques Lacan, Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse: Das Seminar Buch XI. Olten, Freiburg 1978, S. 42.
41
Vgl. dazu David Wellbery, „‚Die Wahlverwandtschaften’“, in: Paul Michael Lützeler u. James E. McLeod (Hg.):
Goethes Erzählwerk. Interpretationen. Stuttgart 1991, S. 291‐319.
12
�gerät, nimmt sie für die Figuren zeichenhaften und dabei „ahnungsvollen“42 Charakter an,
der den Weltbezug eigenen Tuns undurchsichtig werden lässt. Insbesondere der
abergläubische Eduard zeichnet sich dadurch aus, das eigene Handlungsvermögen beständig
an eine höhere, alle Kontingenz absorbierende Fügung zu delegieren – die freilich das hier
waltende Schicksal gerade nicht ist. An einem gläsernen Trinkbecher etwa, der sich seit
langen Jahren unbeachtet im Haushalt befindet, wird Eduard plötzlich sehend für die
eingravierten Buchstaben „E“ und „O“: In seinen Augen ein unmissverständliches Orakel, das
seine Liebe zu Ottilie mit übersinnlicher Providenz ausstattet. Doch es handelt sich um die
Initialen seines eigenen Namens, die den selbstgewählten Rufnamen, Eduard, und seinen
Taufnamen zusammenführen; letzterer wiederum ist, wie bei allen Protagonisten des
Romans, Otto.43
Die eklatante Willkür indessen, die an Eduards Zeichengläubigkeit besonders
hervorstechen mag, unterscheidet sich ihrer Struktur und ihren Effekten nach kaum von den
Sprechakten der anderen Figuren – sei es, dass diese ihrerseits zum Aberglauben neigen,44
oder – schlimmer – dass es in der Bilanz keinen Unterschied macht, ob Vernunft oder
Irrglauben das eigene Reden und Tun beherrscht. Das Erschreckende dabei ist weniger, dass
die Signifikanz der Begebenheiten sich in vollendeter Beliebigkeit verlieren würde, sondern
die Weise, in der sie sich unter der Hand zu wirksamen Verkettungen reorganisiert. Nicht die
Frage, inwieweit die einzelnen Sprechakte die Wahrheit verfehlen oder letztlich doch einen
wahren Kern enthielten, ist hier ausschlaggebend, sondern dass sie qua Verkennung zum
Konstituens des Wahren werden, dass sie also im buchstäblichen Sinn wahr‐machen.45
Wenn den Figuren ihre Handlungsmacht entgleitet, dann in diesem Sinne: Ihr beständiges
Irren und Fehlgehen wird zur immanenten und unkontrollierbaren Bedingung dessen, was in
der Realität objektiven Niederschlag finden, d. h. ein folgerichtiges und sogar notwendiges
Gepräge annehmen wird. Insofern ist es auch weniger ein zunehmender Verfall des
42
Vgl. Goethe, Die Wahlverwandtschaften, u.a. S. 464, S. 466.
Auch der Hauptmann heißt mit Vornamen Otto, bei den Frauennamen wurde der Wortstamm jeweils
abgewandelt. Eduard hatte in seiner Jugend entschieden, dass ihm „der Name Eduard besser gefiel, wie er
denn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat.“ (Ebd., S. 259).
44
Auf ihre Weise folgt auch die besonnene Charlotte einer ausgeprägten Neigung, bereits in einer „seltsamen
Zufälligkeit eine Fügung des Himmels“ zu erkennen (ebd., S. 358).
45
In einem spezifischen Sinn ist das so instantiierte Wahre fiktional strukturiert; vgl. Alenka Zupančič, Ethics of
the Real. Kant, Lacan. London/New York 2000, S. 64f.: „[T]ruth is to be situated on the level of articulation of
the signifiers as such, and not on the level of the relationship between signifiers (‘words’) and things as simply
exterior to them. It is precisely this ‘lack of externality’, the nonexistence of a limit, which accounts for the fact
that the truth has […] the structure of a fiction, and that it is ‘not‐whole’ (pas‐toute). Yet this fictional character
of the truth in no way implies that the truth is arbitrary.”
43
13
�Symbolischen, ein „Verlust der efficacité symbolique“ 46, der die Romanwelt verhext, als eine
Form der Effizienz, die dem symbolischen Gesetz noch vor aller Einfassung in konkrete
Gebräuche und Rituale eignet. Die Signifikanten, die dieses Feld strukturieren, mögen ihrer
bestimmten Bedeutungen ledig sein, sie sind indessen völlig intakt in ihrer Funktion der
Adressierung, d. h. in ihrem Appellcharakter für diejenigen, die im derangierten Netzwerk
der „socialen Verhältnisse“47 interagieren. Produktiv – und riskant – ist diese Sphäre darin,
dass sie Anrufungsprozesse erzeugt, d. h. einen „Mehrwert von Anrede über Bedeutung“48,
der das Personal in nachgerade universale fetischistische Verkennungsschleifen versetzt. Für
diese Struktur ihrer Welt sind die Beteiligten notwendig blind, die Welt aber ist es nicht für
sie: Sie wird zu einer Art Registratur jener strukturell unbewussten Übermittlungsprozesse,
die im impersonalen Raum der psychosozialen Beziehungen, einem Murmeln oder Gerücht
ähnlich, zirkulieren.
Sinnfällig wird dies in dem Moment, als die Figuren mit dem Tod des Kindes konfrontiert
werden. Ottos Tod wird zunächst als „Unfall“49 deklariert, doch schon kurz darauf stellt sich
die Lage signifikant anders dar. Wie auf geheime Absprache kommen die Figuren darin
überein, dass der Tod des Kindes als gemeinschaftsstiftendes „Opfer“50 zu begreifen sei, das
ihre zerklüfteten Verhältnisse versöhnen soll. Dieser Blickwechsel ist mindestens erstaunlich.
Nicht nur lässt er – Ottilie und vielleicht noch Charlotte ausgenommen – ein gebührendes
Maß an Trauer vermissen; er enthält überdies das kollektive Bekenntnis zu einer Tat, die als
solche nicht begangen wurde. Und natürlich liegt in der Annahme, dass durch Ottos Opfer
eine neue und bessere Zukunft zu erwarten sei, eine weitere gravierende Fehleinschätzung –
denn der unerbittliche Lauf der Dinge hat, forciert durch diese neuerliche Verkennung,
gerade erst Fahrt aufgenommen.51
Unfall‐ und Opferdiskurs treten dabei in eine eigenwillige Konkurrenz. Zwar verfehlen
beide, die archaische Rede vom Opfer ebenso wie das abstrakte Risikokalkül des modernen
46
Wellbery, „‚Die Wahlverwandtschaften’“, S. 293.
Die „Idee“ der Wahlverwandtschaften, so Goethe im Gespräch mit F. W. Riemer am 28. August 1808, sei es,
„sociale Verhältnisse und die Conflicte derselben symbolisch gefaßt darzustellen.“ Vgl. dazu Wolf Kittler,
„Goethes Wahlverwandtschaften: ‚Sociale Verhältnisse symbolisch dargestellt’“, in: Norbert W. Bolz (Hg):
Goethes ‚Wahlverwandtschaften’. Kritische Modelle und Diskursanalysen zum Mythos Literatur. Hildesheim
1981, S. 230‐259.
48
Santner, Zur Psychotheologie des Alltagslebens, S. 51.
49
Goethe, Die Wahlverwandtschaften, S. 459, S. 469.
50
Ebd., S. 461.
51
Er „ruhte“, so der Text über den aufgebahrten Leichnam des Kindes, „als das erste Opfer eines ahnungsvollen
Verhängnisses“ (ebd., S. 464).
47
14
�Unfalldiskurses, den „ungeheuer[en]“ 52 Fall, den sie bezeichnen sollen. Diese doppelte
Verfehlung aber eröffnet genau den zweideutigen Raum, in dem er sich als Ereignis
konstituiert. Denn wenngleich der Roman keinerlei Absichten erkennen lässt, die das
Unglück herbeigeführt hätten, so erscheint sein Eintreten und mit ihm die gesamte
Vorgeschichte rückwirkend in einem anderen, zutiefst dämonischen Licht. Das Ertrinken des
Jungen wurde von den Protagonisten weder geplant noch vorausgesehen, geschweige
eigenhändig ausgeführt, zugleich aber trifft es sie auch nicht ganz unvorbereitet. Vielmehr
kommen die Figuren kaum umhin, sich selbst in dem Vorfall wiederzuerkennen, insofern
dieser – wie zuvor bereits das bloße Aussehen des Kindes – an sie als kollektiv Involvierte zu
appellieren scheint. Tatsächlich bündeln sich hier, in Ottos Tod, wie in einer dioptrischen
Anamorphose zahlreiche Fäden, die sich scheinbar willkürlich über den ganzen Roman
verstreuen. So ist von „Opfern“ und vom „Aufopfern“ erstaunlich häufig die Rede; u. a. in
dem Dialog zwischen Eduard und Charlotte über den ruinösen Stand ihrer Ehe: Charlotte,
kaum dass sie dem Hauptmann „rein und völlig“ entsagt hat, möchte sogleich auch ihrem
Mann „irgend eine Aufopferung“ abverlangen – zur Rettung der Ehe und für „das Beste
sämtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels“ –, während Eduard sich dagegen empört, dass
ausgerechnet „Ottilie aufgeopfert“, d. h. weggeschickt werden soll.53 Aus diesem Gespräch
folgen weder Entscheidungen, noch überhaupt direkt ableitbare Konsequenzen. Doch wenn
einerseits das Geschehen zunächst weiterhin seinen ruhigen Gang geht, so erhalten
unscheinbare, idyllische Szenen wie die folgende einen eigentümlichen Unterton. Eduard
und der Hauptmann haben das Weite gesucht, die beiden Frauen sind mit dem Kind allein:
Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem
tüchtigen Knaben, dessen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Gemüt stündlich
beschäftigt. [...] Von einem eigenen Gefühl belebt steigt sie zur Mooshütte mit
Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen
häuslichen Altar niederlegt, und noch zwei Plätze [der abgereisten Männer] frei
sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten und eine neue Hoffnung für sie und Ottilie
54
dringt hervor.
In der Fluchtlinie dessen steht die spätere Identifikation mit dem tödlichen Vorfall, der
sämtliche Figuren auf ein bislang ungewusstes, allmählich zutage tretendes Vorwissen
zurückzustoßen scheint. Diese Situation inszeniert der Text als eine Zäsur, die an die
52
Ebd., S. 459.
Ebd., S. 340f.
54
Ebd., S. 427.
53
15
�Koinzidenz von Überraschung und notwendiger Einsicht in der antiken Tragödie gemahnt.55
So kann selbst der Hauptmann, der zuvor alle Mühen auf die Unfallvorsorge verwendet
hatte, plötzlich als komplizenhafter „Mitwisser“56 erscheinen, so als habe seine Vorsorge
nicht der Verhinderung, sondern dem Eintreten des Unfalls – oder Opfers – Vorschub
geleistet. Bis zu dieser Zäsur figurierte der Hauptmann im Roman als die mustergültige
Instanz eines modernen Sicherheits‐ und Präventionsdenkens. Als an früherer Stelle des
Textes, noch bevor Otto existierte, ein unbekannter Junge im schlosseigenen See zu
ertrinken drohte, hatte er ihn mutig gerettet und sogleich alle Vorkehrungen getroffen, um
der Gefahr des Ertrinkens künftig vorzubeugen. Dass der kleine Otto später ausgerechnet
diesen Tod sterben wird, dessen Risiko der Hauptmann im Sinne des Gemeinwohls zu
minimieren suchte, löst nun auch bei ihm weniger Resignation als Zuversicht aus, artikuliert
in Begriffen von Recht und Eigentum:
Ein solches Opfer schien ihm nötig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien
mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersatz für das, was sie
Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoße, der mit mehrerem
57
Recht sein Ebenbild trüge als der abgeschiedene.
Eduard wiederum war bereits jenem ersten Vorfall mit aggressivem Narzissmus begegnet.
Er hatte, seinerzeit ohne erkennbaren Zusammenhang, den totgeglaubten Jungen kurzum
zum Befreiungsschlag, zur Verheißung seines Liebesglücks mit Ottilie erklärt. 58 Ihren
eigentlich fatalen Klang erhalten diese Worte jedoch erst im Nachhinein, bei der
Wiederholung des Vorfalls, der nun dasjenige Kind trifft, dessen Vater Eduard in der
Zwischenzeit geworden ist. So jedenfalls will es der Fortgang der Geschichte: „Er wußte
bereits von dem Unglück“59 , heißt es im Text doppelsinnig, als Eduard über Ottos Tod
informiert wird. Allerdings konnte Eduard zu jenem früheren Zeitpunkt noch nicht wissen,
was seine Worte bereits mitleidslos aussprachen, und was jetzt, als das Unglück tatsächlich
tödlich endet, zur providenziell verbürgten Gewissheit zu werden scheint: „[A]nstatt das
arme Geschöpf zu bedauern“, sieht er „diesen Fall“ nicht mehr nur als ein Hoffnungszeichen,
55
Letztere, so Haverkamp, bewirkt „nichts anderes [...], als dem im Anfang still beschlossenen, von allen
vorgewussten Schicksal die innewohnende Zwangsläufigkeit eines in dieser Form unerwarteten Endes
einzuzeichnen.“ Haverkamp, „Medea, Dea ex Machina“, S. 147.
56
Goethe, Die Wahlverwandtschaften, S. 460.
57
Ebd., S. 461.
58
Vgl. ebd., S. 338: „’Nein, Ottilie!’, rief er, ‚das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem
Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die Meine! Ich
habe dirs schon so oft gesagt und geschworen […], nun soll es werden.’“
59
Ebd.
16
�sondern als vollbrachte „Fügung an, wodurch jedes Hindernis an seinem Glück auf einmal
beseitigt wäre.“60
Es ist nicht diese beharrliche Anrufung einer höheren Fügung, die dem Roman das
dämonische Gepräge verleiht, sondern umgekehrt der Charakter einer blinden
Prophezeiung, der sich in den Sprechakten der Figuren stets schon mit‐spricht. Wenn nun
die Figuren zuvor nicht nur nichts Verdächtiges getan haben, sondern nicht einmal ein
positives Wissen vom lauernden Unheil hatten, so geraten sie gerade dadurch in das
Zwielicht eines „halbschuldigen“61 Verbrechens: Indem sie Belangloses sprechen, tun oder
auch nur denken, geben sie einer Zweideutigkeit Raum, die das beiläufigste Gerede in einen
potenziellen Fluch und noch das besonnenste Wort in eine komplizenhaft vor‐wissende
Schuld umschlagen lässt. „Das Schicksal gewährt uns unsere Wünsche, aber auf seine
Weise“62, so der Roman. Es liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass diese „Weise“ des
Schicksals, d.h. die Logik der Verstrickung, die Goethes Roman darstellt, zugleich auch die
Weise der Darstellung selbst bestimmt. Nicht nur lässt der Text keinerlei Außenstandpunkt
zu, von dem aus sich zuverlässig über die Motivierung des Geschehens, über Zufall und
Notwendigkeit, Handeln und Unterlassung oder Schuld und Unschuld urteilen ließe. Bei
einem Handlungsverlauf, der im Einzelnen unabsehbar ist, im Ganzen hingegen zwingend
verlaufen sein wird, bleibt auch der Status der Vermittlungen und Übergänge prinzipiell
mehrdeutig. Sie sind als Übergänge zunächst nicht einmal identifizierbar, weil sie erst
rückwirkend – dann, wenn sie Wirkung tun – überhaupt zu solchen werden. In diesem Sinn
erscheinen sie unter‐ und überdeterminiert gleichermaßen: Sie halten gewissermaßen den
Raum frei, in dem das unabsehbare und zugleich einschneidende Ereignis stattfinden kann.
Im Nachhinein wird man es erwartet haben.
60
Ebd.
Goethe, „Nachlese zu Aristoteles’ Poetik“, in: HA 12, S. 342–345, hier S. 344.
62
Goethe, Die Wahlverwandtschaften, S. 428.
61
17
�
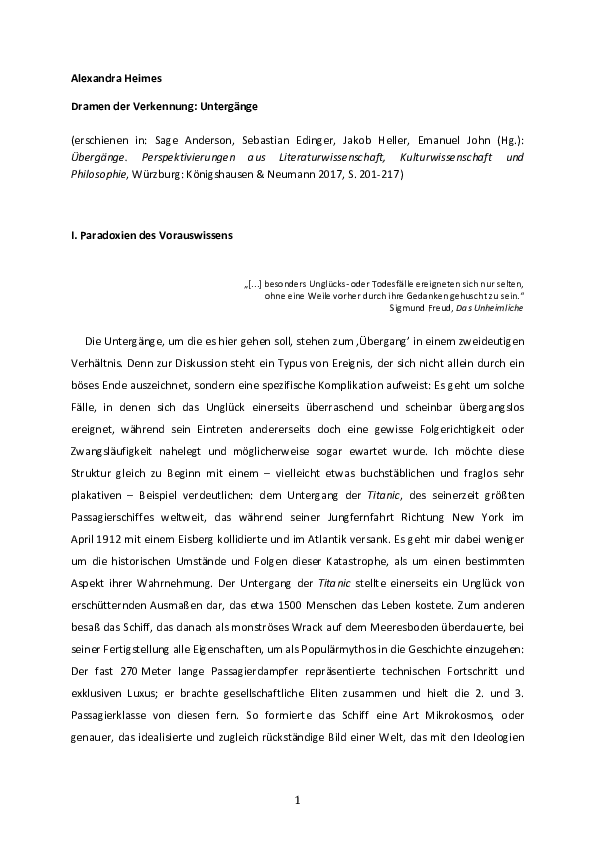
 Alexandra Heimes
Alexandra Heimes