Joscha Wullweber
Das Subjekt und das Andere
Identität und Differenz in poststrukturalistischen
Theorien
„Emanzipation ist immer die Emanzipation der Anderen.“ (Habermann 2008,
S. 284)
1 Einleitung
Poststrukturalistische Theorien haben einige entscheidende Schritte in der
Theoretisierung der Konzepte Identität und Differenz unternommen und
damit auch produktiv in die seit langem geführte Debatte um das Verhältnis
von Struktur und Subjekt interveniert. Der Begriff der Differenz findet hier
weder im kritischen Sinne noch als normative Forderung Verwendung,
sondern beschreibt als Logik der Differenz zusammen mit der Logik der Äquivalenz grundsätzlich die Art und Weise, wie Bedeutung und Identität hergestellt werden. Identität ist nichts Gegebenes oder gesellschaftlich Vorgängiges. Vielmehr wird in gesellschaftlichen Prozessen um die Generierung und
Veränderung von Identitäten gerungen. Politik bzw. das Politische reduziert
sich hierbei nicht auf einen bestimmten Bereich von Gesellschaft, sondern
wird als konstitutiv für jede soziale Identität und Handlung und damit für
die Strukturierung der Gesellschaft insgesamt verstanden. Politik beinhaltet
demnach auch Auseinandersetzungen um Formen hegemonialer Stabilisierungen gesellschaftlicher Identität.
In dem Disput um das Verhältnis von Struktur und Subjekt bekräftigt die
eine Seite die Struktur, im Sinne einer (partiellen) Determinierung des Subjekts (z. B. im strukturellen Marxismus und in systemtheoretischen Ansätzen), und die andere Seite die Autonomie des Subjekts gegenüber der Struktur (z. B. in der Spieltheorie oder in Rational-Choice-Ansätzen). Letztere
sehen das Individuum gegenüber der Gesellschaft als vorrangig, indem es als
Träger natürlicher Rechte bzw. als Nützlichkeitsmaximierer und rationales
Subjekt konzipiert wird. Poststrukturalistische Theorien vermeiden den
127
�Rekurs auf solche Essenzialismen. Sie betonen, dass es weder eine Objektivität im Sinne einer alles determinierenden Struktur gibt, noch ein absolutes
Subjekt, das an und für sich existent und mit einer bestimmten ahistorischen,
der Struktur vorgängigen Identität ausgestattet wäre. Denn trotz der Unterschiede sind sich Objektivismus und Subjektivismus in einer Hinsicht sehr
ähnlich: „‚Objectivism‘ and ‚subjectivism‘; ‚holism‘ and ‚individualism‘ are
symmetrical expressions of the desire for a fullness that is permanently deferred“ (Laclau/Mouffe 1985, S. 121, Herv. i. O.).
Ausgehend von der Frage, wie poststrukturalistische Theorien das Subjekt konzeptualisieren, beginnt der Beitrag mit der Diskussion des methodologischen Individualismus, wie er insbesondere dem Rational-Choice-Ansatz
zugrunde liegt, und zeigt dessen verengte Sichtweise auf gesellschaftliche
Akteure auf. Auch werden deterministische Sichtweisen kritisiert. Basierend
auf der poststrukturalistischen Hegemonietheorie von Ernesto Laclau und
Chantal Mouffe wird anschließend ein poststrukturalistischer Ansatz entwickelt. Hier fungiert der Diskursbegriff als gesellschaftlicher Strukturbegriff
und beschreibt ein differenzielles System, in dem Bedeutungen und Identitäten in Relation bzw. in Differenz zueinander entstehen. Dieses System ist
nicht abgeschlossen, sondern von diversen, sich beständig verändernden Antagonismen durchzogen. Das Andere, im Sinne einer ontologischen Figur,
die das Subjekt zugleich ermöglicht und untergräbt, nimmt hier eine zentrale
Stellung ein.
2 Methodologischer Individualismus
In Teilen der Politikwissenschaft dominiert ein Verständnis von politischer
Identität, das sich am methodologischen Individualismus und am Bild des
homo oeconomicus orientiert. Das Identitätskonzept des Akteurs beruht
hierbei auf bestimmten Grundannahmen hinsichtlich Individualität, Rationalität, Hierarchie von Präferenzen und Eigennutz. Das Bild des homo oeconomicus enthistorisiert und essenzialisiert das Subjekt, indem davon ausgegangen wird, dass Menschen immer schon als Nutzenmaximierer handeln,
unabhängig vom sozialen, politischen und kulturellen Kontext. Der Ausgangspunkt des dieses Identitätskonzept am deutlichsten vertretenden Rational-Choice-Ansatzes ist daher der einzelne Akteur und dessen interessengeleitetes Handeln:
„[T]o explain social institutions and social change is to show how they arise as the
result of the action and interaction of individuals“ (Elster 1989, S. 13). Nach Popper beinhaltet ein methodologischer Individualismus „to construct and analyse our
sociological models carefully in descriptive or nominalist terms, that is to say, in
128
�terms of individuals, of their attitudes, expectations, relations, etc.“ (Popper 1957,
S. 135, Herv. i. O.).
Politische Ereignisse werden über das Verhalten, die Erwartungen und die
Interaktion einzelner Akteure erklärt: „[T]he elementary unit of social life is
the individual human action“ (ebd.). Maßgeblich sind individuelle Entscheidungen, von denen auf makropolitische und makroökonomische Phänomene geschlossen wird (vgl. Blaug 1980, S. 45 f.). Im Zentrum der Analyse
steht daher das Individuum bzw. der Akteur und nicht die gesellschaftliche
Struktur. Es ist ein dezidiert stilisierter und deduktiver Ansatz, der axiomatische, also theoretisch nicht weiter begründbare und auch nicht aus der Empirie induktiv herleitbare Setzungen macht und aus diesen Setzungen anschließend bestimmte Thesen über menschliche Verhaltensweisen ableitet.
Die stärkste axiomatische Annahme beinhaltet eine bestimmte „Psychologie
des Menschen“ (Dür 2012, S. 74). Diese impliziert, dass Akteure zweckrational handeln: Sie agieren stets so, als ob sie eine Kosten-Nutzen-Analyse aller
möglichen (bekannten) Entscheidungsmöglichkeiten vorgenommen hätten.
Die Entscheidungsmöglichkeiten werden anschließend mit hierarchisierten
(transitiven und über einen gewissen Zeitraum stabilen) Präferenzen abgeglichen. Schließlich wird stets diejenige Entscheidung getroffen, die in der
Rangliste an oberster Stelle steht (Nutzenmaximierung). Die Präferenzen
wiederum unterliegen den jeweiligen constraints (z. B. den Fähigkeiten der
Akteure oder dem limitierten Budget des Konsumenten) und beliefs (kausalen Überzeugungen).
Die theoretischen Wurzeln des Rational-Choice-Ansatzes gehen auf die
Klassische Politische Ökonomie und die neoklassische Ökonomik zurück
(vgl. Friedman 1953; Mueller 2004). Adam Smith, der als einer der Urväter
der Klassischen Ökonomie angesehen wird, leitet das menschliche Handeln
– vereinfacht wiedergegeben – aus dem Egoismus des Menschen ab (Smith
1974/1776, S. 17). John Stuart Mill entwickelte daraus den methodologischen
Individualismus:
„The laws of the phenomena of society are, and can be, nothing but the laws of the
actions and passions of human being united together in the social state […]. Men
are not, when brought together, converted into another kind of substance, with
different properties […]. Human beings in society have no properties but those
which are derived from, and may be resolved into, the laws of nature of individual
man“ (Mill 1970/1843, S. 573).
Tatsächlich ist die Prämisse der Nutzenmaximierung, aber nicht die der Eigennützigkeit, eine conditio sine qua non des Rational-Choice-Ansatzes (vgl.
auch Marx 2010, S. 47).
129
�Aus Sicht des Rational-Choice-Ansatzes können „soziale Phänomene am
besten aus der Perspektive der einzelnen handelnden Akteure erklärt werden“ (Dür 2012, S. 75). Margaret Thatchers bekannter Ausspruch auf dem
Kongress der Konservativen Partei im Jahr 1987 bringt es auf den Punkt:
There is no such thing as society. Das Ganze (die Gesellschaft) ist hier, pace
Aristoteles, nicht mehr als die schlichte Summe seiner Teile (der Individuen
bzw. Akteure): „[S]ocial groups are nothing over and above the individuals
who are their members“ (Gilbert 1989, S. 428). Vom einzelnen Akteur ausgehend und konzeptionell auf das Individuum ausgerichtet ist die Gesellschaft als theoretisches Konzept eine Blackbox.1 Innerhalb der neoklassischen Theorie wird die Gesellschaft bzw. der Markt als aus Individuen
bestehend konzeptualisiert, deren Handlungen durch die unsichtbare Hand
des Marktes Angebot und Nachfrage über Preisvermittlungen ins Gleichgewicht bringen und so insgesamt zu einem allgemeinen gesellschaftlichen
Nutzen führen. Im Rational-Choice-Ansatz wird allerdings die Vorstellung
eines Marktgleichgewichts zugunsten des utilitaristischen Optimierungsprinzips aufgegeben (vgl. Carlson/Dacey 2013, S. 91 f.).
Zusammengefasst löst der Rational-Choice-Ansatz die Identität des Akteurs aus ihren historisch gewachsenen gesellschaftlichen Relationen heraus.
Übrig bleibt das isolierte, politisch, sozial und kulturell dekontextualisierte
und stilisierte Individuum. Vom gesellschaftlich sozialisierten Individuum
bleibt im Rational-Choice-Ansatz als einziges Handlungsmotiv nur noch ein
Handeln, das auf Nutzenmaximierung aus ist.2 Einzig die Präferenzen, die
dem Akteur zugeschrieben werden, sind gewissermaßen als Schatten der gesellschaftlichen Sozialisation noch vorhanden. Zeit als kontingente und die
gesellschaftlichen Relationen verändernde Größe wird außen vor gelassen.
Die Historizität des Individuums wird also auf eine vermeintlich ahistorische
Natur des Menschen reduziert.
3 Determinismus
Strukturalistische wie poststrukturalistische Theorien betonen gegenüber der
subjektzentrierten Sichtweise des methodologischen Individualismus, dass die
1
2
Paradoxerweise ist auch das Individuum eine Blackbox: Hinsichtlich der Grundlage
der Rationalität des Akteurs wird auf dessen Psychologie verwiesen, die wiederum als
konstant (rational) gesetzt und auf diese Weise theoretisch ausgeklammert werden
kann (vgl. Dür 2012; Mueller 2003, S. 79 ff.; Dietrich/List 2013).
Daraus resultiert auch die Bedeutung der Entscheidungs- und Nutzentheorie für den
Rational-Choice-Ansatz (vgl. Carlson/Dacey 2013, S. 91 f., 103; von Neumann/Morgenstern 1953).
130
�Identität der Akteure eng mit der gesellschaftlichen Struktur verflochten ist.
Akteure sind in Strukturen eingebunden, formen diese und werden durch
diese geformt. Demzufolge kann nicht von einem autonomen und gesellschaftlich entbetteten Akteur ausgegangen werden, der aufgrund von ahistorischen
Eigenschaften handelt. Vielmehr werden soziale Phänomene relational analysiert. Diese Theorien gehen davon aus, dass gesellschaftliche Strukturen über
ihre Beziehungen – über ihr Verhältnis zueinander – analysiert werden können
und sollten. Die Beschäftigung mit und die Untersuchung von gesellschaftlichen Strukturen ist zentral für den Erkenntnisprozess. Obwohl auch hier die
Reduktion von gesellschaftlicher Komplexität als notwendig angesehen wird,
um überhaupt allgemeine theoretische Aussagen treffen zu können, wird eine
zu starke Komplexitätsreduktion kritisch gesehen.
Aus poststrukturalistischer Sicht schießen strukturalistische Ansätze jedoch bei ihrer Kritik an subjektivistischen Theorien über ihr Ziel hinaus, indem sie das Verhältnis von Subjekt und Struktur umkehren: Dem kritisierten
Fehlen sozialer Strukturen wird eine tendenziell allumfassende gesellschaftliche Struktur gegenübergestellt. Handlung ist demzufolge – je nach Ansatz
in unterschiedlichem Maße – vorbestimmt durch die Funktionsweise der
Struktur. Akteure können meinen, sie hätten Entscheidungsfreiheit, letztlich
agieren sie aber als Funktionsträger eines größeren Systems. Die Weltsystemtheorie, insbesondere in ihrer ursprünglichen Version von Immanuel
Wallerstein (1974), ist ein Beispiel für eine stark deterministisch ausgerichtete Theorie. Die stärkste Form des Determinismus findet sich allerdings, auf
den ersten Blick vielleicht überraschend, bei dem Rational-Choice-Ansatz.
Denn hier wird davon ausgegangen, dass zu jedem Zeitpunkt eine optimale
Wahl zwischen verschiedenen Optionen möglich ist. Zugleich wird das Subjekt als zweckrational agierend konzeptualisiert, das bestmöglich informiert
ist und sich folglich stets für eben diese optimale Wahl entscheidet. Die Persönlichkeit des Akteurs und damit die Kontingenz und Unvorhersehbarkeit
subjektiven Handelns kann durch diesen geschickten theoretischen Schachzug ausgeklammert werden. Denn die Möglichkeit, irrational zu handeln und
sich für eine nicht optimale Option zu entscheiden, steht dem Akteur nicht
offen. Der Akteur trifft per definitionem stets die (für ihn oder sie) beste Wahl
und ceteris paribus zu unterschiedlichen Zeiten die gleiche Entscheidung
(vgl. Dunleavy 1991, S. 3 f.). Der Rational-Choice-Ansatz beinhaltet daher
die Annahme, dass die Entscheidung für eine bestimmte Option nicht vom
Akteur, sondern vom Kontext bzw. den vorhandenen Optionen und definierten Präferenzen abhängt.3 Der Handlungsrahmen bestimmt vollständig
3
Nun bleibt aber genau dieser Kontext im Rational-Choice-Ansatz theoretisch unterbelichtet (vgl. Durnová 2012, S. 317 ff.). Die politischen, sozialen und ökonomischen
131
�das Handeln des Akteurs, aus dem kausal-mechanistische Erklärungsmuster
abgeleitet werden (Tsebelis 1990, S. 40; MacDonald 2003). Es existiert keine
Entscheidungsmöglichkeit, geschweige denn Entscheidungsfreiheit, gleichwohl der Begriff der rationalen Entscheidung bzw. rationalen Wahl das
Gegenteil suggeriert. Der Akteur hat schlicht keine Wahl (Hay 2004, S. 40).
Es ist dieser extreme und im Vergleich zu anderen politischen Ansätzen einzigartige Determinismus, der die Unbestimmtheit und Unvorhersehbarkeit
individuellen Handelns ausklammert und der es dadurch ermöglicht, gesellschaftliche Akteure in einer quasi-naturwissenschaftlichen Herangehensweise als eine statische Komponente zu konzeptualisieren (ausführlich Wullweber 2014).
Aus dem strukturalistischen Bias bestimmter Theorien folgt eine Tendenz
zum Funktionalismus. Eine Funktion zu haben bedeutet, dass etwas zur Erfüllung bestimmter Aufgaben existiert. Funktionalistisch ist eine Herangehensweise, die die Anwesenheit von spezifischen sozialen Systemen aus der Notwendigkeit ihrer Existenz zur Übernahme bestimmter gesellschaftlicher
Aufgaben erklärt (und damit funktional ableitet). So wird in einer frühen
Schrift des Staatstheoretikers Nicos Poulantzas argumentiert, dass dem Staat
die Funktion sozialer Kohäsion einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft zukomme. Er habe die Funktion, „Kohäsionsfaktor der verschiedenen Ebenen einer Gesellschaftsformation zu sein“ (Poulantzas 1975, S. 43). Wenngleich beim
Funktionalismus – wie beim Poststrukturalismus – von einem relationalen sozialen Gefüge ausgegangen wird, sind die Relationen der Funktion untergeordnet, sie sind zweckbestimmt. Diese teleologische Herangehensweise führt gewissermaßen durch die Hintertür die Vorstellung ein, dass der sozialen
Strukturierung von Gesellschaft eine Zweckgerichtetheit inhärent wäre, die
dem Handeln der Subjekte vorgängig und folglich ahistorisch ist (vgl. Laclau
2005, S. 68). Damit gerät aus dem Blick, dass gesellschaftliche Institutionen
selbst das kontingente Produkt historischer Auseinandersetzungen sind.
4 Die konstitutive Differenz: Diskursive antagonistische
Strukturierungsprozesse
Poststrukturalistische Theorien geben die rigide Gegenüberstellung von
Struktur und Akteur auf. Identität wird hier über Differenzen konzeptualisiert, die Entstehung von Identität ist nicht ohne ein differenzielles System
Konditionen, die zur Bildung bestimmter Präferenzen führen und unter denen Entscheidungen getroffen werden bzw. die das Treffen von Entscheidungen überhaupt
erst notwendig machen, werden nicht analysiert.
132
�denkbar. Diese beidseitige Durchdringung und Beeinflussung von Struktur
und Subjekt wird im Diskursbegriff ausgedrückt. Diskurs und gesellschaftliche Struktur werden nicht als zwei getrennte analytische Sphären angesehen,
sondern entsprechen sich. Hierbei handelt es sich nicht einfach um die Feststellung, dass Diskurse Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse hätten, also die
gesellschaftliche Struktur mitgestalten würden. Poststrukturalistische Ansätze sehen das Diskursive grundlegender: Demnach gibt es nichts Sinnhaftes, nichts Bedeutungsvolles, keine Identität außerhalb des differenziellen
Feldes (der Diskurse). Das Konzept des Diskurses fungiert als soziale Strukturkategorie (Wullweber 2012, S. 39 ff.).
Auch wenn Gesellschaft und das diskursive Feld sich entsprechen, wirkt
das Feld des Diskursiven nicht determinierend auf die Bedeutungskonstruktionen und das Handlungsfeld der Akteure ein. Stattdessen werden die Kontingenz von Strukturen wie auch die Auseinandersetzungen um die Strukturierung von Strukturen betont. Mit Kontingenz ist hier nicht Zufall oder
Beliebigkeit gemeint.4 Das Konzept der Kontingenz ist vielmehr zwischen
Zufall (verstanden als die komplette Abwesenheit von Struktur) und Notwendigkeit (verstanden als komplette Strukturierung) angesiedelt. Es handelt
sich um eine strukturierte Unsicherheit oder, anders formuliert, um eine fehlgeschlagene Strukturierung. Mit dem Konzept der Kontingenz wird zum einen die Anwesenheit einer sozialen Struktur im Sinne einer Verstetigung von
Handlungen und einer Verfestigung von Bedeutungen anerkannt und zum
anderen betont, dass die vollständige Strukturierung fehlschlägt, weil sie vom
Zufall unterlaufen wird. Da die Struktur, im Gegensatz zu den Annahmen
des Rational-Choice-Ansatzes, nicht die Entscheidung vorgibt, bedarf es der
Subjekte, die Entscheidungen treffen müssen und die auf diese Weise die soziale Struktur produzieren, reproduzieren und transformieren. Eine bestimmte Diskursformation muss demnach kontinuierlich von einer Vielzahl
von Subjekten reartikuliert werden, um Bestand zu haben – sie reproduziert
und verselbstständigt sich nicht hinter dem Rücken der Akteure. Eine gesellschaftliche Struktur beinhaltet demnach eine spezifisch verfestigte und infolgedessen über einen gewissen Zeithorizont und innerhalb eines bestimmten
sozio-politischen Raums stabilisierte soziale Verfasstheit und Strukturiertheit.
Eine fundamentale Voraussetzung zur Ermöglichung und Stabilisierung
einer gesellschaftlichen Struktur bzw. eines differenziellen Wahrheits- und
Handlungshorizonts ist die zumindest partielle und temporäre Stabilisierung
der Grenzen dieses Systems: „The very possibility of the system is the
4
Siehe zur Herleitung des Begriffs in Abgrenzung zum aristotelischen Begriff des Zufalls Laclau 1990a, S. 18 ff.
133
�possibility of its limits“ (Laclau 1996a, S. 37). Ohne eine solche Stabilisierung
können keine Bedeutungselemente innerhalb des Systems auf bestimmte Positionen fixiert und damit auch keine Bedeutungen und Identitäten hergestellt werden. Diese scheinbare, da letztlich unmögliche Schließung von Diskursen ist eine essenzielle Voraussetzung für die Konstitution des Sozialen.
Der Begriff des Antagonismus dient als theoretisches Konzept zur Erklärung
dieser Grenze und damit der Entstehung des sozialen Feldes. Der entscheidende Punkt ist, dass die Grenze eines Diskurses nicht eine weitere Differenz
sein kann, da eine Differenz innerhalb eines differenziellen Systems integriert
werden könnte. Die Grenze eines Diskurses muss folglich ein Jenseits des Diskurses darstellen. Das radikale Außen – der Eindruck eines radikalen Außens
– kann nur entstehen, indem bestimmte Elemente als außerhalb des Diskurses liegend, als etwas radikal Differentes artikuliert werden. Wird eine solche
Artikulationskette hegemonial, setzt sich innerhalb einer bestimmten Diskursformation der Eindruck durch, diese Elemente würden tatsächlich außerhalb des Diskurses liegen (Laclau 2005, S. 69 f.). Das Einzige, das die durch
hegemoniale Artikulationen ausgeschlossenen Elemente gemein haben, ist
die (vermeintliche) Negation des Diskurses, aus dem sie ausgeschlossen wurden. Diese Ausschließung führt zu einer Stabilisierung des Diskurses. Es handelt sich um das Andere, das die Gemeinschaft der Gleichgesinnten ermöglicht: „Now, if the systematicity of the system is a direct result of the
exclusionary limit, it is only that exclusion that grounds the system as such“
(Laclau 1996a, S. 38). Ein Außen, ein Jenseits eines differenziellen Systems ist
allerdings nicht möglich, weil das Feld des Diskursiven, qua Definition, alle
Differenzen enthält. Dementsprechend ist das radikale Außen kein Jenseits,
sondern eher ein Inseits, ein Innen des Sozialen, wobei die Innen-Außen-Unterscheidung letztlich von metaphorischer Natur ist: „The limit of the social
must be given within the social itself as something subverting it, destroying
its ambition to constitute a full presence“ (Laclau/Mouffe 1985, S. 127; Marchart 1998, S. 102). Die radikale, daher ontologische Negativität des Antagonismus ist konstitutiv für ein differenzielles System. Konsequent zu Ende gedacht bedeutet das, dass eine Gesellschaft keinen Zustand erreichen kann, in
dem alle Antagonismen aufgehoben wären (vgl. Mouffe 2007, S. 17 ff.). Antagonismen müssen existieren, um als radikale Differenz die Schaffung von
Identität zu ermöglichen. Diese notwendige und nicht überwindbare WirSie-Unterscheidung muss sich aber nicht als eine Dichotomie zwischen
Freund und Feind ausdrücken. Eine Freund-Feind-Unterscheidung ist eine
und vor allem rechtspopulistisch leicht evozierbare Ausdrucksform der antagonistischen Dimension zur Herstellung von kollektiver Identität. Das Andere kann aber ebenso, wie Derrida betont, als Gegensatz konzeptualisiert
werden, der herausfordert und bereichert (Derrida 2000; 2006).
134
�Aus der theoretischen Annahme der konstitutiven Dimension des Antagonismus folgt nun die paradoxe Situation, dass das, was die Grenzen und
damit die grundlegende Ermöglichung des Diskurses darstellt, zugleich die
letztendliche Unmöglichkeit eines stabilen Diskurses begründet, da die differenzielle Ordnung permanent durch die radikale Negativität infrage gestellt
wird (vgl. Laclau/Mouffe 1985, S. 126). Sowohl einzelne Diskurse als auch
eine hegemoniale Formation einer Vielzahl von Diskursen und damit die
Identitäten einer Gesellschaft insgesamt konstituieren sich über den Versuch, Bedeutung zu fixieren und die Subversion der Antagonismen zu unterdrücken. Dementsprechend sind die Grenzen eines Diskurses nicht neutral,
sondern hegemonial produziert. Hieraus folgt, das Politische in der Analyse
der Konstitution jeder Art von Bedeutung, Identität, Grenzziehung etc. zu
betonen.
Letztlich ist in poststrukturalistischen Theorien die Gesellschaft (wie auch
ein einzelner Diskurs) nicht als geschlossenes und stabiles System denkbar.
5 Identität als Differenz: Das Subjekt als Leerstelle
des Anderen
Einem geschlossenen und ahistorischen Identitätskonzept, wie es beispielsweise mit dem Bild des homo oeconomicus dargestellt wird, setzen Deleuze
und Guattari die Annahme einer Zerstreuung, einer differenziellen Spaltung
des Subjekts entgehen: „Wir haben den Anti-Ödipus zu zweit geschrieben.
Da jeder von uns mehrere war, ergab das schon eine ganze Menge.“ (Deleuze/Guattari 1992, S. 12, Herv. i. O.) Der frühe Foucault entwickelte den Begriff der Subjektpositionen, um zu betonen, dass Subjekte nicht auf eine
Identität innerhalb eines Diskurses reduziert werden können, sondern sich
aus unterschiedlichen Positionen innerhalb von verschiedenen Diskursen
zusammensetzen. Allerdings wird hierdurch einem strukturellen Determinismus nur scheinbar ausgewichen. Denn selbst wenn sich das Subjekt in verschiedene Subjektpositionen spaltet bzw. ausdifferenziert und damit auf die
Anrufungen verschiedener Diskurse reagiert, veräußert es sich letztlich in
diesen Diskursen. Dem Subjekt wird kein Raum außerhalb dieser Strukturen
eingeräumt.5 Auch der Hinweis, dass es sich um diskursive Strukturen handelt, löst dieses Dilemma nicht. Denn selbst wenn der Begriff der Struktur
durch den des Diskurses ersetzt wird, bleibt der determinierende Charakter
5
Später entwickelt Foucault das Konzept der Gouvernementalität und gibt dadurch
den Entscheidungen der Subjekte – über die theoretische Figur der Selbsttechnologien
– mehr Raum.
135
�erhalten. Die Diskurse determinieren in letzter Instanz das Handeln der Subjekte – das Subjekt erschöpft sich vollständig in der diskursiven Struktur, ist
nichts weiter als ein Moment derselben (vgl. Žižek 1990, S. 250 f.).
Laclau und Mouffe greifen die Idee der Subjektpositionen auf, um sie zu
radikalisieren, indem sie (und insbesondere Laclau) auf Lacans Psychoanalyse und dessen Konzept des Subjekts als Mangel zurückgreifen. Mit dem
Strukturalismus verbindet sie die Ablehnung eines autonomen Subjekts. Der
entscheidende Punkt ist aber, dass sie die Idee der Zerstreuung beibehalten,
diese allerdings nicht auf das Subjekt, sondern auf die Struktur anwenden. In
diesem Sinne ist das Subjekt der Struktur inhärent, die Struktur selbst ist allerdings aufgrund der Unmöglichkeit ihrer kompletten Schließung nicht in
der Lage, das Subjekt vollständig zu determinieren. Das Subjekt existiert also
nicht etwa, weil es eine essenzielle, vor- oder extradiskursive Substanz besäße,
sondern weil die Struktur selbst darin scheitert, sich zu schließen, ihr eigener
Grund zu sein. Das Subjekt ist demnach weder wirklich außerhalb noch wirklich innerhalb der Struktur: „The subject is nothing but this distance between
the undecidable structure and the decision“ (Laclau 1990b, S. 30). Es ist also
nicht die fehlende, sondern die unabgeschlossene Struktur, die das Subjekt
ermöglicht.
Derrida (1991) spricht in diesem Zusammenhang von der Unentschiedenheit der sozialen Struktur.6 Oben wurde der Begriff der Kontingenz eingeführt und dargelegt, dass eine Struktur permanenten Dislokationen unterworfen ist. Beide Theoreme kondensieren im Begriff der Unentschiedenheit.
Genauso, wie der Begriff der Kontingenz nicht beinhaltet, dass alles völlig
willkürlich wäre, ist mit dem Terminus der Unentschiedenheit keine chaotische Gesellschaft gemeint. Vielmehr betont er eine permanente und doch begrenzte Offenheit der Struktur:
„Das Unentscheidbare ist nicht einfach das Schwanken oder die Spannung zwischen zwei Entscheidungen, es ist die Erfahrung dessen, was dem Berechenbaren, der Regel nicht zugeordnet werden kann […]. Eine Entscheidung, die sich nicht
der Prüfung des Unentscheidbaren unterziehen würde, wäre keine freie Entscheidung, sie wäre eine programmierbare Anwendung oder ein berechenbares Vorgehen“ (Derrida 1991, S. 49 f.).
6
Im deutschen Sprachraum wurde indécise statt mit unentschieden mit unentscheidbar
übersetzt (wie auch im oben folgenden Zitat). Letzterer Ausdruck ist jedoch missverständlich, da er suggeriert, es könne in diesem spezifischen Moment keine Entscheidung getroffen werden. Gemeint ist jedoch vielmehr, dass die Struktur keine Entscheidung vorgibt und die Situation daher unentschieden ist.
136
�Die Struktur ist aus sich heraus nicht in der Lage, eine algorithmische Schließung im Sinne einer genau definierten Handlungsvorschrift zur Bewältigung
der Grenzziehung zu vollziehen. Genau in dieser Unabgeschlossenheit bzw.
Unentschiedenheit offenbart sich die Lücke – die Dislokation – in der Struktur. Die Entscheidung zur Schließung dieser Lücke kann nicht in der Struktur
selbst begründet sein. Die Unmöglichkeit der Struktur zur vollständigen
Schließung ist genau die Möglichkeitsbedingung für die Entstehung des Subjekts. Die Entscheidung wird dem Subjekt durch die Unentschiedenheit der
Struktur gleichsam aufgezwungen:
„Der Augenblick der Entscheidung […] ist der Sprung von der Erfahrung der Unentscheidbarkeit zu einem kreativen Akt, eine Forderung, die ihre Passage durch
diese Erfahrung benötigt. […] Dieser Augenblick der Entscheidung bleibt sich
selbst überlassen und ist nicht in der Lage, seine Gründe durch irgendein System
von Regeln, die ihn transzendieren, aufzuweisen; dieser Augenblick ist der Augenblick des Subjekts“ (Laclau 1999, S. 127; vgl. Wullweber 2010, S. 76 ff.).
Der Zwang zur Entscheidung in einer (objektiv) nicht entscheidbaren Situation hat demnach nichts mit der emphatischen Feststellung einer Freiheit der
Entscheidung zu tun. Vielmehr ist der „Augenblick der Entscheidung […],
wie Kierkegaard schreibt, ein Wahn“ (Derrida 1991, S. 54). Subjekte haben
weniger die Freiheit der Entscheidung, sondern sind zum Treffen von Entscheidungen gezwungen. Das Subjekt hat folglich den Status eines Supplements – eines Anhangs bzw. einer Ergänzung – der Struktur. Da es aber gerade nicht von der Struktur determiniert wird, ist es gewissermaßen
selbstbestimmt. Es kann sich nur auf seine eigene Singularität gründen. Mit
dieser Konzeptualisierung des Subjekts kommen Laclau und Mouffe Lacans
Subjektbegriff sehr nah, der das Subjekt als leeren Platz in der Struktur, als
‚Diskontinuität im Realen‘ sieht. Den Prozess der Subjektivierung versteht
Lacan als den Versuch des Subjekts, die unentschiedenen Situationen durch
die Identifikation mit bestimmten Inhalten (Subjektpositionen) zu lösen und
die ihm inhärente Leere zu füllen. Damit verbunden ist die Hoffnung, in dem
bestehenden Bedeutungsuniversum aufzugehen: „Wenn es ein Bedürfnis
nach Identifikation gibt, dann liegt dies in erster Linie daran, daß es keine
Identität gibt“ (Laclau 1999, S. 130). Da die Struktur disloziert ist, sind die
Subjektpositionen ebenfalls zerstreut und eine Integration des Subjekts in das
Bedeutungsuniversum ist zum Scheitern verurteilt: „The history of the subject is the history of his/her identifications and there is no concealed identity
to be rescued beyond the latter“ (Mouffe 1992, S. 371).
Das Subjekt ist nach Lacan insofern der Subjektivierung vorgängig, als
dass der Akt der Identifikation nicht bereits durch die Subjektpositionen vorbestimmt ist (vgl. Torfing 1991, S. 58 ff.). Auch Laclau trennt das Subjekt
137
�analytisch von den Subjektpositionen, die es einnimmt (vgl. Laclau 1999,
S. 132 ff.). Das Subjekt besitzt keine der Struktur vorgängigen Eigenschaften,
ist also nicht Trägerin einer ihr bereits inhärenten Identität: „In other words,
the subject is correlative to its own limit, to the element which cannot be subjectified, it is the name of the void which cannot be filled out with subjectivation: the subject is the point of failure of subjectivation“ (Žižek 1990, S. 254).
Letztlich besitzt das Subjekt keine ihm eigene Positivität und der widersprüchliche und krisenhafte Prozess der Subjektivierung – des Subjektwerdens – kann nur partiell beruhigt werden, indem das Subjekt seine ihm eigene
Krise auf das radikale Außen projiziert. Das Subjekt konstituiert sich folglich
in Abgrenzung zum Anderen. Ebenso wie der Antagonismus den Diskurs stabilisiert, stabilisiert das Andere das Subjekt. Und ebenso wie beim Antagonismus beinhaltet das Andere auch die permanente Subversion einer stabilen
Identität des Subjekts. Antagonismus und das Andere sind daher zwei verschiedene Begriffe für ein und dieselbe theoretisch-ontologische Figur bzw.
Logik (vgl. Laclau/Mouffe 1985, S. 125): Der Antagonismus/das Andere ermöglicht die Konstruktion von Strukturen und Identitäten und verhindert
zugleich deren Vollendung – der Antagonismus/das Andere unterläuft und
bestätigt zugleich die Identität des Subjekts. Das Subjekt ist als Kreuzungspunkt zwischen diesen Äquivalenz- und Differenzketten konstitutiv gespalten (vgl. Laclau 1996b, S. 52 f.). Das Andere ist also nicht Grund der Krise,
sondern vielmehr bereits der Versuch einer Bearbeitung der Krise, die dem
Anderen vorgängig ist:
„This is the moment called by Hegel ‚the loss of the loss‘: the experience that we
never had what we were supposed to have lost. We can also determine this experience of the ‚loss of the loss‘ as the experience of the ‚negation of the negation‘,
i.e. of pure antagonism where the negation is brought to the point of self-reference“ (Žižek 1990, S. 252, Herv. i. O.).
Die Situation der Unentschiedenheit ist eine strukturierte Unentschiedenheit. Völlige Unentschiedenheit würde bedeuten, dass jede Entscheidung getroffen werden könnte, einfach aus dem Grund, weil es sich um eine Entscheidung handelt. Das wiederum würde die komplette Abwesenheit von
Struktur bedeuten und das Subjekt bekäme einen omnipotenten Status. Doch
ein solcher Status ist innerhalb poststrukturalistischer Theorien nicht denkbar:
„While Lacan certainly presents the unconscious as that which interrupts the normal flow of events, he never makes an agency of the unconscious; it remains a
discourse divorced from consciousness and subjective involvement – the Other’s
discourse“ (Fink 1995, S. 42).
138
�Eine Entscheidung wird innerhalb eines bestimmten Kontextes getroffen
und kann von diesem nicht getrennt werden. Kontexte schränken daher sowohl die strukturelle Unentschiedenheit als auch die zu einem historischen
Zeitpunkt möglichen Inhalte ein: „Die eigene Persönlichkeit ist auf bizarre
Weise zusammengesetzt: es finden sich in ihr Elemente des Höhlenmenschen
und Prinzipien aller vergangenen, lokal bornierten geschichtlichen Phasen.
[Sie ist ein] Produkt des bislang abgelaufenen Geschichtsprozesses, der in einem selbst eine Unendlichkeit von Spuren hinterlassen hat, übernommen
ohne Inventarvorbehalt“ (Gramsci 1991, S. 1376). Das Handeln des Subjekts
beinhaltet also einerseits den Moment der Entscheidung und ist andererseits
in historisch sedimentierten Praktiken und Subjektivierungen eingebettet,
die das normative Gerüst der Handlungsoptionen für den Moment der Entscheidung liefern. Der oben erwähnte Ansatz von Kierkegaard kann insofern
modifiziert werden, als dass der „Wahnsinn der Entscheidung […] wie jeder
Wahnsinn ein regulierter“ ist (Laclau 1999, S. 133). Gleichzeitig muss zwischen dem aktuellen Inhalt der Entscheidung (dem ontischen Inhalt) und der
ontologischen Funktion des Treffens von Entscheidungen unterschieden
werden:
„Identification presupposes the constitutive split of all social identity, between the
content which provides the surface of inscription and the function of identification
as such – the latter being independent of any content and linked to the former only
in a contingent way“ (Laclau/Zac 1994, S. 35, Herv. i. O.).
Der ontische Inhalt kann hierbei nicht aus der ontologischen Funktion abgeleitet werden. Es ist nicht die abwesende strukturelle Identität, sondern die
fehlgeschlagene strukturelle Identität, die das Subjekt ermöglicht.
6 Hegemonie und das Primat des Politischen
Die Voraussetzung für die Möglichkeit der Entstehung von Identität ist die
Existenz eines diskursiven Felds. Wenn auch festgestellt wurde, dass Subjektivierungsprozesse niemals abgeschlossen sind und sich Identitäten beständig verändern, so gibt es doch partielle und temporäre Stabilisierungen. Wäre
alles zufällig, ohne dass es irgendeine Form temporär stabilisierter Subjektivierung gäbe, wäre keine Gesellschaft möglich – eine chaotische Welt. Wären
umgekehrt alle Handlungen notwendig und determiniert, gäbe es keine Freiheitsgrade mehr für das handelnde Subjekt – die gesellschaftliche Entwicklung wäre vorbestimmt. Wenn die Stabilisierung von Identitäten weder zufällig noch determiniert ist, folgt hieraus aus poststrukturalistischer Sicht,
dass Subjektivierung ein politischer Prozess ist. Um die politische Logik der
139
�partiellen und temporären Strukturierungen und Subjektivierungen zu fassen und zugleich der Kontingenz gesellschaftlicher Entwicklungen theoretisch gerecht zu werden, greifen Laclau und Mouffe auf das Hegemoniekonzept von Gramsci zurück: „‚Hegemonie‘ [ist] das Schlüsselkonzept, um
Politik zu denken“ (Laclau 1998, S. 277). Zugleich ist der Begriff der Hegemonie mehr als eine nützliche Kategorie: „[I]t defines the very terrain in
which a political relation is actually constituted“ (Laclau 2000, S. 44). Hegemoniale Praxis beinhaltet die (partielle und temporäre) Fixierung und Generierung von Bedeutungen und Identitäten.
Dislokationen durchlöchern und verschieben unablässig die Grenzen innerhalb des sozialen Raums. Doch nicht nur die Struktur reißt permanent
auf, sondern auch die der Struktur inhärenten Subjekte sind disloziert. Das
Ringen um Hegemonie beinhaltet daher keine Auseinandersetzungen zwischen Akteuren mit fixierten Interessen und Identitäten. Vielmehr verändern sich die Interessen und Identitäten der Subjekte durch die hegemoniale
Praxis: „[T]he hegemonic act will not be the realization of a rationality preceding it, but an act of radical construction“ (Laclau 1990b, S. 29, Herv. i. O.).
Hegemoniale Artikulation umfasst eine Konstruktion im doppelten Sinne:
Sowohl die politischen Projekte, im Sinne der Gestaltung und Reorganisation
von Gesellschaft, als auch die politischen Akteure sind Ausdruck und Quelle
radikaler Konstruktion.
Die Hegemonie eines gesellschaftlichen Projektes bedeutet, dass die darin
enthaltenen Wertvorstellungen und Identitätskonzepte durch Äquivalenzketten zu anderen gesellschaftlichen Bereichen universalisiert und als Allgemeininteresse der Gesellschaft postuliert werden: „Hegemony emphasizes
the ways in which power operates to form our everyday understanding of
social relations, and to orchestrate the ways in which we consent to (and reproduce) those tacit and covert relations of power“ (Butler 2000, S. 14). Hegemoniale Praxis wirkt stabilisierend auf den Diskurs, der zugleich unablässig durch Dislokationen destabilisiert wird. Hegemonie und Dislokation
verhalten sich demnach komplementär zueinander, indem die eine Seite versucht, die Entscheidbarkeit (im Sinne einer Vorhersehbarkeit) einer Situation herzustellen, während die andere Seite diese ständig unterläuft. Eine Hegemonietheorie ist daher auch „a theory of the decision taken in an
undecidable terrain“ (Laclau 1996c, S. 90) und hegemoniales Handeln führt
von dem unstrukturierten und chaotischen Feld des Diskursiven zum strukturierten Bereich des Diskurses. Mit der Logik des Politischen soll ausgedrückt werden, dass prinzipiell alle gesellschaftlichen Beziehungen und Identitäten verhandelbar bzw. Resultat gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse
sind. Die politische Dimension ist demnach konstitutiv für jede gesellschaftliche Beziehung und Identität. Das Politische ist hierbei weder auf einen bestimmten gesellschaftlichen Bereich reduzierbar noch durch eine andere
140
�Logik (z. B. eine ökonomische oder kulturelle) determiniert. Alle sozialen Beziehungen haben eine politische Dimension.
7 Resümee
Mit der provokanten Feststellung, dass es keine Identität gibt, ist nicht gemeint, dass Identitäten und Subjekte keine Bedeutung in poststrukturalistischen Theorien hätten. Im Gegenteil sind diese Konzepte im poststrukturalistischen Denken zentral. Allerdings wird betont, dass Identität als solche
keinen positiven oder natürlichen Inhalt hat. Identität kann sich nicht aus
sich heraus entwickeln und es gibt keine wahre Identität, nach der es zu streben gelte. Vielmehr entsteht Identität nur in einem politischen Prozess über
die Differenz zum Anderen. Zugleich ist der Prozess des Subjektwerdens niemals abgeschlossen, die Subjektivierungsprozesse scheitern immer wieder
und sind deswegen im permanenten Wandel begriffen. Identität ist im Sinne
eines Horizonts beständig im Kommen, ohne dass der Prozess der Subjektivierung jemals abgeschlossen werden kann. Es ist dieses Scheitern, diese fehlgeschlagene Fixierung von Identität, die das Subjekt ermöglicht.
Ausgehend von der Kontingenz gesellschaftlicher Prozesse wurde der Begriff des Diskurses eingeführt, um die differenzielle gesellschaftliche Struktur
bzw. Strukturierungsprozesse zu bezeichnen. Es wurde herausgearbeitet,
dass Diskurse, verstanden als verstetigte Handlungen und Wahrheiten, nicht
einfach eine weitere Kategorie zur Benennung von Stabilisierungen darstellen, sondern als ontologisches Theorem die soziale Struktur als solche kennzeichnen. Zugleich wurde betont, dass eine komplette Strukturierung von
Gesellschaft scheitert, da sie keinem determinierenden Prinzip unterliegt.
Jede Struktur wird unablässig von Unentschiedenheit und Dislokationen
heimgesucht, weshalb eine spezifische Organisation von Gesellschaft, weshalb jede (kollektive) Identität nur temporär und prekär stabilisiert ist. Die
Theoretisierung der Struktur als dislozierte Struktur eröffnet zugleich eine
Sichtweise des Subjekts, das weder komplett strukturell determiniert wird,
noch vollständig außerhalb der Struktur steht. Die Freiheitsgrade des Subjekts sind durch die Risse innerhalb der Struktur markiert.
Die Absage an festgeschriebene, natürliche und vordiskursive Identitäten
heißt mitnichten, die gewaltvolle Realität, die entlang komplexer Herrschaftsachsen Identitäten hervorbringt, zu verleugnen. Vielmehr wirft die Anerkennung der diskursiven Verfasstheit von Gesellschaft und Realität Fragen
über die Art und Weise politischer Handlungsfähigkeit auf, die dann wieder
in unterschiedliche Formen gesellschaftlicher Praxis zurückübersetzt werden
müssen. Scheinbare Wahrheiten zu hinterfragen beinhaltet ein aktives SichEinmischen in die Konstruktion von Realität, in das Sichtbarmachen und
141
�Sinnmachen gesellschaftlicher Verhältnisse. Politische Handlungsfähigkeit
kann dann bedeuten, im Hier und Jetzt auf der Basis strategischer Essenzialismen (Spivak 2008) zu arbeiten und die verfestigten Zuschreibungen und
Konstruktionen von Identitäten zu kritisieren und zu unterwandern. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen finden auf einem Terrain statt, das hierarchisch und machtvoll strukturiert ist und einige Handlungen, Strategien, Lebensweisen und Identitäten privilegiert, während es andere ausschließt. Den
absoluten Bruch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen gibt es nicht, Spuren des Alten sind stets im Neuen präsent. Aus einer solchen Perspektive
kann weder Kritik noch Emanzipation vollständig oder universell gedacht
werden, sondern ist nur unvollständig, widersprüchlich, häufig kapillar und
partikular denkbar (vgl. Dzudzek/Kunze/Wullweber 2012). Das bedeutet
auch, Emanzipation nicht im Singular, sondern im Plural zu denken (Laclau
1996d). Ein solcher Ansatz versteht Identität als stets im Werden begriffen.
Zugleich sind in keiner Gesellschaft Antagonismen ausgelöscht. Im besten
Fall werden in Suchprozessen Wege gefunden, mit Antagonismen temporär
umzugehen, die eigene Verantwortung gegenüber dem Anderen (Derrida
1991, S. 49 f.; vgl. Habermann 2008, S. 286 f.) ernst zu nehmen und unermüdlich nach dem Anderen, dem Ausgeschlossenen und dem Marginalisierten – nach der Emanzipation der Anderen – zu fragen.
Literatur
Blaug, M. (1980): The Methodology of Economics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Butler, J. (2000): Restaging the Universal: Hegemony and the Limits of Formalism. In:
Butler, J./Laclau, E./Žižek, S. (Hrsg.): Contingency, Hegemony, Universality. London
und New York: Verso, S. 11–43.
Carlson, L./Dacey, R. (2013): Game Theory: International Trade, Conflict and Cooperation. In: Palan, R. (Hrsg.): Global Political Economy. Contemporary Theories. London
und New York: Routledge, S. 91–103.
Deleuze, G./Guattari, F. (1992): Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie. Berlin: Merve.
Derrida, J. (1991): Gesetzeskraft. Der „mystische Grund der Autorität“. Frankfurt am
Main: Suhrkamp.
Derrida, J. (2000): Politik der Freundschaft. Baden-Baden: Nomos.
Derrida, J. (2006): Schurken. Zwei Essays über die Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Dietrich, F./List, C. (2013): Where do Preferences Come From? In: International Journal
of Game Theory 42, S. 613–637.
Dür, A. (2012): Rational Choice: Ein kritisches Plädoyer für Theorien der rationalen Entscheidung. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 41, S. 73–83.
Dunleavy, P. (1991): Democracy, Bureaucracy and Public Choice. Hemel Hempstead:
Harvester Wheatsheaf.
142
�Durnová, A. (2012): Über die Rationalität hinaus: für eine interpretative und reflexive
Wissenschaft. Reaktion auf Andreas Dür. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 41, S. 315–322.
Dzudzek, I./Kunze, C./Wullweber, J. (Hrsg.) (2012): Diskurs und Hegemonie. Gesellschaftskritische Perspektiven. Bielefeld: Transcript.
Elster, J. (1989): Nuts and Bolts for the Social Sciences. Cambridge: Cambridge University
Press.
Fink, B. (1995): The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance. Princeton:
Princeton University Press.
Friedman, M. (1953): Essays in Positive Economics. Chicago/London: University of Chicago Press.
Gilbert, M. (1989): On Social Facts. Princeton: Princeton University Press.
Gramsci, A. (1991): Gefängnishefte. Hamburg: Argument Verlag.
Habermann, F. (2008): Der homo oeconomicus und das Andere. Hegemonie, Identität
und Emanzipation. Baden-Baden: Nomos.
Hay, C. (2004): Theory, Stylized Heuristic or Self-Fulfilling Prophecy? The Status of Rational Choice Theory in Public Administration. In: Public Administration 82, S. 39–
62.
Hay, C. (2008): Political Ontology. In: Goodin, R. E./Tilly, C. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. Oxford: Oxford University Press, S. 78–96.
Hollis, M. (1994): The Philosophy of Social Science. Cambridge: Cambridge University
Press.
Laclau, E. (Hrsg.) (1990a): New Reflections on the Revolution of Our Time. London und
New York: Verso.
Laclau, E. (1990b): New Reflections on the Revolution of Our Time. In: Laclau, E. (Hrsg.):
New Reflections on the Revolution of Our Time. London und New York: Verso, S. 3–
88.
Laclau, E. (1996a): Why Do Empty Signifiers Matter to Politics? In: Laclau, E. (Hrsg.):
Emancipation(s). London: Verso, S. 34–46.
Laclau, E. (1996b): Subject of Politics, politics of the subject. In: Laclau, E. (Hrsg.): Emancipation(s). London: Verso, S. 47–65.
Laclau, E. (1996c): Power and Representation. In: Laclau, E. (Hrsg.): Emancipation(s).
London: Verso, S. 84–104.
Laclau, E. (Hrsg.) (1996d): Emancipation(s). London: Verso.
Laclau, E. (1998): Von den Namen Gottes. In: Marchart, O. (Hrsg.): Das Undarstellbare
der Politik. Zur Hegemonietheorie Ernesto Laclaus. Wien: Turia + Kant, S. 265–281.
Laclau, E. (1999): Dekonstruktion, Pragmatismus, Hegemonie. In: Mouffe, C. (Hrsg.): Dekonstruktion und Pragmatismus. Wien: Passagen-Verlag, S. 111–154.
Laclau, E. (2000): Identity and Hegemony: The Role of Universality in the Constitution of
Political Logics. In: Butler, J./Laclau, E./Žižek, S. (Hrsg.): Contingency, Hegemony,
Universality. London und New York: Verso, S. 44–89.
Laclau, E. (2004): Glimpsing the future. In: Critchley, S./Marchart, O. (Hrsg.): Laclau. A
critical reader. London und New York: Routledge, S. 279–328.
Laclau, E. (2005): On Populist Reason. London und New York: Verso.
Laclau, E./Mouffe, C. (1985): Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London und New York: Verso.
Laclau, E./Zac, L. (1994): Minding the Gap: The Subject of Politics. In: Laclau, E. (Hrsg.):
The making of political identities. London und New York: Verso, S. 11–39.
143
�MacDonald, P. K. (2003): Useful Fiction or Miracle Maker: The Competing Epistemological Foundations of Rational Choice Theory. In: American Political Science Review 97,
S. 551–565.
Marchart, O. (1998): Gibt es eine Politik des Politischen? Démocratie à venir betrachtet
von Clausewitz aus dem Kopfstand. In: Marchart, O. (Hrsg.): Das Undarstellbare der
Politik: Zur Hegemonietheorie Ernesto Laclaus. Wien: Turia + Kant, S. 90–119.
Marx, J. (2010): Is There a Hard Core of IR? Eine wissenschaftstheoretische Betrachtung
der Theorien der Internationalen Beziehungen. In: Zeitschrift für internationale Beziehungen 17, S. 39–73.
Mouffe, C. (1992): Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics. In: Butler,
J./Scott, J. W. (Hrsg.): Feminists Theorize the Political. New York und London:
Routledge, S. 369–384.
Mueller, D. (2003): Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press.
Mueller, D. (2004): Public Choice: An Introduction. In: Rowley, C. K./Schneider, F.
(Hrsg.): Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy. New York:
Springer, S. 31–46.
Popper, K. R. (1957): The Poverty of Historicism. Frome/London: Butler & Tanner.
Poulantzas, N. (1975): Politische Macht und gesellschaftliche Klassen. Frankfurt am Main:
Athenäum Fischer.
Smith, A. (1974/1776): Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur
und seiner Ursachen. München: Beck.
Spivak, G. C. (2008): Can the subaltern speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation. Wien: Turia + Kant.
Torfing, J. (1991): A Hegemony Approach to Capitalist Regulation. In: Bertramsen, R. B./
Frølund Thomsen, J. P./Torfing, J. (Hrsg.): State, Economy and Society. London: Unwin Hyman, S. 35–93.
Tsebelis, G. (1990): Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics: University
of California Press.
Von Neumann, J./Morgenstern, O. (1953): Theory of Games and Economic Behavior.
Princeton: Princeton University Press.
Wallerstein, I. (1974): The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins
of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic
Press.
Wullweber, J. (2010): Hegemonie, Diskurs und Politische Ökonomie. Das Nanotechnologie-Projekt. Baden-Baden: Nomos.
Wullweber, J. (2012): Konturen eines politischen Analyserahmens. Hegemonie, Diskurs
und Antagonismus. In: Dzudzek, I.Kunze, C./Wullweber, J. (Hrsg.): Diskurs und Hegemonie. Bielefeld: Transcript, S. 29–58.
Wullweber, J. (2014): Heuristik statt politische Theorie: Eine postpositivistische Kritik des
Rational-Choice-Ansatzes. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 34,
S. 241–257.
Žižek, S. (1990): Beyond Discourse-Analysis. In: Laclau, E. (Hrsg.): New Reflections on
the Revolution of Our Time. London: Verso, S. 249–260.
144
�
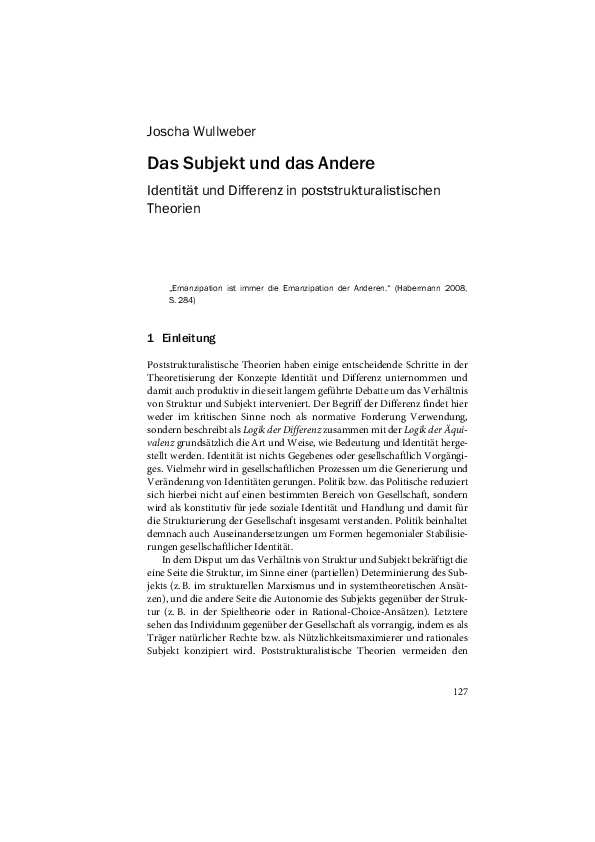
 Joscha Wullweber
Joscha Wullweber