Inwändig, unsichtbar, liminal.
Ambivalenzen pränataler
Verluste
Julia Böcker
1
Einführung
Fehl- und Totgeburten und sich anschließende Trauerprozesse sind gekennzeichnet von Deutungs- und Handlungsambivalenzen, die durch den liminalen Status
des Ungeborenen als Teil des mütterlichen Körpers und als werdendes Individuum, als „noch nicht“ und „nicht mehr“, bedingt sind. Gleichzeitig sind die
Umgangsweisen mit dem Verlust normiert. So wird beispielsweise der Verlust
umso mehr als Todesfall behandelt und als solcher ernst genommen, je später er
in der Schwangerschaft geschieht.
Dieser Beitrag entfaltet eine soziologische Perspektive auf Fehl- und Totgeburt
als Verlusterlebnis. Die Ausgangsannahme ist, dass Verlusterleben und Trauer
im Kontext von Fehlgeburt und Totgeburt deutungsabhängig sind. Gleichzeitig lässt Trauer sich nicht radikal konstruktivistisch fassen und kann nicht unabhängig von ihrer leib-körperlichen Dimension untersucht werden. Gezeigt wird,
dass handlungsrelevante (Laien-)Theorien des Schwangerschaftsverlusts und der
Trauer an intersubjektive Begebenheiten wie die Schwangerschaftsphase bzw.
die (vorgestellte) Entwicklung des kindlichen Körpers gebunden sind und darüber legitimiert werden. Es werden dabei sowohl die ordnenden und normierenden
Funktionen solcher Theorien und Vorstellungen als auch deren Inkongruenzen mit
dem subjektiven Verlusterleben Betroffener herausgearbeitet.
Warum sind Fehlgeburt und Totgeburt thanatosoziologisch interessante Phänomene? Die Antwort lautet hier zunächst: weil die entsprechenden körperlichen
J. Böcker (*)
Lüneburg, Deutschland
E-Mail: boecker@leuphana.de
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2017
N. Jakoby und M. Thönnes (Hrsg.), Zur Soziologie des Sterbens,
DOI 10.1007/978-3-658-11874-7_8
135
�136
J. Böcker
Prozesse als Sterben bzw. Todesfälle und Verlustereignisse erlebt und begriffen
werden. Es wird dargestellt, dass und wie diese als solche subjektiv erfahren werden. Und dass diese (nicht) als frühes Sterben sozial prozessiert und institutionalisiert werden. Trauer, heuristisch gefasst als Ausdruck kulturell bedingten und
kontextualisierten Verlusterlebens, wird hier demnach als (durch Sozialisation
geformtes) leibliches Schmerz- und Verlustgefühl und als intersubjektiv verstehbare und dadurch sozial anerkannte Emotion begriffen. Im Beitrag werden die
Verlustsituationen und -erfahrungen, die der Trauer vorausgehen, also die Entbindungen selbst in den Blick genommen.1
Dieser Einleitung folgt die Bestimmung zentraler Begriffe, anhand derer sukzessive eine kultursoziologische Perspektive auf Verlust und Trauer entfaltet wird.
Sie gründet in der Kulturalität von Lebensbeginn und -ende sowie von Trauer und
konstatiert den Deutungsbedarf des Verlusterlebens (Abschn. 2). In einem zweiten
Schritt werden im Hauptteil vier leib-körperbedingte Deutungs- und Handlungsambivalenzen vorgestellt, die typisch für pränatale Verluste sind (Abschn. 3). Der
Aufsatz schließt mit einem zusammenfassenden Fazit (Abschn. 4).
2
Begriffe und Perspektive
Im Folgenden wird eine kultursoziologische Perspektive auf Erleben und Trauer
im Kontext pränataler Verluste vorgeschlagen. Ausgehend von rechtlichen und
medizinischen Begriffsunterscheidungen zwischen Fehlgeburt und Totgeburt,
werden der Deutungsbedarf und variierende Differenzsetzungen dargestellt, um
die Kulturalität des Verlusterlebens zu veranschaulichen. Schließlich werden
Trauer und Verlusterleben als leib-körperliche Erfahrung und kulturbedingtes
Phänomen konzipiert.
2.1
Fehlgeburt und Totgeburt
Personenstandsrechtlich werden Fehlgeborene definiert als Leibesfrüchte unter
500 g Körpergewicht, die nach der Entbindung kein Lebenszeichen aufweisen,
Totgeborene als solche mit einem Gewicht über 500 g. Babys, die bis zum siebten Tag nach der Geburt versterben, zählen statistisch ebenfalls als Totgeburt. In
1Lena
Dreier und Alexander Leistner danke ich für die kollegiale Kritik an früheren
Fassungen.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
137
Deutschland kommen seit 20 Jahren auf 1000 Neugeborene etwa zwei bis vier
Totgeborene (Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2015). Fehlgeburten passieren viel häufiger. Es wird davon ausgegangen, dass etwa jede fünfte Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet, bei einem großen Teil sehr früh und daher
unbemerkt.
Je nach Kontext bezeichnen Fehlgeburt und Totgeburt das Ungeborene selbst
(X war eine Fehl-/Totgeburt) oder den Prozess respektive die Erfahrung (Y hatte
eine Fehl-/Totgeburt). Als Ersatzbegriff für beides etabliert sich unter Betroffenen zunehmend die englische Entlehnung Stillgeburt (oder Stille Geburt), da
sie positiver konnotiert ist: Es wird davon gesprochen, dass ein Kind still – statt
tot – geboren wurde.
Totgeborene gelten bestattungsrechtlich als menschliche Leichen und müssen
daher standesamtlich registriert und bestattet werden. Bestattungsrecht und Leichenwesen sind Ländersache, sodass einzelne Bestattungsgesetze und -verordnungen variieren. Seit einer Änderung des Personenstandsrechts können Eltern
seit Mai 2013 Fehlgeborene unter 500 g beim Standesamt dokumentieren lassen,
sofern eine ärztliche Bescheinigung über die vormals bestehende Schwangerschaft vorgelegt wird. Auf Wunsch können alle pränatal Verstorbenen bestattet
werden, also auch Fehlgeborene unter 500 g. Allerdings wissen dies Betroffene
oft nicht, sodass einige Länder Hinweispflichten für behandelnde Einrichtungen
in ihre Bestattungsgesetze aufgenommen haben. Wird keine individuelle Beisetzung gewünscht, unterliegen die Kliniken der Pflicht, für eine „hygienisch einwandfreie und dem sittlichen Empfinden entsprechende Beseitigung“ zu sorgen.
Während das sogenannte Schwangerschaftsgewebe früher als Klinikabfall entsorgt wurde, veranlassen Kliniken heute Sammelurnenbestattungen der eingeäscherten Fehlgeborenen.
Die Vielzahl von in Bestattungsrechten verwendeten Bezeichnungen wie beispielsweise „totgeborene Kinder“, „Totgeburten“ oder „Ungeborene und totgeborene Leibesfrüchte“2 bringt einerseits die Heterogenität der – moralpolitischen,
rechtlichen, medizinischen, familiären – Perspektiven zum Ausdruck, von denen
aus je anders auf die Bestattungssubjekte (oder eben nicht „Subjekte“)
2„So
gibt es: totgeborene Kinder, tot geborene oder in der Geburt verstorbene Kinder, verstorbene Neugeborene, in der Geburt verstorbene Leibesfrüchte, Fehlgeburten (oder: Fehlgeborene), Totgeburten (oder: Totgeborene), aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende
Leibesfrüchte, Feten (auch: Föten) oder Embryonen, Ungeborene und totgeborene Leibesfrüchte. Teilweise werden diese Begriffe im Gesetz definiert, teilweise wird eine Definition
vorausgesetzt“ (Aeternitas e. V. Verbraucherinitiative Bestattungskultur 2012).
�138
J. Böcker
zugegriffen wird. Andererseits spiegelt sich darin auch die Entwicklung des im
Mutterleib wachsenden Kindes, das in jeder Phase der Schwangerschaft verloren
werden kann. Dabei variiert der physiologische Entwicklungsstand des Kindes,
der Einfluss nimmt auf die (Einigung auf eine) Zuschreibung: zum Beispiel als
„Gewebeklumpen“ oder als „Baby“.
2.2
Die Kulturalität von Schwangerschafts- und
Lebensbeginn und -ende
Die Entwicklung der befruchteten Eizelle zum Kind im Körper der werdenden
Mutter, also dessen biologischer Anfang, geht nicht mit dessen sozialem Lebensbeginn einher. Entwicklungsbiologisch wird die intrauterine Entwicklung der Leibesfrucht von der befruchteten Eizelle zum lebensfähigen Baby in eine
embryonale Phase und fetale Phase (61. Tag der Schwangerschaft bis zur Geburt)
eingeteilt.3 Zum Ende der Embryonalperiode, also etwa in der achten Schwangerschaftswoche (SSW), sind die Organanlagen des Embryos ausgebildet. Ab der 23.
SSW besteht die Möglichkeit, dass der Fötus die Entbindung vom Mutterleib
überlebt. Fehlgeburten wurden und werden zuweilen nicht über das Körpergewicht (<500 g) von Totgeburten abgegrenzt, sondern als Schwangerschaftsenden
vor der 24. SSW gefasst, sozusagen als pränataler Tod vor der eigenständigen
Lebensfähigkeit. Fehlgeburten werden noch einmal – entlang uneinheitlicher Kriterien – in Frühaborte (etwa 12.-14. SSW) und Spätaborte unterschieden. Die
unscharfe Unterteilung ist der jeweiligen Behandlungsentscheidung geschuldet,
der – verkürzt gesagt – ein operativer Eingriff oder ein Geburtsprozess folgt. Was
wiederum Einfluss darauf nimmt, ob die Frau das folgende Ereignis als Operation
oder als Geburt erlebt. Oder als etwas dazwischen.
Lebensanfang und Lebensende werden oft als natürliche, unveränderliche
Tatsachen verdinglicht und es gerät aus dem Blick, dass beide Markierungen
sozial hergestellt und performiert werden. Jedes Kollektiv vollzieht spezifische
Praktiken, hat Erzählungen und Bilder, kurz: eine Kultur des Lebensbeginns und
-endes. Soziologie und Kultur- und Sozialanthropologie erforschen die Prozesse
von „coming-into-being, completion and attenuation of personhood and how life
and death are attributed, contested, and enacted“ (Kaufman und Morgan 2005,
S. 317). Der soziale Lebensbeginn ist historisch und kulturell variabel. Er muss
3Beiden
geht eine zelluläre Phase von der Befruchtung bis zur Einnistung in die Gebärmutter voraus.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
139
nicht mit der Geburt – der für Dritte sichtbaren Zweiwerdung – einhergehen.
Während es eine ostafrikanische Tradition geben soll, die den Moment, an dem
das Kind erstmals in mütterlichen Gedanken vorkommt, als dessen Geburtstag
bestimmt (vgl. Alberti 2012, S. 73), beschreibt Robert Hertz in seiner klassischen
Untersuchung eine Stammesgesellschaft in Südostasien, in der nicht nur Kindstötungen folgenlos bleiben, sondern im Allgemeinen „der Tod von kleinen Kindern
eine sehr schwache und fast sofort abgeschlossene soziale Reaktion hervor[rufe]“
(Hertz 2007, S. 163). Dass die Absenz von Verlustgefühlen kein historisches Phänomen darstellt, zeigt eindrücklich die Studie von Nancy Scheper-Hughes (2004)
zum Säuglingssterben in brasilianischen Favelas. Es existieren zahlreiche anthropologische Studien über regionalspezifische Sichtweisen, Riten und Ausdrucksformen nach Schwangerschaftsverlusten (vgl. Cecil 1996), deren Ausgestaltung
immer auch davon abhängt, inwiefern ein Mensch und Kollektivmitglied betrauert wird.
In heutigen „westlichen“ Gesellschaften wird das Ungeborene oft sehr früh,
mitunter bereits ab dem positiven Schwangerschaftstest, als individuelles Gegenüber adressiert. Fortwährend wird der körperliche Zustand wahrgenommen, im
Hinblick auf das werdende Kind (immer wieder neu) interpretiert und eigenes
Verhalten angepasst. Hirschauer und Kolleginnen sprechen von der „Konstitution eines inwändigen Anderen“ (Hirschauer et al. 2014), um die Sozialität der
Personwerdung im Mutterleib zu beschreiben. Voraussetzung für pränatale Interaktion ist, die leiblichen und körperlichen Erscheinungen überhaupt in einen
Zusammenhang mit der Entwicklung – oder Existenz – eines Anderen zu bringen. So wird selbstreflexiv zur Frage, ob das Magenknurren ein Magenknurren
ist oder das Kind, das sich entwickelt. Schwangerschaftsverdacht, die ärztliche
Bestätigung, der erste Ultraschall, die ersten gespürten Kindsbewegungen stellen
typische Ereignisse dar, die die fortlaufende Schwangerschaft sequenzieren. Die
Wahrnehmung körperlicher Erscheinungen wird auf das Kind und dessen Zustand
bezogen, das eigene Verhalten „durch Selbstführungstechniken im Namen des
kommenden Kindes geprägt“ (Sänger et al. 2013, S. 56). Das Ungeborene ist ein
Gegenüber im Werden. Seine „inwändige“ Entwicklung wird medizinisch prozessiert und durch bildgebende Verfahren (insbesondere Ultraschall, vgl. Heimerl
2013) zugänglich gemacht. Aus kulturhistorischer Perspektive beginnt diese pränatale Sozialisation nach Schwangerschaftsbeginn früher denn je. Barbara Duden
schreibt mit Verweis auf eine italienische Studie: „Sizilianische Bäuerinnen wollten noch in den 1930er Jahren nicht wahrhaben, dass ihre Versuche, gestocktes
Monatsblut (…) wieder in Gang zu bringen, als Abtreibung eines ‚Fötus‘ definiert werden könne“ (Duden 2002, S. 15). Anders gesagt, bedarf es einer Vorstellung des Kindes bzw. menschlichen Lebens als Kind, Mensch, Person, um mit
�140
J. Böcker
ihm oder ihr überhaupt in Interaktion zu treten und um es, ihn oder sie als bereits
lebend und somit sterbefähig zu begreifen und zu behandeln.
2.3
Verlust und Trauer
Sozialwissenschaftliche Trauerforschung greift unterschiedlich auf ihren Gegenstand zu. Grob unterscheide ich drei Formen soziologischer Trauerforschung, die
sich entlang ihrer Ausgangstheoreme (Trauerbegriff) und Erkenntnisinteressen
typisieren lassen: Trauer fasse ich demnach, kurz gesagt, als Pathologie, als thematischen Rahmen oder als Gegenstand.
Im ersten Typ wird Trauer als Problem/Pathologie des trauernden Subjekts
gefasst, dem geholfen werden kann (und soll). Hier ist klar, was Trauer heißt,
und unklar, wie man sie lindern kann. In Erhebungen wird vorausgesetzt, dass
in bestimmten Lebenslagen oder nach spezifischen Ereignissen getrauert wird.
Trauer wird anhand von Symptomen oder über die Selbsteinschätzung von Trauernden festgelegt, um positive und negative Einflussfaktoren auf gelingende Verlustbewältigung zu bestimmen. In diesem Zusammenhang spielen klassische
psychologische Trauertheorien eine Rolle, die „zwischen normaler und pathologischer Trauer“ unterscheiden (vgl. Jakoby 2012, S. 408).
Zweitens sei der heterogene Bereich von Forschungen genannt, in denen
theoretische Trauerkonzeptionen weder Einfluss auf die Untersuchungen nehmen noch durch die Forschungsergebnisse irritiert werden können. Trauer meint
hier – alltagstheoretisch inspiriert – ein thematisches oder kulturelles Feld, auf
das Bezug genommen wird, bspw. in Studien zur Sepulkral- und Bestattungskultur, zur Selbsthilfe oder zur gesellschaftlichen Organisation von Leben und Tod.
Diese können für das Verständnis eines Trauerphänomens in seinem historischen
Gewordensein unabdingbar sein. So lässt sich auf Basis der Studie Michael Prossers über das bereits im Mittelalter vorhandene Bestreben von Eltern, ihre ungetauften Fehl- und Totgeburten in geweihter Erde zu beerdigen (Prosser 2005), die
prominente These anzweifeln, der Tod kleiner Kinder sei bis zur Moderne kaum
betrauert worden (Hahn 2002, S. 76). Dabei stand die Erforschung von Trauer
selbst aber nicht im Fokus der archäologischen und sozialhistorischen Studie.
Schließlich gibt es drittens ein emotionssoziologisches Bestreben, Trauer systematisch als Gegenstand in den Blick zu nehmen (vgl. Jakoby 2012). Trauer als
mitunter verkörpertes Gefühl ist bislang selten Ziel soziologischen Zugriffs gewesen. Gefragt wird, wie sich Trauer ausdrückt und wie sie beobachtbar wird: als
rituelle Praxis, als normierte Emotion (Jakoby et al. 2013; Doka 2002), als Emotion mit „Bildungspotential“ (Böhner und Zirfas 2012) oder in ihrer Funktion als
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
141
„Biografiegenerator“ (Winkel 2008). Die forschungsleitende Frage ist hier nicht
primär, wie kann Trauernden geholfen werden, sondern: Welche (sozialen) Ursachen, Formen und Konsequenzen hat Trauer? Wie hängen Trauer, Verlusterleben
und kulturelle Konstitution des Verlusts zusammen?
Trauer im Sinne des dritten Typus muss von Traurigkeit unterschieden werden,
will man dabei deren leiblich-körperliche Qualität berücksichtigen. Das Gefühl
oder körperliche Empfinden von Traurigkeit ist nur eine, die leibliche, Dimension von Trauer, welche als Emotion im Sinne eines kulturell kontextualisierten Gefühls gefasst werden kann. Unter einer Emotion lässt sich eine subjektive
Empfindung verstehen, die aufgrund ihres sozialen Ursprungs und der prinzipiell anschlussfähigen Interpretation durch das fühlende Subjekt Sinn ergibt. Wird
Traurigkeit durch das sie empfindende Subjekt gedeutet, wird sie zur Trauer im
hier verstandenen Sinne: ein durch Sozialisation auf spezifische Weise interpretiertes Gefühl, das so nur in seinem kulturellen Sinnzusammenhang entstehen
konnte. Sobald die Emotion externalisiert und in Form sozialer Handlung an
Orten verwirklicht wird, wird sie beobachtbar.
Trauer als Gefühl stellt die schmerzhafte Folge eines unersetzlichen Verlusts
dar (vgl. Hahn 1968, S. 7). Der Deutung des Verlusts kommt deshalb entscheidende Relevanz zu, wobei subjektives Empfinden und Deuten eines Verlusts und
soziale Geltung und Normierung dessen, was als Verlust infrage kommt (empfunden werden sollte), nicht selten auseinanderklaffen. Auf welche Art und wie
intensiv getrauert werden darf oder soll, welches passende und unpassende Orte
und Situationen sind, um zu trauern, unterliegt sozialer Normierung, die kontextbedingt variiert (vgl. Jakoby et al. 2013). Bis hierhin wurde Trauer eher als
Zustand thematisiert. Tatsächlich ist hingegen Trauer nach einem Verlust prozesshaft. Gefühlszustände des trauernden Individuums verändern sich, Verlust und
Empfinden werden reinterpretiert, das Leben neu organisiert und anders auf Verlustereignis und -objekt geblickt. Deshalb macht es einen enormen Unterschied,
zu welchem Zeitpunkt man Trauernde bezüglich des Verlusterlebens befragt.
Während die einen noch nicht sprachfähig sind, haben andere das Erlebnis bereits
sinnhaft in ihre Lebensgeschichte integriert.
Trauer ist also einerseits deutungsabhängig und somit immer auch gesellschaftlich vermitteltes und sanktioniertes Gefühl. Vorzeitige Schwangerschaftsenden im klinischen Sinne, also nicht in die Geburt eines lebenden Babys mündende
Schwangerschaften, sind keine Determinanten für Trauer.4 Voraussetzung für
4So
sind zum Beispiel indische Leihmütter nach der Übergabe des Kindes an die sogenannten Bestelleltern (auch) stolz darauf, ihre Familien reich gemacht zu haben, sowie auf ihre
Gebärfähigkeit, die einer unfruchtbaren westlichen Frau Familie ermöglicht.
�142
J. Böcker
Trauer ist, dass das, was passiert, überhaupt als Schwangerschaftsende bzw. Sterbefall interpretiert wird und dass dies zweitens als ungewollt, Problem oder Verlust empfunden wird. Es gab und gibt immer Schwangerschaftsenden, die nicht
als solche erkannt werden, oder solche, die (auch) als Erleichterung, Wiederherstellung von Würde und Selbstbestimmung empfunden werden oder gar die einzige Möglichkeit darstellen, frei von Fremdbestimmung und Gewalterfahrung zu
leben.5 Andererseits beinhaltet Trauer eine leibliche Dimension noch deutungsbedürftiger Empfindungen oder Schmerzen, denen eine eigene Faktizität innewohnt,
die für das Individuum handlungsrelevant wird, weil es die zur Verfügung stehenden Deutungen und Erklärungen beispielsweise als treffend empfindet oder als
entwürdigend. Um solche Empfindungen bei der Analyse von Verlusterlebnissen
und Trauer miteinzubeziehen, wird die konstruktivistische Perspektive hier um
eine leibphänomenologische ergänzt.
Helmuth Plessner ging in seiner Begründung der philosophischen Anthropologie von der „exzentrischen Positionalität“ des Menschen aus (Plessner 1975).
Diese Eigenschaft, sich die eigene Position im Hier und Jetzt bewusst zu machen,
unterscheide ihn von anderen Lebewesen. Der Mensch sei durch sie doppelt positioniert: Einerseits sei er Leib, befände sich physisch an einem bestimmten Ort,
fühle und verhalte sich – den Tieren ähnlich – instinktiv. Andererseits habe er
einen Körper, den er bewusst einsetze, von dem er eine Vorstellung habe, dessen
wahrnehmbare Qualitäten und Grenzen er interpretiere und bewerte. Diese klassische Unterscheidung von vorbewusstem Leib und kulturell geformtem Körper ist
der heuristischen Trennung von Gefühl und Emotion vergleichbar.
Der phänomenologischen Tradition entlehnt sei zuletzt das Begriffspaar Erleben und Erfahrung. Erst eine Typisierung auf Basis früherer Erfahrungen grenzt
im Bewusstsein einen Teil des fortlaufenden Erlebens als eine bestimmte und
benennbare Erfahrung ein (vgl. Schütz 1932).
Jedes Verlusterleben ist individuell. Was hingegen als Verlust ins Erfahrungswissen eingeht, ist kulturell vermittelt. Erst die Interpretation der Schmerzen und
Gefühle knüpft das subjektive Empfinden an bestimmte Ursachen und Erlebnisse
(sowie diese bereits Einfluss auf die Entstehung der Gefühle genommen haben)
und macht aus dem Erleben eine mitteilbare Erfahrung. Dabei erleben Fehl- und
5Solche
Schwangerschaftsenden inkl. veranlasster Abbrüche können dennoch für Betroffene dramatisch sein.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
143
Totgebärende den Verlust leiblich natürlich signifikant anders als andere Betroffene bzw. Beteiligte wie Partner6, Partnerinnen, Großeltern u. a., die gleichwohl
einen herben Verlust empfinden können. Für die Darstellung im Folgenden wurden die Perspektiven der gebärenden/verlierenden Frauen rekonstruiert.
3
Ambivalenzen pränataler Verluste
Pränatale Verluste sind in jeder Phase der Schwangerschaft von Ungewissheiten
und Uneindeutigkeiten7 geprägt, die für die anschließende Trauer spezifisch sind.
Diese Ambivalenzen, deren Bedingungen sowie die entscheidenden, zum Teil
widersprüchlichen Differenzsetzungen im Dienste der Vereindeutigung sollen nun
systematisierend dargestellt werden.
Die Ausführungen basieren auf ersten Ergebnissen meines laufenden Promotionsprojekts, das im iterativen Forschungsstil der „Grounded Theory“-Methodologie (GTM) (Strauss 1998; Equit und Hohage 2016) durchgeführt wird. Im
Anschluss an erste Auswertungen des Datenmaterials werden im Sinne des „Theoretical Sampling“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 181–182) systematisch
kontrastiv so lange neue Daten erhoben, bis die erarbeiteten gegenstandsbezogenen Konzepte und Theorien „gesättigt“ sind. Bisher beinhaltet der Datenkorpus
unter anderem Audiotranskripte8, Beobachtungsprotokolle9 und öffentlich verfügbare Beiträge in Online-Trauerforen.10 Für die sequenzanalytische Auswertung
6Zur
väterlichen Trauer bei Totgeburt vgl. bspw. die Autoethnografie von Weaver-Hightower (2012). Bonnette und Broom (2011) thematisieren anhand qualitativer Interviews die
Schwierigkeiten von australischen Vätern Totgeborener, legitim ihre Trauer auszudrücken
und sich als (trauernde) Väter zu identifizieren.
7Ambivalenz und Uneindeutigkeit werden synonym verwendet, wobei der aus der Psychologie stammende Begriff Ambivalenz eher auf Empfindungen von Handlungssubjekten
rekurriert, während soziale Uneindeutigkeit besteht, wenn eine Situation oder ein Ereignis
intersubjektiv verschieden interpretiert und behandelt wird. Da davon ausgegangen wird,
dass auch subjektive Ambivalenz Ergebnis internalisierter, heterogener sozialer Bedeutungen ist, wird die synonyme Verwendung für vertretbar gehalten.
8Bisher: Sieben narrative Einzel- und Paarinterviews mit Betroffenen, zwei Expertinneninterviews (zwei Kindsbestatterinnen und eine Moderatorin eines Online-Trauerforums)
sowie eine Gruppendiskussion unter Selbsthilfe-Initiatorinnen.
9Zum Beispiel von Veranstaltungen am Weltgedenktag für verstorbene Kinder oder
Selbsthilfetreffen.
10Zudem weiteres Material wie Reden zur Einweihung eines (Sternen-)Kindergrabfeldes,
Fotografien dieser Gräber, Gedenkseiten im Internet oder Informationsbroschüren.
�144
J. Böcker
werden Verfahrensweisen der „Objektiven Hermeneutik“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 246–277) mit dem Kodierverfahren der GTM gekoppelt. Die
folgenden vier Ambivalenzen stellen analytische Verdichtungen verschiedener
leib-körperbedingter Uneindeutigkeiten dar, die sich im empirischen Material
gezeigt haben.
Die erste Ambivalenz ist durch die „Inwändigkeit“ des Sterbens bedingt
(Abschn. 3.1). Eine zweite besteht in der Unsichtbarkeit des Verlusts
(Abschn. 3.2). Während in diesem Fall eine Diskrepanz von Verlustintensität und
sozusagen zu wenig kindlichem Körper besteht, können umgekehrt die leibliche
Faktizität der Entbindung und der vorhandene Kindskörper im Kontrast zum sozialen Status des Kindes11 und der Frau stehen (Liminalität, Abschn. 3.3). Daran
anschließend wird die ambivalente Kongruenz der Prozesse Entbinden und (baldiges) Sterben verhandelt (Abschn. 3.4).
3.1
Inwändiges Sterben
Eine Ambivalenz besteht im uneindeutigen Status des Ungeborenen als Teil des
mütterlichen Leibes und werdendes Individuum. Es wird bereits als Gegenüber
adressiert, ist aber noch nicht richtig in der Welt. Stirbt es in dieser Phase, ist es
(etwas) nicht mehr, so wie andere Verstorbene nicht mehr in der Welt sind. Nur
war es für Andere ja noch nicht da. Die Deutung des Ungeborenen – als signifikantes Gegenüber, als „Prinzessin“ oder vorerst als körperliche Veränderung und
Vorbereitung auf ein zukünftiges Kind – beeinflusst die Deutung des Verlusts, der
zugespitzt als Verlust der Schwangerschaft oder des Kindes gefasst und/oder
erlebt werden kann.12 Diese verschiedenen Vorstellungen sind allerdings nicht
von der Entwicklungsstufe des Kindes bestimmt, auch wenn dies eine häufig
11„Kind“
stellt bereits eine Deutung dar. Es ließe sich auch von Leibesfrucht oder Leiche
sprechen. Begrifflich soll stets die jeweilige Sicht, in diesem Fall der Trauernden, zum Ausdruck kommen.
12Der dem Englischen entlehnte Begriff „Schwangerschaftsverlust“ beinhaltet Fehl- und
Totgeburten gleichermaßen. Es ist zu überlegen, ihn als umfassenderen Begriff zu verwenden, um von der scharfen und konsequenzenreichen Differenz Abstand zu nehmen, die
nicht zwangsläufig dem Verlusterleben der Betroffenen entspricht. Allerdings fokussiert
er den Verlust des leib-körperlichen Zustands der Schwangerschaft selbst und verschiebt
damit die Blickrichtung weg vom pränatalen Sterben.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
145
hervorgebrachte Laientheorie der Trauer ist (je entwickelter der Fötus, desto stärker sei die Bindung ans kindliche Gegenüber und umso größer der empfundene
Verlust). Theoretisch formuliert, finden zwei Prozesse des Werdens im Mutterleib
statt: Zum einen entwickelt sich das Ungeborene leiblich, zum anderen wird es
zur sozialen Person (gemacht).13 Diese Prozesse können, das hatten die Kulturvergleiche des kindlichen Personenstatus gezeigt, unabhängig voneinander verlaufen. Faktisch wird die soziale Konstituierung der Person allerdings an die
wahrnehmbaren Veränderungen des Körpers des Ungeborenen (sowie der
Schwangeren) gebunden.
Das Sterben des Kindes geht meist mit körperlichem Selbsterleben – vom
komischen Gefühl bis zu lebensbedrohlichen Symptomen – der Schwangeren einher. In den Erzählungen mancher Frauen wird diese Doppelperspektive deutlich.
So schließt die befragte Rhea14 ihre Erzählung vom Krankenhausaufenthalt, bei
dem sie in der 22. SSW von Schmerzen geplagt wird und nicht weiß, was mit ihr
los ist, folgendermaßen:
Am nächsten, also in der Nacht dann gab’s irgendwann so’n kleines Rucken im
Bauch, wo ich irgendwie dachte (.) also danach war’s irgendwie nen Stück weit entspannter. Und ich dachte irgendwie ‚Ich glaub, da ist irgendeine Entscheidung in die
ein oder andere Richtung in meinem Körper gefallen‘, so.
In der Erlebenssituation ist dies zunächst der entscheidende Moment, ab dem
Schmerzen und Ungewissheit ein Ende haben, nicht der Augenblick, in dem die
410 g wiegende Leibesfrucht stirbt. Etwas später im Interview, als sie die Warnung der Hebamme zitiert, das Kind könne nach der Geburt zwar einen Augenblick leben, werde aber nicht überleben, formuliert sie – in einem Einschub in die
fortlaufende Erzählung des Geburtsvorgangs – denselben Moment so:
Ach so, und es gab noch so’n Augenblick, an dem ich irgendwie gemerkt hab, dass
das Kind in meinem Bauch so’n Stückchen tiefer sinkt und ich hatte irgendwie das
Gefühl, dass es dann in dem Augenblick, gestorben ist. Also, dass ich (.) ich hatte (.)
ich war nicht ganz sicher, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das Kind (.) lebend
zur Welt kommt.
13Diese
pränatal beginnenden Prozesse dauern nach der Entbindung an: Das Neugeborene
ist auch danach leiblich abhängig und noch soziale Person im Werden. Für inspirierende
Gedanken zum Begriff des „sozialen Akteurs im Werden“ danke ich Susanne Lemke.
14Die Namen aller Forschungssubjekte wurden durch Pseudonyme ersetzt.
�146
J. Böcker
Späteres Wissen um den Ausgang eines biografischen Ereignisses verändert und
ergänzt hier nachträglich die Deutung der im aktuellen Erleben nicht wahrgenommenen oder anders interpretierten Anzeichen. Sie werden als Eckpunkte in den
Zusammenhang des pränatalen, in Anlehnung an Hirschauer et al. (2014) „inwändig“ genannten, Sterbeprozesses eingebettet.
Für das, was im Mutterleib geschieht, obliegt Ärztinnen und Schwangeren die
Expertise, wenngleich es ungesehen, ungefühlt oder ungewiss bleiben kann. So
thematisieren manche Frauen Schuldgefühle, nichts bemerkt zu haben. Das verweist umgekehrt auf das internalisierte „normative Muster der Mutterliebe“
(Schütze 1986), doch etwas gespürt haben zu müssen. So antwortet in einem
öffentlichen Online-Forum zum Thema Fehlgeburt eine Frau: „Ja leider gibt es
das, dass Babys im Bauch sterben und man keine Anzeichen15 hat“ (Juni 2013)
auf den Post einer in der 9. SSW Schwangeren, deren Arzt keine fötalen Herztöne
mehr feststellen konnte. Sie schrieb:
So elend gings mir noch nie, weine mir die Augen aus. In 7. SSW war Herzaktivität
zu sehen, was meint ihr, ist es wirklich vorbei mit mein klein Spatz? Ich habe keine
Blutung und auch nich direkt Schmerzen, es zieht und zwickt ab un zu, aber nicht
schlimm.16
Hier wird das Fehlen von Schmerzen oder körperlichen Anzeichen auch deshalb
bedauert, weil die Tatsache, keine Blutung zu haben, mit der Tragweite der ärztlichen Diagnose inkompatibel erscheint.
In beiden Beispielen besteht Unklarheit darüber, ob das Ungeborene noch
lebt, und wird von den Schwangeren versucht, den eigenen leiblichen Zustand
mit Hinblick darauf zu interpretieren. Während Rhea den Sterbemoment zunächst
als körperliche Erleichterung empfindet und nachträglich zuordnet, ist die andere
Betroffene von den schwachen Symptomen irritiert, die dem diagnostizierten Verlust nicht gerecht werden. Wahrnehmungen körperlicher Erscheinungen werden
mit dem inwändigen Sterben deutend verknüpft.
15Aus
dem Kontext wird ersichtlich, dass mit „keine Anzeichen“ nicht die fehlenden Herztöne gemeint sind.
16Schreibfehler in den Zitaten stammen aus den unverändert übernommenen Originaltexten.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
3.2
147
Unsichtbare Verluste
Frühe Fehlgeburten gehen häufig außerhalb klinischer Kontexte ab. Manchmal ist
unklar, ob es sich um eine Fehlgeburt oder eine starke Blutung handelt, oder es
bleibt kein Kind zurück, das berührt, angesehen und verabschiedet werden kann.
Die Schwangerschaft wurde in dieser Phase – auch in Antizipation eines möglichen Verlustes – meist noch wenig nach außen verkündet, sodass das Ungeborene
weder körperlich als Leiche noch in der sozialen Kommunikation vorhanden ist.
Sara beschreibt die Situation und kognitive Realisierung ihrer frühen Fehlgeburt wie folgt:
Und dann nachts ging’s aber richtig los und dann hätt ich nie gedacht, dass mich
das so mitnimmt, weil man das schon […] öfters hört, wo’s hieß so, dass man mal
ne Fehlgeburt hat und dann denk ich ‚naja in diesem frühen Stadium, man hat keine
(.) vielleicht noch nicht diese Beziehung zu dem Kind und das ist ja ganz normal‘,
in Anführungsstrichen, ne? Aber das war (.) ich hatte richtig (.) ich bin zur Toilette gekrochen auf allen Vieren, weil ich nicht mehr stehen konnte, ne und es es
(.) ich hatte richtig (.) Wehen sozusagen und dann kriegst Du da (.) dieses äh (.)
Kind {lacht/schnauft} (.) in Anf/Also es ist ja irgendwie noch anonym und so, aber
es ist Dein Kind und und es geht einfach weg, ne, und das das fand ich irgendwie
schon ziemlich krass und ich hab, also ich bin eigentlich’n sehr pragmatischer nicht
so’n gefühlsbetonter Mensch und hab echt (.) war von mir überrascht, was das mit
mir macht, so. Genau, mein Mann war in dem Moment auch total überfordert, weil
er das gar nicht einschätzen, also für ihn war’s dann eigentlich eher (.) gut sozusagen {lacht}, dass sich alles geklärt hat und er war von mir völlig überford/also mit
mir völlig überfordert, die wie ich dann da heulend in der Ecke saß und gar nicht
wusste, was mit mir passiert. (…) Ich war dann, glaub ich, noch mal bei der Ärztin gewesen und dann war für mich noch (…) der krasseste Einschnitt: die Woche
danach hat sie dann noch mal Ultraschall gemacht, und dann zu sehen, dass auf einmal alles leer ist, alles ist weg. Also dass Du wirklich dieses Bild noch mal vor Dir
hast: Vorher war alles angelegt und da und dann ist’s auf einmal weg und das ist so:
wie auch weg aus (.) es war ja auch noch nicht so offiziell (.) also es ist einfach verschwunden. {atmet ein} Genau. {atmet aus}.
Das leibliche Erleben deutet Sara als Geburt eines Kindes („kriegst da dieses Kind“). Die Körper-Leib differenzierende Formulierung, dass sie „gar nicht
wusste, was mit [ihr] passiert“, zeigt, dass diese Deutung zum Zeitpunkt des Erlebens noch nicht gegeben ist. Dabei „passiert“ ihr etwas Leibliches, das in seiner
Wucht den „pragmatischen Menschen“ Sara überrollt. Erst die ärztliche Bestätigung der Fehlgeburt und die wahrnehmbare Leere lassen Sara den Verlust realisieren, der durch die schmerzhafte Fehlgeburt allein nicht greifbar wird. Ihre
Trauer ist weniger an den leiblichen Schmerz geknüpft als an das körperliche und
�148
J. Böcker
soziale Nichtvorhandensein des Kindes. Zudem irritiert sie die Intensität ihrer
Trauer („hätt ich nie gedacht, dass mich das so mitnimmt“), da sie eine Trauerintensitätsnorm verinnerlicht hat (frühe Fehlgeburten seien nicht so schlimm)
und ein entsprechendes Selbstbild (gerade als pragmatischer Mensch sei es nicht
schlimm), das erschüttert worden ist.
Trauer im Falle früher Fehlgeburten, also nach Schwangerschaftsverlusten
im ersten Drittel der Schwangerschaft, werden von Julia Frost und Kolleginnen bezeichnet als „a unique type of loss because of the many ambiguities surrounding the event. Early miscarriage can be seen as an ‚imperfectly scientised‘
form of death in the context of modern societies where science and medicine are
expected to provide ‚rational‘ accounts of the causes of physiological phenomena“ (Frost et al. 2007, S. 1003). Neben der meist fehlenden wissenschaftlichen
Erklärung der physiologischen Ursache und einer unzureichenden Professionalisierung, diese Todesfälle (als solche!) zu bearbeiten, trügen Isolation und
Unsicherheit zum Leid der Frauen bei. Frost et al. bezeichnen den „holistisch“
empfundenen Verlust der Frauen als „loss of possibility“. Sie betrauerten auch
den Verlust einer früheren oder potenziellen Identität: „following a miscarriage many women experience a loss of hope, a loss of agency, a loss of bodily
integrity and the loss of identity“ (Frost et al. 2007, S. 1013). Angesichts einer
Gesellschaft, die vollwertige/s Weiblichkeit/Frausein mit Mutterschaft gleichsetzt, empfänden die Frauen Gefühle der Minderwertigkeit und des Verlusts ihrer
weiblichen Identität. Die diversen Verlustgefühle seien teilweise der „embodied
nature“ (Frost et al. 2007, S. 1014) der Fehlgeburt geschuldet, da ihr neben einer
emotionalen natürlicherweise auch eine physische Leere folge (die mitunter auch
von Müttern lebend geborener Babys beschrieben und betrauert wird).
Der physisch empfundenen Leere bezüglich des unerfüllten Kinderwunsches
muss keine Schwangerschaft vorausgegangen sein. Christine schreibt über ihre – sie
selbst irritierenden – Verlustgefühle, nachdem sie feststellte, wieder nicht schwanger
geworden zu sein:
Ich habe das Anfang des Jahres, als ich versucht habe, schwanger zu werden,
genau so erlebt. Da war jeden Monat, als es nicht geklappt hat, ein starkes Gefühl
von Leere, Schmerz (…) und Verlust, das mich extrem irritiert hat und mit dem ich
nichts anfangen konnte. Faktisch war da ja noch nichts verloren gegangen außer
einer Möglichkeit. Ich habe rational dagegen gearbeitet und irgendwann ist die
Wunde geheilt, aber ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum ich so ein starkes
Verlustgefühl für etwas empfunden habe, das noch gar nicht da war. Vielleicht trauert man eher um verloren gegangene Erwartungen und unerfüllte Wünsche als um
eine tatsächliche Person?
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
149
Die Verlustempfindung ist zweifach an körperliche Prozesse geknüpft: Über die
Menstruationsblutung wird festgestellt, dass „es nicht geklappt hat“. Mit ihrem
Einsetzen („jeden Monat“) macht sich die körperlich spürbare Enttäuschung breit
(„Schmerz“, „die Wunde geheilt“). Auch Rhea beschreibt im Interview, das ein
Jahr nach der späten Fehlgeburt stattfindet, eine wiederkehrende Traurigkeit,
sobald sie ihre Menstruation bekomme. Erst dann erinnere sie sich an die Fehlgeburt und verknüpfe beide Körpererscheinungen.
3.3
Liminalität
Die Schwangere und das Ungeborene befinden sich, ritualtheoretisch gefasst, in
einer „Liminalphase“ auf der Schwelle des Übergangs zur Mutterschaft und in
die soziale Welt, in einem „Zwischenstadium der Statuslosigkeit“ (Turner 1989,
S. 97). Dass die zwei Prozesse des Werdens – die leibliche Entwicklung von Kind
und Schwangeren, die zur körperlichen Entzweiung führt, und der soziale Vorgang, Person zu werden und ein Kind zu bekommen – aneinander gekoppelt sind,
mag eine anthropologische Konstante sein. Wie sie, d. h. anhand welcher sicht-,
fühl- oder anders teilbaren Begebenheiten aufeinander bezogen werden, ist hingegen kulturell variabel.
Fehl- und Totgeburten beenden so gesehen zwei unabgeschlossene und
unterschiedlich fortgeschrittene Übergangsphasen. So kann die körperliche Entwicklung des Ungeborenen zum „fertigen“ Baby unabgeschlossen sein und der
vorhandene, vielleicht zu kleine oder deformierte Körper im Kontrast zur vormaligen Repräsentation eines Kindes stehen.
Eine Inkongruenz kann umgekehrt entstehen, wenn der kindliche Körper
(„schon alles da und alles dran“) sowie das Entbindungserleben eine unerwartete leib-körperliche Faktizität besitzen. Die bereits zitierten Fälle zeigen, dass
das Entwicklungsstadium nicht über die Empfindung als Geburt entscheidet.
Während Sara bereits im ersten Schwangerschaftsmonat davon spricht, „richtig
Wehen“ gehabt zu haben, berichtet Rhea in der 22. SSW von wiederkehrenden
Bauchkrämpfen. Das Entbinden nennt Rhea „rausschieben“. Sie versteht sich
zum Zeitpunkt des Interviews nicht als Mutter. Fotos des Jungen, Namensgebung
und eigeninitiierte Bestattung lehnen sie und ihr Partner einstimmig ab. Auch
wenn für sie „dieses Kind“ noch nicht „auf dieser Welt“ gewesen ist, lässt der
Abschluss der einstündigen Stegreiferzählung kaum den Schluss zu, Rhea trauere
nicht:
�150
J. Böcker
Wir ham vorher noch getippt, {Stimme wird brüchig} ob’s ein Junge oder ein Mädchen ist, und lagen auch beide richtig, dass es halt’n Junge ist und so und dann
{weint}. Ja so kleine Momente, die irgendwie cool warn. (4) Ja. {weint} Mhm. Und
es war (2) {räuspert sich} war so ganz angenehm eindeutig, also dieses Kind war
einfach definitiv zu klein, um auf dieser Welt zu leben. (2) Und gleichzeitig war halt
schon alles da und alles dran und (2) mhm. Ja (12). Ja {58 Sek. Pause, putzt sich die
Nase, atmet tief und trinkt etwas}.
Neben diesen subjektiven Ambivalenzen können Widersprüche auf intersubjektiver Ebene zwischen den Erfahrungen – und seien sie noch so eindeutig – und den
Deutungen und Handlungen Anderer bestehen. Exemplarisch sei die Trauer delegitimierende Aussage genannt, es habe sich ja noch nicht um ein richtiges Kind
gehandelt. Eine sinngemäß von Betroffenen häufig zitierte Verletzung, die dem
eigenen Verlusterleben zuwiderlaufe. Kenneth Doka bezeichnet einen so empfundenen Verlust, „der nicht offen anerkannt, sozial sanktioniert oder öffentlich
betrauert wird“, als „entrechtete Trauer“ (Doka 2002, 2014, S. 4).17 Beispielsweise berichtete eine Frau von den sie diskreditierenden Reaktionen, als sie zur
Geburt ihres Totgeborenen eine Karte mit Foto verschickte, die zugleich als Trauerbrief fungierte. Die Sanktionierung des Wunsches nach einem – bestattungsrechtlich möglichen – Einzelgrab für Fehlgeborene, indem konstatiert wird, dies
sei „übertrieben für Babys, die noch nicht geboren waren“, stellt ein weiteres Beispiel dar (vgl. Böcker 2015). In diesen Fällen wird dem Verlust nicht der Status
eines frühen Kindstodes zugeschrieben, den zu betrauern und offiziell bekannt zu
machen, geschweige denn zu visualisieren oder rituell zu verabschieden, legitim
und angemessen wäre.
3.4
Wenn Entbinden (baldiges) Sterben bedeutet
Gebären bzw. Geborenwerden und Sterben sind gesellschaftlich gegensätzlich
performierte Übergänge. Im Falle einer Totgeburt oder bei infauster Prognose18
kollidieren beide.
17Ein
Beispiel dafür bietet auch Saras Mann, der vermittelt, auf diese Weise habe sich das
Problem einer erneuten Schwangerschaft ja „geklärt“.
18Infaust (lat. „ungünstig“) ist in der Medizin eine Prognose, wenn die Erkrankung als nicht
heilbar erachtet wird und mit konsekutivem Tod zu rechnen ist.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
151
Das folgende Zitat aus einem Trauerforum im Internet veranschaulicht
zunächst die Gleichzeitigkeit der Prozesse des Gebärens und Sterbens:
Ich war in der 23 ssw als das kleine Herz meiner kleinen Tochter A. aufhörte zu
schlagen. Das war am [Datum]. Zu dem Zeitpunkt begriff ich es noch nicht wirklich, dass meine kleine Tochter nun nicht mehr lebte.
Am [Datum, zwei Tage später] um [Zeit] hatte ich meine Stille Geburt, nachdem ich
bereits 1,5 Tage Tabletten zur Einleitung der Geburt bekommen hatte. Es war ein
Moment der gemischten Gefühle.
Ein schöner Moment, denn ich hatte alle Menschen um mich die ich liebe und ich
bekam meine kleine Prinzessin. Aber zugleich, besonders traurig, denn es war das
erste und letzte mal dass meine ich meine süße kleine Maus sehen und in den Arm
nehmen durfte.
Die Formulierung „ich hatte alle Menschen um mich die ich liebe“ verweist auf
eine Vorstellung vom „guten Sterben“. Stellvertretend für die Tochter befindet
sich die Schwangere im Kreise der Lieben, vergleichbar einer Sterbenden, inmitten nächster Angehöriger.19 Traditionelle Bilder von Geburt und Tod strukturieren
die Erzählung: So markiert der Moment des Herzstillstands der ungeborenen
Tochter deren Lebensende, das zunächst „noch nicht wirklich“ begriffen wird.
Fassungslosigkeit und fehlende Realisierung werden hier dem Tod als unbegreiflicher Tatsache zugeschrieben, nicht der Inwändigkeit oder körperlichen Ungewissheit der Ereignisse. Die „Stille Geburt“ wird als „Moment der gemischten
Gefühle“ beschrieben. Ihre Tochter zu bekommen, beschreibt sie als schöne Seite
des Moments – dies konstituiert sie auch als Mutter – während das Traurige in der
Abschiednahme liegt. Die Chronologie suggeriert eine Lebensgeschichte der tot
geborenen Tochter, die im Leben begrüßt und verabschiedet wird („das erste und
letzte mal“, nicht: das einzige Mal), die Sterbe- und Geburtsdaten, ein Geschlecht
und Charaktereigenschaften („süß“, „klein“), kurz: eine Identität und eine Biografie besitzt.
19Mit
der Lebensdauer steigt die Anzahl an Personen, die mit dem Kind interagiert haben.
Der Kreis der Angehörigen wächst. So beschrieb ein Paar in einer Selbsthilfegruppe die
Anteilnahme des Klinikpersonals am Tod ihrer vier Wochen alten, zu früh geborenen Tochter. Mitarbeitende der neonatalogischen Abteilung, das Paar nennt sie „die Familie“ ihrer
Tochter, seien zur Beerdigung gekommen und würden sich noch gelegentlich nach ihrem
Wohlbefinden erkundigen. Im anschließenden Gespräch mit einer von Schwangerschaftsverlust betroffenen Frau erklärt diese, wie schwer es ihr fiele, von solcher Anteilnahme zu
hören. Bei ihr sei das überhaupt nicht so gewesen, sondern „eine richtige Scheißerfahrung!
Ausschabung und fertig“.
�152
J. Böcker
In diesem Fall werden Geburt und Abschiednahme durch Chronologisierung
normalisiert. Im folgenden Kontrastbeispiel wird die fehlende Lebendigkeit zum
ursächlichen Kriterium misslingender Abschiednahme. Eine von einer Betroffenen 2009 gegründeten Initiative verbreitete online und in Kliniken einen sogenannten Leitfaden20, der betroffenen Eltern in Vorbereitung auf die anstehende
Entbindung ausgehändigt werden sollte. Anliegen war es, ihnen konkrete Hinweise für einen „guten Abschied“ an die Hand zu geben, der – so das implizite
Versprechen – später dabei helfen werde, den Verlust zu bewältigen. Ein Hinweis
lautet:
Überlegen Sie sich im Vorfeld, was mit dem Kind direkt nach der Geburt geschehen
soll. Wir empfehlen Ihnen, das Kind direkt in den Arm zu nehmen (vor allem bei
Lebendgeburten!), es zu sehen und zu halten. Haben Sie keine Angst davor, Ihr
Kind zu sehen. Es ist IHR Kind und wird genau so wie es ist schön und perfekt
aussehen, selbst wenn es schon einige Tage zuvor im Bauch verstorben sein sollte
(Herv. i. O.)!
Der Leitfaden reproduziert jene Delegitimierung, der er eigentlich etwas entgegensetzen will. Die „Lebendgeburt“21 symbolisiert hier die antizipierte offizielle
Anerkennung, ein Kind verloren zu haben, selbst wenn das Neugeborene kurz
darauf verstirbt und dann ebenso tot ist und fehlt wie das Totgeborene. So bleibt
die Statuszuschreibung einer Lebendgeburt als schlimmerer Verlust erhalten. Der
Zusatz „schön und perfekt (…), selbst wenn es schon einige Tage zuvor im Bauch
verstorben sein sollte“ (eig. Herv.), entspricht dieser Statuslogik, obwohl der Leitfaden jedem Verlust Anerkennung zollen möchte. Zudem werden hier Vorstellungen beginnender Verwesung und entsprechende Berührungsängste hervorgerufen.
Die betonte Warnung, „keine Angst“ davor zu haben, das Kind anzuschauen,
schürt Angst. Der Warnung liegt eine kritisierte (Laien-)Theorie der Trauer
zugrunde: nämlich dass es besser sei, das tote Kind gar nicht erst zu sehen oder
gar zu berühren. So war und ist es mitunter gängige Klinikpraxis, das Entbundene
sofort zu entfernen.
Im Leitfaden offenbart sich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem
medizinisch-klinischen System, das sich übersetzt in die Aufforderung, gegen
dessen Strukturen anzukämpfen. Die Angst einflößende Nachricht lautet: Das
20http://www.klinikaktion.de/leitfadeneltern.pdf.
Zugegriffen: 21. Dezember 2015.
sind solche „Lebendgeburten“, die nach infauster Prognose in absehbarer Zeit
versterben werden.
21Gemeint
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
153
Klinikpersonal wird gegen Ihre Wünsche und Bedürfnisse handeln, es ist Ihre
Aufgabe, gegen diese Entmachtung anzugehen. So heißt es weiter unten: „Versuchen Sie, so viele Erinnerungen wie möglich zu sammeln. Sie müssen für den
Rest Ihres Lebens reichen. Lassen Sie sich nicht drängen, nehmen Sie sich Zeit.
Bestehen Sie nötigenfalls darauf.“
Es wird deutlich, dass keine institutionalisierten Prozessierungen für Fehlgeburten oder Totgeburten bestehen, die diese aus dem Leben und die Frau am Ende
der werdenden Mutterschaft begleiten. Hier wird versucht, eine Abschiedspraktik
zu institutionalisieren. Auch im wissenschaftlichen Diskurs besteht die Tendenz,
zur Berührung und Auseinandersetzung mit dem tot geborenen Kind zu ermutigen, ohne Betroffene – wie im Leitfaden – unter Druck zu setzen (vgl. Warland
und Davis 2011). Denn nicht jede will und wird das Ereignis als Sterbefall prozessieren und erinnern.
4
Fazit
Prä- und perinatale Verlusterfahrungen sind von sozialen Uneindeutigkeiten
geprägt. Je weiter das Ungeborene entwickelt ist, desto eher wird dessen Verlust
medizinisch als Todesfall prozessiert und vom sozialen Umfeld als Verlust eines
Kindes behandelt. Die soziale Performierung eines Todes (in Form von Sterbebegleitung, Gefühlsnormierung oder Bestattungsrechten) und die Akzeptanz von
Trauer um diesen werden an den sterbenden bzw. toten Körper gekoppelt. Dieser bleibt bei pränatalem Verlust stets liminal und Aushandlungssache. Die konstruierte Verknüpfung von kindskörperlicher Entwicklung und Verlust beinhaltet
eine Trauerintensitätsnorm, welche – wie anhand empirischer Beispiele gezeigt
– mit subjektiven Verlustgefühlen und -intensitäten kollidieren kann. Ausdrucksform und Intensität der subjektiv empfundenen Trauer lassen sich nicht auf den
Verlustzeitpunkt in der Schwangerschaft zurückführen. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit wurde eine begriffliche und phänomenologische Strukturierung
des Forschungsgegenstands Verlusterleben und Trauer bei Fehl- und Totgeburt
anhand von Deutungs- und Handlungsambivalenzen vorgeschlagen.
Vier leib-körperbedingte Uneindeutigkeiten wurden behandelt. Die erste ist
der Inwändigkeit des Sterbens geschuldet. Der Sterbeverlauf des Ungeborenen
wird auf Basis wahrgenommener Empfindungen oder ärztlich festgestellter Veränderungen des Körpers gedeutet. So kann aus mutteridentitärer Sicht sowohl
in der 7. SSW bestürzen, den Todeszeitpunkt nicht gespürt zu haben, als auch
das bewusst wahrgenommene Versterben des Ungeborenen in der 22. SSW als
�154
J. Böcker
Erleichterung empfunden werden. Die Uneindeutigkeit besteht im ungewissen
Schluss leiblicher Empfindung auf den kindlichen Zustand (der zudem mit ärztlichen Aussagen konkurrieren kann), das Problematische im akuten Deutungszwang sowie der – aus Subjektperspektive – Missdeutung konkreter Ereignisse,
die erst im Nachhinein als Sterben und Verlieren gedeutet werden. Die zweite
körperbedingte Uneindeutigkeit ist bei unsichtbaren Verlusten gegeben, wenn
also Schwangerschaften vorerst unbemerkt zu Ende gehen oder, weiter gefasst,
kein kindlicher Körper (mehr) vorhanden ist, der Verlust aber als der eines nun
fehlenden Kindes empfunden und betrauert wird. Die Intensität des empfundenen
Verlusts kollidiert mit gesellschaftlichen Trauerintensitätsnormen, die von den
Betroffenen verinnerlicht sind. Drittens kam die Liminalität des kindlichen Körpers und der Frau inmitten des Übergangs zur sozialen Mutterschaft in den Blick.
Es wurden die Kopplung von leiblichem und sozialem Prozess des Werdens während der Schwangerschaft und deren problematische Inkongruenz im Verlustfall
diskutiert. Daran anschließend wurde viertens die zeitliche Kongruenz von Gebären und Sterben thematisiert, zwei gesellschaftlich gegensätzlich performierte
Übergänge. Ist beispielsweise das Ungeborene bereits im Mutterleib verstorben,
gehen mit der physiologischen Entbindung nicht die sozialen Prozesse einher,
geboren zu werden und Mutter zu werden. Es existieren keine institutionalisierten
Prozessierungen für Fehlgeburten oder Totgeburten, die diese aus dem Leben und
die Frau am Ende der werdenden Mutterschaft begleiten.
Literatur
Aeternitas e.V. Verbraucherinitiative Bestattungskultur (2012). http://www.aeternitas.de/
inhalt/recht/themen/artikel/2012_05_15__03_56_19. Zugegriffen: 10. Dezember 2015.
Alberti, B. (2012). Die Seele fühlt von Anfang an. Wie pränatale Erfahrungen unsere
Beziehungsfähigkeit prägen. 6. Aufl. München: Kösel.
Böcker, J. (2015). Kein Tod ohne Leben. Zu Krisen des Trauerns nach Fehl- und Totgeburt.
In M. Endreß (Hrsg.), Routinen der Krise – Krise der Routinen. Verhandlungen des 37.
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Trier. Open Access http://publikationen.soziologie.de/index.php/kongressband/article/view/158/pdf_89. Zugegriffen:
23. Juni 2016.
Böhner, S., & Zirfas, J. (2012). Die Bildung der Trauer. Eine pädagogisch-anthropologische Betrachtung. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 15(1), 125–141.
Bonnette, S., & Broom, A. (2011). On grief, fathering and the male role in men’s accounts
of stillbirth. Journal of Sociology. The Australian Sociological Association 48(3),
248–265.
Cecil, R. (Hrsg.). (1996). The anthropology of pregnancy loss. Comparative studies in miscarriage, stillbirth, and neonatal death. Oxford/Washington: Berg Publishers.
�Inwändig, unsichtbar, liminal. Ambivalenzen pränataler Verluste
155
Doka, K. J. (Hrsg.). (2002). Disenfranchised grief. Champaign: Research Press.
Doka, K. J. (2014). Entrechtete Trauer. In D. Bürgi & C. Metz (Hrsg.), Leid im Abseits –
Aberkannte und nicht gesehene Trauer. Leidfaden 3 (S. 4). Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.
Duden, B. (2002). Zwischen ‚wahrem Wissen‘ und Prophetie. Konzeptionen des Ungeborenen. In B. Duden, J. Schlumbohm & P. Veit (Hrsg.), Geschichte des Ungeborenen. Zur
Erfahrungs- und Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft, 17.-20. Jahrhundert,
Bd. 170 (S. 11–48). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Equit, C., & Hohage, C. (Hrsg.). (2016). Handbuch Grounded Theory. Von der Methodologie zur Forschungspraxis. Weinheim: Beltz Juventa.
Frost, J., Bradley, H., Levitas, R, Smith, L., & Garcia, J. (2007). The loss of possibility:
scientisation of death and the special case of early miscarriage. Sociology of Health &
Illness 29(7), 1003–1022.
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE Bund) (2015). Totgeburten. https://www.
gbe-bund.de/stichworte/TOTGEBURTEN.html. Zugegriffen: 30. Mai 2015.
Hahn, A. (1968). Einstellungen zum Tod und ihre soziale Bedingtheit. Eine soziologische
Untersuchung. Stuttgart: Kohlhammer.
Hahn, A. (2002). Tod und Sterben in soziologischer Sicht. In J. Assmann & R. Trauzettel
(Hrsg.), Tod, Jenseits und Identität. Perspektiven einer kulturwissenschaftlichen Thanatologie (S. 55–89). Freiburg/München: Karl Alber.
Heimerl, B. (2013). Die Ultraschallsprechstunde. Eine Ethnografie pränataldiagnostischer
Situationen. Bielefeld: Transcript.
Hirschauer, S., Heimerl, B., Hoffmann, A., & Hofmann, P. (2014). Soziologie der Schwangerschaft. Explorationen pränataler Sozialität. (Qualitative Soziologie, Bd. 19). Stuttgart: Lucius & Lucius.
Hertz, R. (2007 [1907]): Beitrag zur Untersuchung der kollektiven Repräsentationen des
Todes. In S. Moebius & C. Papilloud (Hrsg.), Robert Hertz. Das Sakrale, die Sünde
und der Tod. Religions-, kultur- und wissenssoziologische Untersuchungen (S. 65–179).
Konstanz: UVK.
Jakoby, N. (2012). Trauer als Forschungsgegenstand der Emotionssoziologie. In A. Schnabel & R. Schützeichel (Hrsg.), Emotionen, Sozialstruktur und Moderne (S. 407–424).
Wiesbaden: VS.
Jakoby, N., Haslinger, J., & Gross, C. (2013). Trauernormen. Historische und gegenwärtige
Perspektiven. SWS-Rundschau 53(3), 253–274.
Kaufman, S. R., & Morgan, L. M. (Hrsg.). (2005). The Anthropology of the Beginnings
and Ends of Life. Annual Review of Anthropology 34, 317–341.
Plessner, H. (1975 [1928]). Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die
philosophische Anthropologie. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Prosser, M. (2005). Friedhöfe eines ‚unzeitigen Todes‘. Tot geborene Kinder und das Problem ihres Bestattungsortes. In N. Fischer & M. Herzog (Hrsg.), Nekropolis. Der Friedhof als Ort der Toten und der Lebenden (S. 125–146). (Irseer Dialoge 10). Stuttgart:
Kohlhammer.
Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch.
4. erw. Aufl. München: Oldenbourg.
Sänger, E., Dörr, A., Scheunemann, J., & Treusch, P. (2013). Embodying Schwangerschaft.
Pränatales Eltern-Werden im Kontext medizinischer Risikodiskurse und Geschlechternormen. Gender 1, 56–71.
�156
J. Böcker
Scheper-Hughes, N. (2004). Death Without Weeping. In A. C. G. M. Robben (Hrsg.),
Death, mourning, and burial: A cross-cultural reader (S. 179–193). Malden, MA:
Blackwell Pub.
Schütz, A. (1932). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien: Springer.
Schütze, Y. (1986). Die gute Mutter. Zur Geschichte des normativen Musters ‚Mutterliebe‘.
Schriftenreihe des Instituts Frau und Gesellschaft. Hannover: Kleine.
Strauss, A. (1998). Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen und soziologischen Forschung. München: Fink.
Turner, V. (1989). Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt a.M.: Campus.
Warland, J., & Davis, D. L. (2011). Caring for families experiencing stillbirth. A unified
position statement on contact with the baby. An international collaboration. http://missfoundation.org/news/StillbirthContactwBaby_position_statement.pdf. Zugegriffen: 12.
Dezember 2015.
Weaver-Hightower, M. B. (2012). Waltzing Matilda. An Autoethnography of a Father’s
Stillbirth. Journal of Contemporary Ethnography 41(4), 462–491.
Winkel, H. (2008). Trauer als Biografiegenerator. Forum Qualitative Sozialforschung/
Forum: Qualitative Social Research 9(1), Art. 50 [42 Absätze].
Über die Autorin
Böcker, Julia, M.A. Magisterstudium der Kulturwissenschaften, Indologie und
Psychologie an der Universität Leipzig. Seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie und Kulturorganisation an der Leuphana Universität Lüneburg. Lehr- und Forschungsschwerpunkte: Kultursoziologie, Qualitative
Methoden und Methodologie, Tod und Trauer.
�
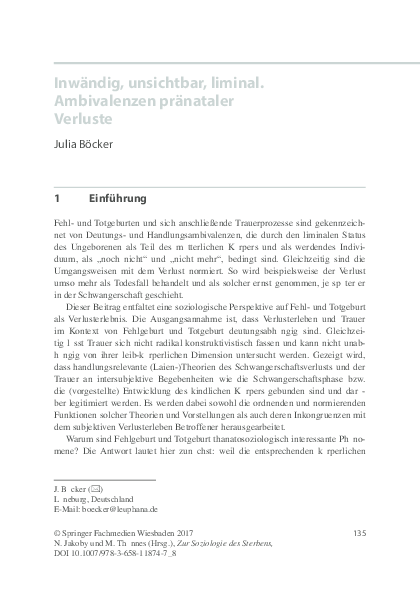
 Julia Böcker
Julia Böcker