Martin Kirves
Das Ornament als
Erkenntnisform
Die Entwurfstheorie der South Kensington School
Erschienen 2019 auf ART-Dok
URN: urn:nbn:de:bsz:16-artdok-65755
URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2019/6575
DOI: 10.11588/artdok.00006575
�Ornament als Erkenntnisform
Die epistemische Entwurfstheorie der South Kensington School
Knowledge is the great source of Ornament
Christopher Dresser
Martin Kirves
4
5
�Inhalt
I. Räumliche Flatness
4
II. Die Verselbständigung des Ornaments
18
III. Architektonische Transparenz und ornamentaler Exzess
24
IV. Das institutionalisierte Ornament
28
V. Die kulturelle Natur des Ornaments
34
VI. Die grammatische Struktur des Ornaments
45
VII. Die botanische Natur des Ornaments
51
VIII. Die Poetik des Ornaments
57
6
7
�I. Räumliche Flatness
Gemäß seiner traditionellen Bestimmung als Dekorum kommt dem Ornament
keine autonome semantische Dimension zu, die unabhängig von dem ihm über‐
geordneten Werk, dessen dekorativer Teil es ist, Bestand hätte. Um das Ornament
als eigenständige Erkenntnisform zu perspektivieren, ist es daher zunächst
erforderlich, sein anschauliches Potenzial zu untersuchen, in welches sich ein
genuin ornamental vermitteltes Wissen einzulagern vermag. Aus diesem Grund
eröffnen wir die Betrachtung mit einer kleinen Phänomenologie des ornamentalen
Raums, die wir anhand unseres zentralen Untersuchungsgegenstandes entwickeln
werden.1
Betrachten wir die erste Abbildung, wird unser Blick von dem freigesetzten
Bewegungspotenzial der Formenkonfigurationen ergriffen. Dabei schließen sich die
einzelnen Elemente zu Wirbelmotiven zusammen, die sich aus der Ebene hervor‐
zuwölben und das Muster über sich selbst hinauszutreiben scheinen, wie es
insbesondere am weißen Kranz der oberen Umschlagbewegung zu beobachten ist.
Zugleich verbinden sich die Binnenfüllungen der hochzüngelnden Motive jedoch
mit dem insgesamt als Fond wirkenden Weiß, wodurch die sich vom Grund
loslösenden figurativen Strukturen an den Grund zurückgebunden werden. Dieses
Prinzip der figuralen Aktivierung des Grundes bestimmt die gesamte Musterstruk‐
tur und wird durch eine Alternation farbiger und weißer Kompartimente ermög‐
licht, denen das Potenzial als Teil des Grundes oder Teil der Figur zu fungieren
zukommt. Die vermittels der konkreten Ausformung und Anordnung der Kompar‐
timente erfolgende Ausrichtung dieser Potenzialität bewirkt, dass sich auf der
Ebene der kleinsten Motiveinheiten das dominierende Figur‐Grund‐Verhältnis
umkehrt: Die weißen Kompartimente gewinnen figurale Prägnanz, während die
farbigen, sich zur Fläche zusammenschließend, den Grund bilden. Die derart
innerhalb der Binnenstrukturen als Fond fungierenden Farbflächen geben aber
Die folgenden Überlegungen sind Teil eines laufenden Projekts und haben daher, was die
verwendeten Begrifflichkeiten betrifft, einen vorläufigen, eher heuristischen als systematischen
Charakter. Auch werden, insbesondere im letzten Teil, Aspekte nur angeschnitten, die einer
weiteren Ausführung bedürfen. Ebenfalls in einer bewusst abkürzenden Weise wurden die aus der
dargelegten Ornamenttheorie hervorgehenden kunstmethodischen Abzweigungen angezeigt.
1
4
1. Christopher Dresser, Knowledge is Power, 1862.
5
�wiederum jene Makroformen vor, die ihrerseits auf einem weißen Grund zu liegen
scheinen.
Die Figur‐Grund‐Relation, die sich durch eine Differenz zweier Ebenen konsti‐
tuiert, wird folglich keineswegs durch das Ineinssetzen dieser Ebenen nivelliert,
vielmehr aktualisiert sie sich innerhalb eines komplexen Wechselverhältnisses
immer wieder neu, wobei der Grund gleichsam vor die Figur und die Figur hinter
den Grund zu treten vermag. Hieraus resultiert die fluktuierende Lebendigkeit,
welche den semantischen Fokus des Musters ausmacht.
Um die vermittels des zeitlich indizierten Figur‐Grund‐Umkehrungsgeschehens
entstehende Räumlichkeit näher zu bestimmen, ziehen wir zur Kontrastierung im
Folgenden Vergleichsbeispiele heran, um den ornamentalen Raum gemäß seiner
konstellativen Möglichkeiten zu durchmessen. Da die fragliche Räumlichkeit
prinzipiell der Logik der Figur‐Grund‐Relation folgt, wird zu ihrer Bestimmung die
jeweilige Verfasstheit der Zwischenräumlichkeit ausschlaggebend sein. Zwischen‐
raum meint hier sowohl einen Modus des Hintereinander wie des Nebeneinander.
Ersteres, insofern die Figur‐Grund‐Relation per definitionem ihre Relate in ein
tiefenräumliches Verhältnis zueinander setzt; Letzteres, da sich ein Figur‐Grund‐
Verhältnis nur zu etablieren vermag, wenn die Figur den Grund durch ihre im
Modus des Nebeneinander formierten Zwischenräume freigibt. Indem es aber der
Grund ist, der die vor ihm liegende Ebene als Figur ausweist und der Grund einzig
durch die Zwischenräume der Figur Präsenz gewinnt, gibt die Figur nicht allein den
Grund durch ihre Zwischenräume frei; sie wird überhaupt erst durch die zwischen‐
räumlich organisierte Logik des Nebeneinander konstituiert. Für den Grund
hingegen gilt gerade umgekehrt, dass er keinerlei Zwischenräume aufweisen darf,
um sich nicht selbst als etwas vor einem Grund Liegendes zu setzen. Hieraus folgt
allerdings nicht, dass der Grund notwendigerweise eine homogene Struktur
aufzuweisen hätte. Die Ebenen der Figur und des Grundes können sogar – wie wir
sehen werden – ihrerseits eine räumliche Extension aufweisen, ohne dabei das für
die Figur‐Grund‐Relation konstitutive Differenzverhältnis aufzugeben.
Beide in ihrem internen Zusammenhang den ornamentalen Raum konstituie‐
renden Aspekte – das tiefenräumliche Verhältnis verschiedener im Modus des
6
Nebeneinander strukturierter Ebenen – ist keineswegs hinreichend, um eine
Bestimmung des Ornaments vorzunehmen, da weder eine systematische Abgren‐
zung zur Schrift noch zum Bild allein raumlogisch möglich ist. Weder die Schrift, bei
der das Nebeneinander dominiert, noch das Bild, bei dem das Hintereinander
bestimmend ist, schließen die zu untersuchende ornamentale Figur‐Grund‐Relation
kategorial aus. Vielmehr partizipieren sie an dieser, wodurch dem Ornament
bereits in raumlogischer Hinsicht die Rolle eines vermittelnden Modus zwischen
Schrift und Bild zuwächst. Auch wenn Schrift, Ornament und Bild in dieser Hinsicht
in einem graduellen Kontinuitätsverhältnis zueinander stehen, lassen sich inner‐
halb dieser Kontinuität dennoch qualitative, sie voneinander separierende Sprünge
markieren, die im Anschluss an den Gang durch den ornamentalen Raum zu
entwickeln wären.
Nehmen wir zur Bestimmung des innerornamentalen Raums also weitere konk‐
rete Typen ornamentaler Räumlichkeit in den Blick, um sie hinsichtlich ihrer
spezifischen zwiefachen zwischenräumlichen Verhältnisse zu untersuchen.
Hatten wir hinsichtlich des betrachteten Musters beobachtet, dass die Figur‐Grund‐
Relation keineswegs eingeebnet wird, artikuliert sich die Figuration andererseits
ebenso wenig vor dem Grund, indem sie sich durch ein In‐Differenz‐Setzen zum
Grund als vom Grund unabhängige Figur etablierte, wie dies auf dem der Grammar
of Japanese Ornament and Design (1889) Thomas W. Cutlers entnommenem
Beispiel der Fall ist (Abb. 2). Hier drängt die vermittels einer kontinuierlichen
Selbstartikulation der Figuration initiierte Abstoßungsbewegung vom Grund den
Grund zurück. Indem sich die Figuration derart in einer Selbstausdifferenzierungs‐
bewegung vor dem Grund entfaltet, konstituiert sie sich als eine unabhängige
Sphäre, die ontologisch in qualitativer Weise vom Grund geschieden ist. Als ihr
autopoetisches Prinzip exekutierende Entität erfährt die Figuration eine Substan‐
zialisierung, während der Grund, der einzig die indefinite Artikulationsfläche der
Figuration bereitstellt, ontologisch diffundiert. Hier bildet der Grund keine
eigenstände mit der Figuration korrespondierende Entität, womit eine ontologische
Symmetrie zur Figur gegeben wäre, die es erlaubte, dass der Grund Teil der
Figuration zu werden vermag und – wie beim vorherigen Beispiel – die
7
�durch die Zwischenräume der Figuration scheinend, vordergründig präsent wird.
Damit wächst der im Modus des Nebeneiander organisierten Zwischenräumlichkeit
das Primat zu, obwohl auch das tiefenräumliche Hintereinander phänomenal in
Erscheinung tritt, indem die Figuration vor dem Grund zu schweben scheint.
Unmittelbar augenfällig wird das Schweben, sobald Figur und Grund eine andere
Einfärbung erhalten (Abb. 3).
Der übliche Schwarz‐weiß‐Kontrast für Darstellungssysteme wie die Schrift, bei
der es, um sie als Schrift zu realisieren, auf eine Nivellierung der Tiefenräumlichkeit
zugunsten des Gewahrens des zwischenräumlichen Nebeneinanders ankommt –
was die Sehgewohnheit automatisch praktiziert –, eliminiert die stets mitgegebene
Tiefenräumlichkeit, die dennoch auch im Fall der Schrift stets latent vorhanden ist.
Daher kaprizieren sich Ansätze, welche Bildlichkeit mit der idealen Flächigkeit des
Bildträgers identifizieren, um das Bild als eine der (Zwischenraum‐)Logik der
Fläche folgende Entität zu definieren, auf eben jene Darstellungsformen, für welche
2. Thomas W. Cutler, A Grammar of Japanese
Ornament and Design, 1889, Plate 58.
3. dass. farblich modifiziert
autogenetische Bewegung der Figuration durch das Figur‐Grund‐Verhältnis selbst
initiiert würde.
Da die im zweiten Beispiel hinzugewonnene ‚Substanzialität‘ auf der Ebene der
Figuration jedoch keine ihren ontologischen Status sichernde Eigenräumlichkeit
aufweist, wird die Figur‐Grund‐Symmetrie trotz der durch die verschiedenen
paradigmatisch das Diagramm einstehen mag, bei denen, um das Dargestellte ‚zu
lesen‘, automatisch die optische Nivellierung der phänomenal stets mitgegebenen
tiefenräumlichen Dimension vollzogen wird.2 Solches Absehen von der materialiter
zwar an die Fläche gebundenen, mit dieser aber keineswegs identischen Tiefen‐
räumlichkeit belegt, dass diese Bestimmung der Bildlichkeit einem versteckten
Logozentrismus folgt.
Die in der Flachheit implizite Räumlichkeit entfaltet sich, wenn aus den Figura‐
tionen Figuren werden, die eine eigenräumliche Extension aufweisen, wie dies
beim dritten Beispiel, der Ornament‐Grotteske Jean Bérains der Fall ist (Abb. 4). Die
Seinsweisen von Figur und Grund gegebenen Asymmetrie optisch restituiert,
Eigenräumlichkeit der im Vergleich zum japanischen Ornament zu plastischen
Treten überhaupt erst durch den Grund als eine mit der Figuration kontrastierende
Kontrastfläche. Die tiefenräumliche Dimension ist nun nicht mehr als ein die Relate
woran beide Relate gleichermaßen Anteil haben: Artikuliert sich die Figuration
auch als ontologisch unabhängige Sphäre vor dem Grund, wird ihr In‐Erscheinung‐
Gebilden gewordenen ornamentalen Entitäten negiert den Grund nicht nur
ontologisch als etwas ihr gegenüber Substanzloses, sondern auch als optische
Fläche ermöglicht. Damit ‚materialisiert‘ sich der ontologisch diffundierende Grund
Figur und Grund auf Distanz haltender Zwischenraum gegeben, vor dem die
Pendant angezogen. Diese doppelte Verfestigung des Grundes zur Fläche erzeugt
2
zur opaken Fläche, von der sich die Figuration klar und deutlich abhebt. Zugleich
wird der Grund seitens der raumlosen Flachheit der Figuration als ihr optisches
einen die Prägnanz der Figuration herstellenden Kontrast, bei dem der Grund,
8
Vgl. dazu: Sybille Krämer: ‚Operationsraum Schrift‘. Über einen Perspektivenwechsel in der
Betrachtung der Schrift. In: Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine. Hrsg. v.
Gernot Grube, Werner Kogge und Sybille Krämer, München 2005, S. 23‐57.
9
�Figuration ‚schwebt‘. Das Nebeneinander der figurativen Ebene ist durch das
Hinter‐ und Ineinander der bildgegenständlichen Ornamente zu einem eigenen
Tiefenraum erweitert worden, dessen infiniten Grenzbereich der Grund markiert.3
Da die Figuren keinen Schatten auf den Grund werfen, wird er allerdings gerade
durch den ontologischen Kontrast mit der Gegenständlichkeit der Ornamentik als
immaterielle Fläche restituiert, wodurch die Figur‐Grund‐Differenz als solche
gesichert wird. War das vorherige Beispiel durch eine ontologische Asymmetrie
und eine optische Symmetrie gekennzeichnet, liegt hier eine sowohl ontologische
wie optische Asymmetrie vor.
Wird der Grund schließlich als Hintergrund einer durch die Eigenräumlichkeit
der Bildgegenstände evozierten Räumlichkeit definit, erscheinen die Bildgegens‐
tände innerhalb eines sie umgebenden, keineswegs notwendigerweise zentralpers‐
pektivisch aufgebauten Stellraums. Damit ist der ornamentale Raum zum konven‐
tionellen Bildraum, der Grund zum Hintergrund geworden, dessen konkret
gegenständliche
Ausformung
optisch
wie
ontologisch
von
derselben
tiefenräumlichen Qualität wie die Bildgegenstände ist, die nunmehr keine explizite
sich von einem Grund abhebende ornamentale Figuration ausbilden. Die räumliche
Extension der differenten Ebenen Figur und Grund haben sich zu einem homoge‐
nen Raumgefüge zusammengeschlossen, welches den Figur und Grund trennenden
Zwischenraum aufhebt und alle im Bild gegebenen Entitäten gleichermaßen in sich
fasst. Innerhalb dieses Raumgefüges vermag die Figur‐Grund‐Relation einzig
indirekt als ornamentales Verhältnis präsent zu werden, indem die figürlichen
Motive in ihrer spezifischen Anordnung eine die Eigenräumlichkeit reduzierende
figurative Konstellation ausbilden, die sich von dem sie umgebenden, nun als Grund
fungierenden Raummilieu abhebt und auf diese Weise dezidiert gegen die Stell‐
raumlogik opponiert. Solche ornamentalen Kompositionsmuster informieren als
Infrastruktur der Darstellung zwar unterschwellig den Blick; sie müssen aber erst
durch einen bewussten, den Bildraum negierenden Sehakt entdeckt werden, wie es
4. Jean Bérain, Ornament‐Grotteske, um 1690.
10
Dieser „undefinierte Raum“, wie ihn Friedrich Piel begrifflich fasst, „ist – vom Ornament her
gesehen –nicht mehr als ursprüngliches Relat zu fassen “, weshalb die Relation als solche mehr
und mehr verloren gehe (Friedrich Piel: Die Ornament‐Grotteske in der italienischen Renaissance.
Zu ihrer kategorialen Struktur und Entstehung, Berlin 1962, S. 36).
3
11
�die ornamentale Figurenanordnung des Portinari‐Alatrs von Hugo van der Goes
beispielhaft veranschaulicht (Abb. 5).4 Erst auf den zweiten, den Stellraum
durchkreuzenden Blick zeigen sich die Bildfiguren als eine das Jesuskind heiligen‐
scheinartig umschließende Figuration.
Der visuell mitgegebene und dennoch erst zu entdeckende ornamentale Aspekt
entlarvt nicht den ‚illusionären Charakter‘ des Bildes, sondern erweitert sein
semantisches Potenzial, welcher konkreter Gehalt damit auch immer verbunden
sein mag. Insbesondere in der Moderne gewinnt dieser Aspekt immer größere
Relevanz, so dass er – man denke nur an Matisse oder Hodler5 – den Stellraum
ornamental zu rekonfigurieren beginnt.
Fällt auch die implizite Ornamentalität weg, weist der Stellraum hinsichtlich der
Figur‐Grund‐Beziehung eine Affinität zum lebensweltlichen Erfahrungsraum auf.
Hier wie dort sind Figur‐Grund‐Relationen gegeben, doch ist die Grenzziehung
zwischen Figur und Grund einem letztlich willkürlichen Akt unterworfen. Besteht
doch der Grund in diesem Fall zumeist aus einer Ansammlung figürlicher Entitäten,
5. Hugo van der Goes, Portinari Altar, um 1475.
umgebenden Raummilieu heraus, so dass sich der figürlich strukturierte
Umgebungsraum zu einer Art visuellem Grund zusammenzieht. Anders verhält es
die ihrerseits in einer tiefenräumlichen Relation zueinander stehen. Erst der
Aufmerksamkeitsfokus hebt von sich aus einen Gegenstand als Figur aus dem es
Theodor Hetzer, der die ornamentale Formierung der Bildfiguren als ein die Bildeinheit
stiftendes Kompositionsprinzip aufgezeigt hat, fasst diese Form der Ornamentalität als „das
Ornamentale, das sich nicht zum Ornament objektiviert“ (Theodor Hetzer: Das deutsche Element
in der italienischen Malerei des 16. Jahrhunderts. In: ders.: Das Ornamentale und die Gestalt,
Stuttgart 1978, S. 15‐286, hier S. 48). Otto Pächt hat solche Motivzusammenhänge in ihrer
„Doppelwertigkeit“ als einerseits raumdarstellende, andererseits Bildmuster erzeugende Größen
untersucht (Otto Pächt: Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des 15. Jahrhunderts. In:
ders.: Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften, München 1977, S. 17‐
58). Zu den bildtheoretischen Konzepten von Hetzer und Pächt siehe: Martin Dobbe: Das
Ornamentale als bildtheoretisches Konzept? In: Ornament. Motiv – Modus – Bild. Hrsg. v. Vera
Beyer u. Christian Spies, München 2012, S. 316‐347. Einen Nachvollzug der qua abgebildeter
Ornamentik aufscheinenden Infrastruktur des Bildes entwickelt Vera Beyer: Unding Ornament?
Abgebildete Vorhänge zwischen Ornament und Figur in der niederländischen Malerei des 15.
Jahrhuderts. In: ebd., S. 27‐57.
5 Vgl. dazu: Gottfried Boehm: Ausdruck und Dekoration. Matisse auf dem Weg zu sich selbst. In:
Matisse. Figur. Farbe. Raum. Hrsg. v. Pia Müller‐Tamm, Ostfildern‐Ruit 2005, S. 277‐289 und Oskar
Bätschmann: Realismus im Ornament. Ferdinand Hodlers Prinzip der Einheit. In: Ferdinand
Hodler. Eine symbolistische Vision. Hrsg. v. Katharina Schmidt, Ostfildern 2008, S. 19‐33.
4
12
sich innerhalb des ornamentalen Raums, der gerade dadurch konstituiert wird,
dass der Grund nicht erst durch einen Akt der Aufmerksamkeit als solcher gesetzt
wird, sondern einzig als Grund und nicht anders wahrgenommen werden kann.
Damit legt der ornamentale Raum, im Unterschied zu bildlichem Stellraum und
innerweltlichem Erfahrungsraum, seine Wahrnehmung eindeutig fest.
Die absolvierte kursorische Betrachtung verdeutlicht hinreichend, dass die
flatness zwar den konventionellen Bildraum, aber keineswegs die Bildräumlichkeit
als solche negiert.6 Vielmehr generiert gerade die Raumreduktion neue Raumquali‐
täten, die durch spezifische Figur‐Grund‐Verhältnisse ornamental verfasste Räume
Bereits der ‚geistige Vater‘ der flatness, Clement Greenberg, hebt daher hervor: „The flatness
towards which Modernists painting orients itself can never be utter flatness. [...] The first mark
made on a surface destroys its virtual flatness [...]“ (Clement Greenberg: Modernist Art. In: Charles
Harrison; Paul Wood: Art in Theory. 1900‐1990. An Anthology of Changing Ideas, 1992, S. 754‐
760, hier S. 758).
6
13
�erzeugen. Um die dabei stets virulente räumliche Dimension anzuzeigen, sollte –
Greenberg folgend – generell von Flachheit, nicht von Flächigkeit gesprochen
werden, bezeichnet doch ‚Flachheit‘ einen räumlichen Modus, während ‚Flächigkeit‘
eine der räumlichen Dreidimensionalität entgegengesetzte Zweidimensionalität
meint.
Lassen wir zur Charaktersierung der einzelnen ornamentalen Raumstufen
nochmals, nun in der Gegenrichtung, die sukzessive Raumreduktion Revue
passieren. Der klassische Stellraum kann insofern mit Newton als ‚absoluter Raum‘
bezeichnet werden, da er ‚von sich aus‘ die in ihm erscheinenden Gegenstände
positioniert und damit die perspektivische Gegebenheit der Dinge festlegt.
Innerhalb eines solchen Raumes können, abgesehen von der angedeuteten
ornamentalen Verfestigung einzelner Motivverbünde, Ornamente oder Muster als
dargestellte Gegenstände vorkommen, denen motivintern zwar eine eigene
räumliche Struktur zukommt, die allerdings nicht bildraumbestimmend ist. Anders
verhält es sich, wenn, wie angedeutet, die ornamentale Raumlogik in der Moderne
auf den Bildraum als solchen ausgreift und den Stellraum in ein von der Figur‐
Grund‐Relation getragenes ornamentales Spannungsverhältnis versetzt.7
Mit der Bérain‐Grotteske ist innerhalb unserer Beispielreihe der ornamentale
Bildraum eröffnet, der in Abgrenzung zum Stellraum durch die Konstellation der
Bildgegenstände generiert wird und daher, im Anschluss an Leibniz, als ‚relationa‐
ler Raum‘ gefasst werden könnte. Dabei tritt zum Gefüge der sich zu Figurationen
zusammenschließenden Bildgegenstände das kontrastierende Relat des Bildgrun‐
als Teil der Figuration auch derselbe ontologische Status, ohne dass Figur und
Grund – wie beim Stellraum – dadurch als solche indifferent würden.
Insgesamt lässt sich für den Wandel vom konventionellen Bildraum zum orna‐
mentalen Binnenraum folgendes Verhältnis feststellen: Die mit der Reduktion der
Räumlichkeit zur Flachheit erfolgende stufenweise Entsubstanzialisierung der
Bildfiguren bewirkt ihre Neusetzung als ornamentale Figurationen, wobei im
Gegenzug der Bildgrund zunächst optisch und dann ontologisch an Substanz
gewinnt.8 In dieser substanziellen Aufwertung des Grundes liegt die Affinität der
modernen Malerei zu Ornament und Muster begründet, ohne dass die Bilder
dadurch raumlogisch oder semantisch flach wären.9
Die Grenzen des durch die differenten Figur‐Grund‐Relation erzeugten orna‐
mentalen Raums sind dann erreicht, wenn entweder die Figur‐Grund‐Ebenen
zugunsten der Raumhomogenität des konventionellen Bildraums aufgehoben
werden oder die differenten Ebenen Figur und Grund durch eine Negation des
tiefräumlich ausgerichteten Zwischenraums nivelliert werden und der ornamentale
Raum zum bloßen Muster wird, wie dies beim Schachbrettmuster der Fall ist. Um
die Figur‐Grund‐Relation und damit die binnenräumliche Extension des ornamen‐
talen Raums zu gewährleisten, müssen Figur und Grund phänomenal als etwas
Differentes gegeben sein. Daher stellt die ‚Intelligibilität des Grundes‘ für Edgar
Allen Poe das Qualitätsmerkmal jeglicher Flächendekoration dar.10
An einer Analyse dieser Raumstruktur anhand der Werke französischer Modernisten arbeitet
Martin Sundberg.
8 Diese Verhältnisbestimmung ist Reformulierung des von Carl Nordenfalk aufgestellten
„allgemeinen Strukturgesetzes“, dass „die relative Gegenständlichkeit eines ornamentalen Musters
und seine relative Bindung an die materielle Grundfläche in umgekehrtem Verhältnis zueinander
stehen“ (Carl Nordenfalk: Bemerkungen zur Entstehung des Akanthusornaments. In: Acta
Archaeologica 5, 1934, S. 257‐265, hier S. 262).
9 Um die Logik der modernistischen Malerei zu erfassen, ergänzt Rosalind Krauss die Kategorien
‚Figur‘ und ‚Grund‘ um ihre Negate ‚Nicht‐Figur‘ und ‚Nicht‐Grund‘, wobei die modernistische
Malerei den Grund zum Nicht‐Grund negiere, und ihn dadurch zu einer mit dem Vordergrund
zusammenfallenden Figur werden lasse (Rosalind E. Krauss: The Optical Unconscious, Cambridge
1993, S. 16). Damit ist die Figur‐Grund‐Differenz dialektisch aufgehoben, obwohl gerade die zur
Plausibilisierung herangezogenen Bilder Mondrians ihre Spannung aus dem Vorhandensein der
zugleich raumnegierenden wie raumbildenden Figur‐Grund Differenz beziehen.
10 Edgar Allan Poe: Philosophy of Furniture. In: The Complete Works of Edgar Allan Poe, Bd. 10:
Miscellany, New York ‐ London 1900, S. 44‐53, hier S. 47 f.
14
15
des hinzu. Diesem wächst beim japanischen Muster selbst eine raumgenerierende
Relevanz zu, indem die fehlende Eigenräumlichkeit der Figuration den diffusen
Raumgrund zur Fläche materialisiert, vor der die Figuration als zwischenräumlich
getrennte Entität erscheint. Beim zuerst betrachteten Muster wird eben dieser
Zwischenraum aktiviert, indem die Figuration nicht vor, sondern mit und durch den
Grund formiert wird. Innerhalb dieses ornamentalen Inversionsraumes kommt
dem Grund nicht allein dieselbe optische Qualität wie der Figuration zu; ihm eignet
7
�Vor dem Hintergrund der vom konventionellen Bildraum zum bloßen Muster
der Entweder‐Oder‐Logik widerspricht. Der eine Aspekt wird nicht, wie beim Hase‐
schehen erzeugt wird, bei dem sich die Relate Figur und Grund wechselseitig
wie raum‐, sowohl bewegungs‐ wie simultanitätsbildend, wobei beide Aspekte
führenden Reihung stellt das zuerst betrachtete Muster den Kulminationspunkt des
ornamentalen Raums dar, dessen spezifische Räumlichkeit durch ein Inversionsge‐
immer wieder anders positionieren. Dieser sich stets neu konfigurierende Flächen‐
raum ist folglich durch eine spezifische Zeitlichkeit bestimmt, die durch einen
neuerlichen Blick auf das Muster näher gefasst werden soll (Abb. 1).
Die figurativen Formationen entfalten sich fächerartig als Abfolge von Mikroflä‐
chen, die klar und deutlich vor dem jeweiligen Grund durch Zwischenräume
voneinander getrennt und als Einzelelemente ausgestellt sind. Damit ist die den
übergeordneten Formen innewohnende Bewegung nicht fließend; vielmehr geht
sie aus der Sukzession akkurat voneinander abgegrenzter Intervalle hervor, deren
Binnenausformungen wiederum durch einen ihnen immanenten Bewegungsimpuls
bestimmt werden, der in der Abfolge der proportional variierenden Kompartimen‐
te über die Einzelformen hinaus freigesetzt wird. Damit ist die Entfaltung der
Wirbelmotive nicht als kontinuierliches Aufwachsen, sondern als Bewegungsforma‐
tion gegeben.
Beruht die spezifische Räumlichkeit des Musters auf einer die ‚Fläche‘ verräum‐
lichenden dynamischen Figur‐Grund‐Polarität, ist die spezifische Zeitlichkeit dieser
Dynamik selbst wiederum durch eine Polarität gekennzeichnet: Die wechselseitige
Positionierung der Relate Figur und Grund erfolgt durch die verschiedenen
Aktualisierungsmodi Bewegung und Stillstand, die sich ihrerseits durchkreuzen:
Zum einen wird die Bewegung durch eine Sukzession stillgestellter, klar und
deutlich voneinander diskriminierter Elemente hervorgerufen, so dass die daraus
resultierende Bewegungswirkung das Paradox einer sich selbst aufführenden
Partitur einzulösen scheint – und tatsächlich ist diese Art der Ornamentik zeitge‐
nössisch als visuelle Musik aufgefasst worden –, zum anderen stellt sich die aus den
Einzelelementen synthetisierte Bewegung zugleich analytisch als simultan
gegebene Struktur dar.
Die Phänomenalität des gezeigten Musters zeichnet sich somit durch ein Zu‐
gleich von Flächigkeit und Räumlichkeit, von Simultanität und Bewegung aus, das
16
Enten‐Beispiel, durch den anderen ausgeschlossen, vielmehr ist das Figurieren des
Musters Resultat eines Sowohl‐als‐Auch: Jedes seiner Elemente ist sowohl flächen‐,
phänomenal in einem sich immer wieder neu konfigurierenden Verhältnis ko‐
präsent sind, was dem Muster seine fluktuierende Lebendigkeit verleiht.11 Dabei
bilden die einzelnen Elemente ein lückenloses Ordnungsgefüge, innerhalb dessen
jedem Teil eine auf das Ganze bezogene strukturbildende Funktion zukommt, die
wiederum vom Ganzen her bestimmt wird. Die doppelte strukturelle Selbstdeter‐
mination des Ganzen, das durch seine Teile formiert wird, die sie seinerseits in
ihrer Formierung ausrichtet, schließt Kontingenz apriorisch aus, was uns zum
Motto des Musters „Knowledge is Power“ führt. Dieses Diktum geht auf die
Ursprünge der Aufklärungsepoche zurück und bildet die fundamentale Prämisse
von Francis Bacons Novum Organum (1620), mit dem er den methodologisch
richtungsweisenden Versuch unternahm, Wissen empirisch zu fundieren.
Der in Majuskeln gehaltene Schriftzug ist auf einer das Musterfeld nach oben hin
rahmenden Banderole platziert, deren flache Erscheinung das Binnenfeld des
Musters als Ereignisraum ausweist und zugleich mit der Aussage „Wissen ist
Macht“ die Frage aufwirft, inwiefern der zeitlich konstituierte Ereignisraum einen
Raum der Erkenntnis eröffnet. Mit dem Versuch ihrer Beantwortung wechseln wir
von der Betrachtung der formalen Seite des Musters zur Explikation seines Gehalts.
Das Motto, welches explizit den Gehalt aufruft, verleiht dem Muster als inscriptio
einen emblematischen Charakter. Das Besondere dieses Emblems besteht – wie
gezeigt werden soll – allerdings darin, dass es seinen Gehalt nicht im Modus einer
allegorischen Symbolik, sondern vermittels seiner spezifischen raum‐zeitlichen
Struktur konkret veranschaulicht.
In diesem Sinne bestimmt Gottfried Boehm ‚Figuration‘ als ein prozessuales, sich im Sehen
aktualisierendes Figurieren, das sich zwischen den Relaten Figur und Grund vollzieht (Gottfried
Boehm: Die ikonische Figuration. In: Gottfried Boehm; Gabriele Brandstetter; Achatz von Müller
(Hg.): Figur und Figuration. Studien zu Wahrnehmung und Wissen, Paderborn 2007, S. 31‐52, hier
S. 38).
11
17
�II. Die Verselbständigung des Ornaments
Damit das Ornament überhaupt unabhängig von einem ihm übergeordneten
Ganzen, einen für sich bestehenden semantischen Gehalt zu entfalten vermag,
bedurfte es eines Verselbständigungsprozesses des traditionellerweise als Beiwerk
und Dekorum verstandenen Ornaments. Es musste zu einer eigenständigen, vom
übergeordneten Werkzusammenhang unabhängigen Ganzheit werden. Mit dieser
Verselbständigung gehen zwei wesentliche, die Sinnerzeugung und den Status des
Ornaments betreffende Wandlungen einher: Durch die Etablierung des Ornaments
als eines prinzipiell unabhängigen Sinnganzen geht sein Gehalt nicht mehr aus
einer ornamentalen Transformation des ihm vom Übergeordneten her Eingespeis‐
ten hervor, sondern muss nun gänzlich genuin ornamental generiert und zur
Darstellung gebracht werden, womit sich eine Änderung seines Status vollzieht. Als
in sich vollständige Sinneinheit ist das Ornament kein subordiniertes Addendum
mehr, sondern grenzt sich semantisch nach außen hin ab. Dadurch erzeugt es eine
Rahmung, die keineswegs formal in Erscheinung treten muss, dem Ornament aber
dennoch einen bildhaften Charakter verleiht. Aufgrund dieser bildlichen Valenz
Das Ausmaß dieses fundamentalen Wandels, der es überhaupt erst ermöglichte,
dass das Ornament zu einer Erkenntnisform im Sinne einer sich von Bacon
herleitenden empirisch‐naturwissenschaftlichen Aufklärung werden konnte, wird
fassbar, wenn Dressers Muster‐Emblem der bildlichen Darstellung eines anderen
Ornamenttyps gegenübergestellt wird (Abb. 6). Dabei handelt es sich um das
Frontispiz von Friedrich August Krubsacius` Abhandlung Gedanken von dem
Ursprunge, Wachsthume und dem Verfalle der Verzierungen in den schönen Künsten
(1759). Die im Titel anklingende dreigliedrige Zyklik: Ursprung, Wachstum und
Verfall kündigt bereits die Diagnose an, dass die Kunst der Verzierungen im
Niedergang begriffen sei. Mit dieser Einschätzung steht der sächsische Hofbaumeis‐
ter und spätere Professor für Baukunst der Dresdner Akademie keineswegs alleine
da. Seit den späten 1740er Jahren wurden insbesondere in den protestantisch
geprägten Gebieten Deutschlands polemische Invektiven gegen eine neue Orna‐
mentform laut, die ihren Ursprung in Frankreich hatte und von dem Goldschmied
Juste‐Aurèle Meissonnier etabliert worden war – gegen die Rocaille.
Trieb diese insbesondere in den Innenräumen der Hôtels des städtischen Adels
konnte das Ornament zu einer treibenden Kraft der Moderne, insbesondere in der
üppige Blüten, blieb ihr in Frankreich der Sprung vom Profan‐ in den Sakralbereich
ihm übergeordneten Ganzen, zur unüberwindlichen Schwierigkeit gerät, die das
Michael Feichtmayr gegen 1755 geschaffene Rocaille für die Wallfahrtkirche
Malerei werden. Die Kehrseite der Verselbständigung des Ornaments liegt
allerdings darin, dass seine ursprüngliche Aufgabe, die Applikation innerhalb eines
Ornament schließlich als Applikat sowohl aus der Architektur wie aus dem zum
Industriedesign gewordenen Kunsthandwerk verdrängen sollte.
Welche Stellung das Ornament durch seine Verselbständigung und den damit
einhergehenden bildhaften Charakter in England ab den 1840er Jahren gewinnt,
geht aus einem späteren Aufsatztitel Christopher Dressers, dem Urheber des
betrachteten Muster‐Emblems, hervor: Ornamentation considered as high art
(1871). Ein Aufsatz, der, seiner Intention gmäß, eigentlich ‚Ornamentation
considered as highest art‘ lauten müsste. Das Ornament, ehemals eine Marginalie,
der innerhalb der ‚hohen Künste‘ keinerlei Platz zukam, nimmt nun die Spitzenposi‐
verwehrt, während sie in den Kircheninnenräumen des Reichsgebietes, vor allem in
den süddeutschen und österreichischen Ländern aufblühte, wie es die von Johann
Vierzehnheiligen Balthasar Neumanns eindrucksvoll vor Augen führt (Abb. 7).12 In
Frankreich hingegen kam es nach der Veröffentlichung erster Vorlagen durch
Meissonnier augenblicklich zu klassizistischen Gegenreaktionen, namentlich von
dem als Illustrator der Encyclopédie tätigen Akademiker Charles Nicolas Cochin le
Jeune. Eine Kritik, die ihr immer lauter werdendes Echo in den Aufklärungszentren
Deutschlands fand.13 Vor diesem Hintergrund stellt Krubsacius` Schrift den
Konzentrationspunkt einer vehementen Kritik an einer sich gegenüber der
Architektur verselbständigenden Ornamentform dar.
tion der Hierarchie der Künste ein und wird mit Dressers Muster‐Emblem zu einer
absoluten Form, die, wie die Umschrift Knowledge is Power ankündigt, das Wissen,
12 Zum Aufkommen der Rocaille und ihrer Verbreitung in den Hôtels des französischen Adels
siehe: Fiske Kimball: The Creation of Rococo Decorative Style, New York ‐ Dover, 1980.
13 Eine kommentierte Quellenkompilation bietet: Mario‐Andreas von Lüttichau: Die deutsche
Ornamentkritik im 18. Jahrhundert, Hildesheim u.a. 1983.
18
19
potenziell in toto in sich zu enthalten vermag.
�Besenreisig, voller Drachen, Schlangen und anderm Ungeziefer, denen es am meisten
ähnlich sieht.14
Keines der aufgezählten Ingredienzen weist irgendeinen Eigenwert auf; durchweg
handelt es sich um minderwertige Gegenstände wie Abfälle oder absonderliche
Kreaturen. Die Rocaille wird als additiv zusammengesetztes Konglomerat entlarvt,
dessen Bestandteile keinerlei materielle Dignität aufweisen. Als Summe von
Nichtigkeiten, so die Konsequenz, weist sie trotz ihrer hypertroph‐opulenten
Erscheinung keinerlei ornamentalen Gehalt auf. Vielmehr konterkariert ihr
defizitärer „Mischmasch“ die eigentliche, sich von ‚ornare‘ herleitende Funktion des
Ornaments, nämlich ihren Träger zu schmücken. Die mit „Besenreisig, voller
Drachen, Schlangen und anderem Ungeziefer“ kulminierende Aufzählung ruft
hingegen ungeheuerliche Scheußlichkeiten, etwa einen Hexenbesen, und mit ihm
schwarzmagische Prozeduren auf, die aus dem Hässlichen einen schönen Schein zu
erzeugen suchen. Ein Trugbild, das sich, einmal durchschaut, als Betrug erweist und
6. Friedrich August Krubsacius, Gedanken von 7. Johann Michael Feichtmayr, Wallfahrts‐
dem Ursprunge, Wachsthume und dem Verfalle kirche Vierzehnheiligen, um 1755.
der Verzierungen in den schönen Künsten, 1759.
Seinen Feldzug gegen die Rocaille eröffnet Krubsacius mit der Frage, worum es sich
bei diesem Gebilde denn eigentliche handele und stellt fest, dass nicht einmal die
Ornamentkünstler darauf eine Antwort zu geben vermöchten. Und tatsächlich gibt
es zeitgenössisch keine positive Theorie der Rocaille. Um also Aufklärung darüber
zu verschaffen, was es mit der Rocaille auf sich habe, lässt er sie für seine Abhand‐
lung in einer Art und Weise nachstechen, die sie analytisch auf ihre Bestandteile
zurückführt, so dass nun offensichtlich wird, womit man es zu tun habe:
Dieweil [die Künstler] also nicht wissen, was es seyn soll: so nehme ich mir die Freyheit,
es ihnen durch beygefügtes Exemple zu erklären und zu sagen: Es sey ein Mischmasch, a)
Von Schilf und Stroh, b) Knochen, c) Scherbeln, d) Spänen, e) Flederwischen, f) verwelk‐
ten Blumen, g) zerbrochenen Muscheln, h) Lappen, i) Federn, k) Hobelspäne, l) abge‐
schnittene Haarlocken, m) Steinen, n) Fischschuppen, o) Gräten, p) Schwänzen und q)
20
mit Mitteln erzeugt wurde, die der Natur und damit dem die Schöpfung durchwal‐
tenden Vernunftprinzip zuwider laufen. Hiermit spitzt Krubsacius die spätestens
seit Vitruv virulente Kritik gegen eine eigengesetzlich verfasste Ornamentik zu, die
– so der Vorwurf – das rationale Ordnungsfüge des Werks irrational konterkariert.
Das sich als etwas Eigenständiges gebärdendes Ornament vermag – wie Krubsacius
an der Rocaille verdeutlicht – einzig etwas Unbenennbares, begrifflich nicht zu
Fassendes hervorzubringen; dunkle und konfuse Vorstellungen, deren Aufklärung
zeigt, dass es sich um bloße „Hirngespinste“ handelt, um Phantastereien, die bereits
Vitruv zu seiner Zeit scharf kritisierte hatte.15 Aus sich heraus vermag das Orna‐
ment kein Ordnungsgefüge zu etablieren. Erweist sich ein solches Ornament auch
als semantisch leeres Gebilde, ist es dennoch gefährlich, indem es als betrügeri‐
scher ornamentaler Schein das Werk durch eine Maskierung als etwas ausgibt, das
es selbst nicht ist. Eine Einschätzung, die sich im frühen zwanzigsten Jahrhundert
zum Topos der Lügenhaftigkeit des Ornaments auswächst und in Adolf Loos`
Friedrich August Krubsacius: Gedanken von dem Ursprunge, Wachsthume und dem Verfalle der
Verzierungen in den schönen Künsten, Leipzig 1759, S. 35f.
15 Die Kritik findet sich im 5. Abschnitt des 7. Buches von De architectura libri decem.
14
21
�Schlachtruf gipfelt, innerhalb der zivilisierten Welt sei Ornament nichts anderes als
Verbrechen.16
Die harsche Kritik der Aufklärung negiert das Ornament jedoch keineswegs als
solches. Als Zierrat hat es nicht nur seine Berechtigung, ist es in die ihm übergeord‐
nete Werkstruktur einpasst, um diese vermittels seiner Eigenformen verfeinernd
hervorzuheben und auf diese Weise den spezifischen Charakter des Ganzen
semantisch zu festigen; damit erfüllt es seine notwendige Funktion als adäquates
Dekorum. Emanzipiert sich das Ornament allerdings von seiner dienenden
Funktion, wird es, so Vitruv und Krubsacius, regellos. Eben der geforderten
strukturellen Eingliederung widersetzt sich die Rocaille. Sie profiliert sich, wie das
Beispiel Vierzehnheiligen veranschaulicht, als ein von der architektonischen
Struktur unabhängiges, frei vor der Wand stehendes Gebilde, das durch einen
markanten Schattenwurf zusätzlich als nicht zur Wand gehörend ausgewiesen
wird. Damit erreicht das Ornament innerhalb des architektonischen Zusammen‐
hangs eine neue Qualität: Es etabliert eine jenseits der Baustruktur angesiedelte
ontologische Ebene, die als eigenständige ornamentale Sphäre in eine Interaktion
mit der Architektur tritt. Inwiefern damit der Ornament‐Werk‐Zusammenhang in
einem positiv‐produktiven Sinne neu konfiguriert wird, kann hier nicht weiter
verfolgt werden. Für unseren Zusammenhang ist es hinreichend, die von Krubsa‐
cius festgestellte, heftig attackierte Verselbständigung des Ornaments festzuhalten.
Es stößt sich werkintern vom Werk ab, wodurch es – zunächst unter kritischen
Vorzeichen – überhaupt erst als etwas Eigenständiges in den Blick gerät. Damit
wird das Ornament als etwa Für‐sich‐Seiendes konstituiert, als eine von außen
indeterminierte Leerform, die zum Entfaltungsraum einer dem Ornament inne‐
wohnenden Eigengesetzlichkeit zu werden vermag.
orientierten Kunsttheorie, wodurch der Bildcharakter des Ornaments vorbereitet
wird. Über William Hogarths ‚Line of Beauty‘ (1753) und Karl Philipp Moritz`
Metaphysische Schönheitslinie (1793) wird das Ornament als ein genuin lineares
Gebilde reformuliert. Damit gerät es in das Fahrwasser des klassischen designo‐
Diskurses und mit ihm in den Horizont der produktiven Einbildungskraft, um sich
schließlich zur romantischen Arabeske ‚zu verfestigen‘, deren sich im Modus des
‚freien Spiels‘ realisierende innere Zweckmäßigkeit letztlich das schlechthin
Unverfügbare visuell erfahrbar werden lässt.17 Das Ornament ist zur absoluten
Form geworden. Zu einer isolierten Idealität, der nicht allein die Materialität und
der konkrete Ort, sondern – als literarisches Generierungsprinzip – sogar die
Anschaulichkeit abhanden gekommen ist. Und dennoch ist diese imaginäre Phase
des Ornaments für seine re‐materialisierte Neufassung von entscheidender
Bedeutung. Die in der Totalisierung gipfelnde Verselbständigung des Ornaments
ermöglicht überhaupt erst Dressers ornamentale Wissenschaftslehre, für die sein
Muster‐Emblem einsteht. Der Wandel des sich ontologisch wie semantisch
verselbständigenden Ornaments von einem per se A‐Rationalem zum privilegierten
ens rationale, führte dazu, dass das Ornament zum Instrument naturwissenschaft‐
lich geleiteter Wahrheitssuche werden konnte. Dieser veränderte Status musste der
Schaffung einer neuen Ornamentik zum unhintergehbaren Ausgangspunkt werden.
Um den ornamentalen Ist‐Zustand aufzurufen, von welchem sich Dressers ‚Ex‐
perimental‐Ornamentik‘ abhebt, begeben wir uns an jenen Ort, wo dem Ornament
der größte Auftritt im 19. Jahrhundert beschert wurde, auch wenn dieser für vor
allem negative Schlagzeilen sorgte.
Die endgültige Isolierung des Ornaments aus seiner werkinternen relationalen
Rückbindung vollzieht sich – wie hier nur angedeutet werden kann – unter nun
affirmativen Vorzeichen in der architekturfernen Sphäre der an der Malerei
16 Loos lehnt Ornamentalität aber keineswegs kategorisch ab. Der in Ornament und Verbrechen
formulierten, zeitlich indizierten und dennoch prinzipiellen Ornamentkritik setzt Loos mit Das
Prinzip der Bekleidung (1898) eine ornamentale Bekleidungstheorie der Architektur entgegen, die
er beim ‚Looshaus‘ am Michaeler Platz (1910‐11) realisiert.
17 „[...] arabesk ist jene durch die Dichtungskraft [...] hervorgebrachte Form, in der sich die
unendliche Fülle ahnungsweise manifestiert.“ (Karl Konrad Pohlheim: Die Arabeske. Ansichten
und Ideen aus Friedrich Schlegels Poetik, München u.a. 1966, S. 56).
22
23
�III. Architektonische Transparenz und ornamentaler Exzess
Mit der ersten Weltausstellung fand 1851 in London ein Ereignis unerhörten
Ausmaßes statt. Bereits die Dimensionen des Ausstellungsgebäudes überstiegen
alles bisher Gesehene. Joseph Paxtons ‚Crystal Palace‘ übertraf mit seinen 560
Metern Länge und 137 Metern Breite, wie im Ausstellungskatalog hervorgehoben,
um ein Vierfaches die Ausmaße von Sankt Peter in Rom.18 Damit war es das größte
Gebäude der Welt, dessen Inneres – so das Konzept der Ausstellung – in einer
monumentalen Schau die kulturellen Erzeugnisse der gesamten Menschheit
versammelte. Vor diesem Hintergrund ist der Vergleich mit Sankt Peter durchaus
nicht allein auf die räumlichen Verhältnisse zu beziehen. Hatte die französische
Revolution Rom durch einen Tempel der Vernunft ersetzen wollen, wird das
abstrakte Vernunftprinzip in London anthropologisch geerdet. Die ausgestellten
Erzeugnisse des menschlichen Geistes konstituieren in ihrer Summe eine die
Partikularität der Glaubensgemeinschaften übersteigende Universalität: das
Commonwealth der Menschheit. Die derart konstituierte universale Gemeinschaft
präsentiert sich, wiederum anhand der gezeigten Produkte, in ihrer kulturellen
Ausdifferenzierung. Damit dokumentiert die Weltausstellung zum einen den
kulturellen status quo der Menschheit, zum anderen etabliert sie durch die
unmittelbare Vergleichbarkeit der Produkte ein Konkurrenzverhältnis zwischen
den kulturellen Sphären.
Innerhalb dieses Vergleichs fiel trotz des zur Schau gestellten technischen Fort‐
schritts die Einschätzung der englischen Erzeugnisse, ja, der westlichen Produkte
überhaupt, ernüchternd aus. Ernüchternd, sobald nämlich jene Marginalie zum
Beurteilungsmaßstab erhoben wurde, die für sich betrachtet keinen eigenständigen
Gegenstand bildete, dafür aber so gut wie allen ausgestellten Objekten zukam: das
Ornament.
Bei der Revision der ausgestellten Produkte hinsichtlich ihrer Ornamentik zeige
sich, so der Tenor der Kritik, dass bei den westlichen Erzeugnissen einzig Ornamen‐
te vergangener Epochen kopiert würden, die als willkürliche Applikationen die
Objekte überwucherten, während Funktion und Material der Gegenstände bei ihrer
18
The Industry of All Nations 1851. Illustrated Catalogue, London 1851, S. XXI.
24
Ornamentierung unberücksichtigt blieben. Die durch seine Verselbständigung
erfolgte prinzipielle Lockerung zwischen Ornament und Träger führte zu einem
Vagieren des Ornaments, das sich im Modus historischer Stile regelrecht an den
Gegenständen festzuklammern suchte und diese förmlich überkrustete – „orna‐
ment ran riot at the Great Exhibition”, beschreibt ein späterer Lehrer der South
Kensington School, Frank P. Brown, diesen Ausnahmezustand, den eine willkürliche
Auswahl an Gebrauchsgegenständen, wie sie etwa eine Reihe von Scheren darstellt,
vor Augen führt (Abb. 8).19
Fernöstliche Produkte, insbesondere indische Teppiche, erfuhren gerade auf‐
grund ihrer Ornamentik hingegen höchste Wertschätzung. Dabei wurde der
Ornamentik der morgenländischen gegenüber derjenigen der westlichen Erzeug‐
nisse eine überzeitlich gültige A‐Historizität zugeschrieben, auf die wir noch
zurückkommen werden.20
Gerade die formulierte Kritik an der sowohl funktionalen und materiellen wie
zeitgemäßen Unangemessenheit des Ornaments wertete dieses abermals in einer
kategorialen Weise auf, indem das Applizierte als das Wesentliche des Werkes
fokussiert wird: Nicht der Gegenstand ist die Beurteilungsinstanz für sein Deko‐
rum; die Ornamentik selbst wird zum Maßstab für das Gelungen‐ oder Misslungen‐
sein des Objekts, zum Kriterium, anhand dessen der fragliche Gegenstand wesent
lich beurteilt werden kann. Als ein derartiges tertium comparationis wird das
Ornament zu einer die Gesamtheit der Gegenstände aller kulturellen Sphären
miteinander verbindenden Größe, deren supponierte universale Verständlichkeit
im Fall der westlichen Produkte allerdings einer babylonischen Sprachverwirrung
gewichen ist.
Die Weltausstellung führt das zu lösende Problem auf eine besonders frappie‐
rende Weise vor Augen: Wie kann das sich als ordnungsloser, reproduktiv agieren‐
der Exzess gebärdende Ornament mit einer durch den Crystal Palace
Frank P. Brown: South Kensington and its Art Training, London 1912, S. 11.
So bescheinigt etwas Owen Jones den indischen Teppichen „the nicest adjustment of the
massing of the ornament to the colour of the ground; every colour or tint, from the palest and most
delicate to the deepest and richest shades, receiving just the amount of ornament that it is adapted
to bear” (Owen Jones: The Grammar of Ornament, London 1856, S. 79).
19
20
25
�exemplifizierten, allein schon aufgrund ihrer Materialien Glas und Eisen gänzlich
neuartigen Architektur zusammengebracht werden, die sich zudem, im Vergleich
mit Sankt Peter, als transparente Raumhülle gleichsam selbst zum Verschwinden
bringt? Dabei stellt diese aus maschinell angefertigten modularen Grundeinheiten
bestehende Architektur, die sich nach einem Baukastenprinzip wie ein Gerüst
zusammensetzen lässt, selbst ein industrielles Erzeugnis dar und wurde zunächst
vor allem als ausgestelltes Industrieprodukt und nicht als eine Architektur
betrachtet, die für ein neues Bauen richtungsweisend wäre. Folglich wurde der
Crystal Palace nach dem Ende der Weltausstellung auch wieder abgebaut, um dann
allerdings 1854 in Sydenham dauerhaft wiedereröffnet zu werden, bis er schließ‐
lich 1936 einem Brand zum Opfer fiel.21
Die Selbsttransparenz der Architektur, könnte man sagen, fokussierte den Blick
auf das Ornament. Nur vom Ornament ausgehend, betont der für die Innendekora‐
tion des Crystal Palace zuständige Architekt Owen Jones, könne eine neue Architek‐
tur entstehen, denn das Ornament sei die Seele des Bauwerks.22 Die von Heinrich
Hübsch aufgeworfene Frage In welchem Style sollen wir bauen? (1828) ist folglich
nicht durch den Rückgriff auf historische Stilrichtungen zu beantworten, sondern
einzig vom innovativen Potenzial des Ornaments her zu lösen. Hierin zeigt sich
symptomatisch, dass das Ornament bis ins 20. Jahrhundert hinein zu einem alle
Bereiche der Kunst betreffenden Schlüsselproblem wurde und den gemeinsamen
Ausgangspunkt verschiedenster kunstreformatorischer Konzeptionen darstellte,
eingeschlossen jene, die eine Erneuerung der Künste nur durch die Negation
jeglicher Ornamentik für möglich hielten.
8. The Industry of All Nations, Illustrated Catalogue, 1851, S. 27, 93.
26
21 Siehe dazu: Carla Yanni: The Crystal Palace: A Legacy in Science. In: Die Weltausstellung von
1851 und ihre Folgen. Hrsg. v. Franz Bosbach u. John R. Davis, München 2002, S. 119‐126.
22 Jones 1856, S. 155, 83. Und William Morris wird ergänzen, dass das Ornament das Bauwerk
überhaupt erst zur Architektur erhebe (William Morris: Artist, Writer, Socialist, 2 Bd. Hrsg. von
May Morris, London 1966. Bd. 1., S. 266). Zu Owen Jones` gestalterischem Mitwirken an der
Weltausstellung siehe: Carol A. Hrvol Flores: Owen Jones. Design, Ornament, Architecture, and
Theory in an Age in Transition, New York 2006, S. 79‐99.
27
�IV. Das institutionalisierte Ornament
Als Industrieprodukt markiert der Crystal Palace zugleich das Ausgangsproblem,
welches das Ornament zunächst unabhängig von seiner architektonischen
Anbindung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt und schließlich zur
Anliegen motiviert, die seine Ausrichtung bestimmten: ein ökonomisches und ein
moralisches.
Die Government School of Design war auf Empfehlung des die Regierung in
ökonomischen Angelegenheiten beratenden Board of Trades ins Leben gerufen
Organisation der Weltausstellung geführt hatte: Wie habe eine Ornamentik
worden. Eine adäquate ornamentale Veredelung sollte, insbesondere angesichts
künstlerisch verfasstes ‚ornament engeneering‘ geben?
Wohlstand des Landes befördern. Das von Adolf Loos formulierte ökonomisch‐
industriell hergestellter Produkte beschaffen zu sein? Kann es ein den präzisen
Konstruktionsprinzipien des Crystal Palace entsprechendes und dennoch genuin
Um die Grundlagen einer solchen neuen Ornamentik zu schaffen, ist, nachdem
die Society of Arts, insbesondere Henry Cole, auf die Dringlichkeit, Richtlinien einer
neuen Ornamentik zu schaffen, insistiert hatte, unter Federführung des Akademie‐
künstlers William Dyce 1837 die Government School of Design ins Leben gerufen
worden.23 Zunächst im Somerset House in Strand ansässig, siedelte sie im Zuge
ihrer ersten Reform unter der Leitung Henry Coles 1853 ins Malborough House
über und wurde fortan aufgrund ihrer Lage als South Kensington School bezeich‐
net. Zur Schule gehörte eine Sammlung von Anschauungsgegenständen, welche,
nachdem sie durch den Ankauf von Objekten der ersten Weltausstellung enorm
angewachsen war, einen eigenständigen Bau, das South Kensington Museum
erhielt, aus dem schließlich das Victoria and Albert Museum hervorgegangen ist.
Um das Ziel, eine künstlerische Ausbildung einzurichten, die den mit der indus‐
triellen Revolution aufgekommenen Produktionsmitteln gerecht wird, hatte Dyce
im Vorfeld eine Besichtigungsreise der in Frankreich und Deutschland bereits
bestehenden Kunstgewerbeschulen unternommen, die ihn allerdings zu dem
enttäuschenden Ergebnis führte, dass bei den bestehenden Ausbildungsgängen die
Ornamentik keineswegs auf die neuen Produktionsbedingungen abgestimmt sei,
weshalb in dieser Hinsicht ein gänzlicher Neuanfang nötig wäre. Dieser staatlich
gesteuerte ornamentale Neuanfang war durch zwei miteinander verbundene
Zur turbulenten, von Reformen geprägten Geschichte der South Kensington School siehe: Frank
P. Brown: South Kensington and its Art Training, London 1912, Quentin Bell: The Schools of
Design, London 1963, Stuart Macdonald: The History and Philosophy of Art Education, London
1970, Christopher Frayling, The Royal College of Art. One Hundred and Fifty Years of Art and
Design, London 1987.
23
28
der wachsenden Anzahl französischer Importe, die internationale Konkurrenzfä‐
higkeit der maschinell erzeugten Produkte gewährleisten und dadurch den
moralische Argument, die Ornamentierung eines Gegenstandes bedeute eine
kostenverursachende, die menschliche Arbeitskraft ausbeutende Mehrarbeit,
rechtfertigte ursprünglich gerade die Notwendigkeit des Ornaments, indem das
Ornament den Mehrwert des Gegenstandes überhaupt erst herstellt, wobei
Mehrwert hier ganz im Sinne von Karl Marx, der ab 1849 in London ansässig war,
zu verstehen ist.24 Zur Mehrwertherstellung ist seitens der ausführenden Kräfte
gerade keine erhöhte körperliche Arbeit nötig, da die anvisierte Ornamentik
maschinell reproduzierbar sein soll. Die den Mehrwert herstellende Arbeit ist
folglich keine Arbeit am Gegenstand selbst, sondern in den ornamentalen Ent‐
wurfsprozess verlagert, der die Vorlagen für die maschinelle Vervielfältigung
liefert. Damit erfolgt eine dezidierte Abgrenzung von der körperlichen Arbeit,
wodurch die Herstellung der Ornamentik als geistige Tätigkeit nobilitiert wird.
Entsprechend heisst es bei Dresser, der ornamentierte Gegenstand werde durch
einen geistigen Prozess, nicht durch handwerkliche Tätigkeit veredelt, wobei er,
auch im pekuniären Sinne, umso wertvoller werde, je mehr geistig verfasstes
Wissen in ihn eingehe, das als Schönheit des Gegenstandes manifest wird.25
Die damit einhergehende Trennung zwischen ornamentalem Entwerfen und
Endprodukt unterzieht John Ruskin einer vehementen Kritik, die sich, abermals
konform mit der marxschen Theorie, als Entfremdungsprozess reformulieren lässt,
bei dem als Kehrseite des vom geistigen Anteil an der Produktherstellung abge‐
schnitten Arbeiters, der Ornamentkünstler selbst den Bezug zur Produktion des
Adolf Loos: Ornament und Verbrechen. In: Ders.: Sämtliche Schriften in zwei Bänden. Hrsg. v.
Franz Glück, Wien – München, S. 78‐89, hier S. 83.
25 Christopher Dresser: Principles of Decorative Design, London ‐ Paris ‐ New York, 1873, S. 1f.
24
29
�Gegenstandes verloren hat. Nur in der konkreten Arbeit am Gegenstand, so Ruskin,
nung ‚Kunstgewerbe‘ nahelegt, sondern in seinem vollen Bedeutungsanspruch in
sei eine gewisse Unvollkommenheit der Produkte, in der sich – gemessen am
wurde etwa das Aktzeichnen, überhaupt das Freihandzeichnen als solches,
während die maschinell genormten Produkte in ihrer Perfektion tote Gegenstände
Potenzialität bereitzustellen.
vermag sich die Freude an der Arbeit im Produkt niederzuschlagen und als seine
spezifische Lebendigkeit manifest zu werden.26 Kennzeichen dieser Lebendigkeit
göttlichen Werk – das letztlich zum Scheitern verurteilte menschliche Bemühen
zeige, welches jedoch als individuelle Spur eines liebevollen Bemühens aufscheine,
seien.27 Auf diesen Entwicklungsstrang, den das Ornament mit Ruskin und den
‚Naturalisten‘ nimmt, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Gerade die
unterschwelligen Berührungen mit der South‐Kensington‐School, die sich etwa
anhand des gemeinsamen Ausgangspunkts, der Gotik, und ihrer jeweiligen, für eine
bestimmte Naturauffassung stehende Deutung aufzeigen ließen, sollten sich für die
ArtsundCrafts‐Bewegung und den Jugendstil als äußerst produktiv erweisen.
Mit der von Ruskin beklagten Trennung der Werkschöpfung in einen geistigen
und einen materiellen Herstellungsprozess lässt sich zugleich der Übergang vom
‚Ornament‘ und ‚Kunsthandwerk‘ zu ‚Muster‘ und ‚Design‘ markieren, wie er sich in
der Abfolge der Titel der wichtigsten für die South‐Kensington‐School verfassten
Lehrbücher, Owen Jones` Grammar of Ornament (1856) und Christopher Dressers
The Art of Decorative Design (1862), zeigt, auch wenn diesen Begriffen keine
absolute kategoriale Kraft zukommt. In den Quellen werden die Bezeichnungen
‚pattern‘ und ‚ornament‘ durchaus beliebig gebraucht. Der unklare Status des
ornamentalen Entwerfens schlägt sich wiederum in der vielfachen Umbenennung
der Government School of Design nieder, die entsprechend Dressers programmati‐
schem Aufsatz Ornamentation considered as high art ab 1853 National Art Training
School und ab 1896 schließlich ihren heutigen Namen Royal College of Arts erhielt.
Die Aufnahme des Begriffs ‚art‘ in den Namen weist bereits auf das Anliegen hin, die
unter den skizzierten gewandelten Vorzeichen inaugurierte ornamentale Entwurfs‐
tätigkeit als der Hochkunst ebenbürtig zu klassifizieren, wobei der Begriff ‚Kunst‘
nicht in einer gattungstheoretisch orientierten Unterordnung, wie ihn die Bezeich‐
26 „All noble ornamentation is the expression of man`s delight in God’s work.” (John Ruskin: The
Stones of Venice. Bd. 1: The Foundations, London 1851, S. 43).
27 John Ruskin: The Stones of Venice, Bd. II: The Sea Stones, London 1851, S. 161.
30
Anschlag gebracht wurde, was naturgemäß zu einem Konkurrenzverhältnis mit der
Royal Academy of Art führen musste. Um die Kompetenzen auseinander zu halten,
zunächst der akademischen Ausbildung vorbehalten, schließlich aber doch wieder
eingeführt, um für die schöpferische Entwurfstätigkeit die höchste künstlerische
Der besondere ideelle Status, welcher dem Ornament zugemessen wurde, geht
über den rein ökonomischen Aspekt hinaus und führt uns zum zweiten Anliegen
des ornamentalen Neuanfangs: zur moralischen Kapazität des Ornaments. In der
Tradition der Aufklärung stehend sollte vermittels der potenziellen Omnipräsenz
ornamental veredelter Gegenstände der allgemeine Geschmack gehoben und damit
der seit Anthony Earl of Shaftesbury virulente moral sense gefestigt werden, um auf
diese Weise den moralischen Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken.28
Das Ornament wurde also mit den zentralen Staatsaufgaben Wohlstand und
Erziehung betraut, was die South Kensington School durchaus mit den gesell‐
schaftsreformatorisch‐utopischen Anliegen eines Ruskin verbindet. Um die ihm
zugedachten höchsten Aufgaben einlösen zu können, musste das Ornament
zunächst institutionell als etwas Eigenständiges etabliert werden, anstatt im
Fahrwasser des Kunstgewerbes als Annex der Künste zu gelten. In dieser Hinsicht
ist wiederum die ursprüngliche Namensgebung ‚Government School of Design‘
aufschlussreich. Mit ihr sollte die staatliche Institution keineswegs in die Reihe der
herkömmlichen, seit dem Aufkommen des Dilettanten florierenden Londoner
Privat‐Zeichenschulen eingegliedert werden. Vielmehr bezeichnete das sich vom
designo ableitende design den Status der anvisierten Tätigkeit, wobei der ornamen‐
tale Entwurf von einer idea seinen Ausgang nimmt und nicht von etwas bereits
Vorhandenem ausgeht, zu dem es als untergeordnete Größe hinzutritt. Der
ornamentale Entwurf folgt allerdings im Unterschied zum freikünstlerischen einer
anderen, durch bestimmte noch darzulegende Gesetzmäßigkeiten determinierten
Dem für die Epoche der Aufklärung fundamentalen Zusammenhang von ‚moral sense‘ und Kunst
habe ich eine eigene Untersuchung gewidmet: Das gestochene Argument. Daniel Nikolaus
Chodowieckis Bildtheorie der Aufklärung, Berlin 2012.
28
31
�Zweckmäßigkeit. Damit weist er eine Verwandtschaft zum architektonischen Plan
Damit die derart unabhängige Ornamentik die ihr zugesprochene moralische
auf, nur dass dieser Plan mit dem Produkt identisch ist. Der ornamentale Entwurf
Wirkintensität zu entfalten vermag, ist die Herstellung ornamentaler Produkte
Architekturen zu realisieren, was die Dimensionen des neuen schöpferischen
erst eröffnet werden, weshalb der „Ornamentunterricht“ durch eine gezielte, an der
ist bereits das Ornament, das als Vorlage für seine maschinelle Vervielfältigung
dient. Vor diesem Hintergrund eröffnet sich die Möglichkeit, gleichsam ideale
Raumes der Ornamentik charakterisiert.
Enthält das designo bereits das Ganze vollständig, ist das Ornament – entwurfs‐
theoretisch – ebenfalls in sich vollständig, während es, seiner oben dargelegten
klassischen Bestimmung zufolge, etwas per se Unvollständiges darstellt. Zwar
wurde in den im Umfeld der South Kensington School entstandenen Schriften stets
allein allerdings nicht hinreichend; vielmehr muss eine adäquate Rezeption durch
die Teilhabe am geistig‐produktiven Prozess ornamentaler Schöpfung überhaupt
South Kensington School erfolgende Lehrerausbildung bis in die Volksschulen
hinein ausgedehnt wurde.30 Auf diesem Weg sollte zugleich eine breite Nachfrage
an Qualitätsornamentik hervorgerufen und für künstlerischen Nachwuchs gesorgt
werden.
Zur Rezeption wie zur Erzeugung qualitätvoller Ornamentik bedarf es folglich
betont, die spezifische fitness des Ornaments bestehe darin, deiktisch auf die
eines ornamentalen Sehens, das auf ein spezifisches Wissen rekurriert, was
industriell erzeugbare Objekte in den Blick rückten, bei denen der Gegenstand in
1862 stattfindenden Londoner Weltausstellung publizierten Schrift The Art of
Funktionalität des Gegenstandes, seine ihm eigene fitness zu verweisen, und
dennoch erfuhr das Ornament eine faktische Verabsolutierung, indem vor allem
seiner Funktion als Ornamentträger ornamental zum Verschwinden gebracht wird,
da diese Objekte wiederum etwas anderes schmücken, das sie aus‐ bzw. bekleiden,
wie dies bei Teppichen, Tapeten, Vorhänge, Tischdecken, Kleidung, kurz: bei
textilen Produkten aller Art der Fall ist. Sie stellen die ‚Leitprodukte‘ der von South
Kensington ausgehenden Ornamentdebatte dar. So wurden etwa im Journal of
Design and Manufactures anhand kritischer Besprechungen in die Hefte eingebun‐
dener originaler Stoffmusterproben programmatisch erläutert, welchen Prinzipien
eine Ornamentik zu folgen habe. Den textilen Leitprodukten eignet ein materieller
Flächencharakter, der die Bildhaftigkeit des Ornaments forciert und damit dessen
Eigenständigkeit stützt.29 Die mit der Bildhaftigkeit gegebene interne Vollständig‐
keit ermöglichte es, die kreativen Prozesse vom gegenständlichen Endprodukt zu
entkoppeln. Damit gewinnt der ornamentale Entwurf das Potenzial eines indeter‐
minierten Experimentalraums, was sich wiederum im Titel von Dressers Studies in
Design (1875) niederschlägt.
unseren Blick erneut auf Dressers Muster‐Emblem mit seinem programmatischen
Motto „Knowledge is Power“ lenkt. Es findet sich im letzten Teil seiner zur zweiten,
Decorative Design, die als Lehrbuch für die South Kensington School konzipiert ist,
zu deren erster Schülergeneration Dresser gehörte. Sie stellt zugleich den ambitio‐
niertesten Versuch dar, die seit der Gründung der Government School of Design
entfachte, durch die Erfahrung der Weltausstellung noch verschärfte Debatte über
den Status des Ornaments und seine angemessenen Ausformungsprinzipien
theoretisch zu fundieren. Auch wenn The Art of Decorative Design für einen
schulischen Rahmen verfasst wurde, sollte sie dennoch eine möglichst
flächendeckende Breitenwirkung entfalten, was Dresser dadurch zu erhöhen
suchte, dass er sein Lehrwerk unter dem Titel Principles of Decorative Design
(1873) in eine vereinfachte Form brachte, um das ‚ornamentale Wissen‘ auf diesem
Wege jedem talentierten Arbeiter zugänglich zu machen und dazu aufzufordern, bei
ihm Entwürfe zur kritischen Beurteilung einzureichen.
Das Ornament‐Emblem, in Dressers Lehrbuch als Exempel höchster Könner‐
schaft gipfelnd, prangte als Signet seines eigenen Schaffens auch an der Tür seines
Arbeitszimmers. Die von ihm praktizierte Entwurfstätigkeit ist jedoch nicht
29 Siehe dazu: Joseph Masheck: The Carpet Paradigm. Critical Prolegomena to a Theory of Flatness.
In: Art Magazine 51, 1976, S. 82‐109.
32
diejenige eines ingeniösen Künstlergenies; sie basiert, wie die Umschrift mitteilt,
30
Brown 1912, S. 14.
33
�auf einem Wissen, das keineswegs esoterisch, sondern prinzipiell jedem zugänglich
ist und schulisch gelehrt werden sollte. Ein Wissen, das durch ein diszipliniertes,
dezidiert gegen eine ‚Genieethik‘ gerichtetes Arbeitsethos erlernt und angewendet
werden kann, weshalb Dresser mahnt, derjenige, der achtzehn Stunden arbeite,
lerne dreimal so viel wie jemand, der nur sechs Stunden tätig sei.31
Auf welche Weise sind nun aber Prinzipien zu gewinnen, nach denen eine quali‐
tätvolle Ornamentik erzeugt werden kann?
V. Die kulturelle Natur des Ornaments
Mit der oben skizzierten Verselbständigung des Ornaments geraten die histori‐
schen Ornamente retrospektiv als isolierte Entität in den Blick. Vor diesem
Hintergrund unternimmt es Owen Jones in einer historischen Gesamtschau, das
Ornament auf die ihm eigenen inneren Gesetzmäßigkeiten hin zu untersuchen, um
überzeitlich gültige Gestaltungsrichtlinien abzuleiten, auf deren Grundlage die sich
als Potpourri historischer Stile agierende ornamentale Willkürlichkeit zugunsten
eines neuen zeitgemäßen Stils durchbrochen werden könnte. Resultat seiner
Untersuchung ist das ebenfalls für die South Kensington School verfasste Handbuch
The Grammar of Ornament (1856). In ihm zeigt Jones die in allen partikulären
ornamentalen Formen obwaltenden „general laws“ auf und stellt sie, in 37
propositions zusammengefasst, als eine Sehanleitung der Grammar voran, die von
Jones` eigenem Blick auf die historischen Ornamente zeugt.32
Bei diesen Gesetzmäßigkeiten handelt es sich vor allem um formale Distributi‐
onsverhältnisse, nach denen, Jones zufolge, all jene ornamentalen Formen aufge‐
baut seien, die über Kultur‐ und Sprachgrenzen hinweg als schön empfunden und
auf diese Weise verstanden würden. Damit stellt die Ornamentik eine Universal‐
sprache der Schönheit dar, die sich zu einzelnen, als kulturelle und historische Stile
gegebenen Dialekten ausdifferenziert hat. Bei ihrer Untersuchung entdeckt Jones
die Reichhaltigkeit der ornamentalen gegenüber der gesprochenen Sprache: So sei
es nahezu unmöglich, die Formunterschiede zwischen arabischem, türkischem und
persischem Ornament in Worte zu fassen, während sie doch klar und deutlich vor
Augen stünden (Abb. 9).33 Hatte Krubsacius anhand des Maßstabs der Sprache das
sich verselbständigende Ornament als etwas begrifflich nicht Fassbares und daher
Nichtiges bestimmt, wird es nun zu einer universal verständlichen, der gesproche‐
nen Sprache vorgängigen eigensprachlich verfassten Kommunikationsform, deren
grammatische Struktur Jones aufzudecken sucht, weshalb seine Ornamentanalysen
einen durchaus philologischen Anspruch aufweisen.
Die überzeitliche und interkulturelle Verständlichkeit gelungener Ornamente
liegt, Jones zufolge, darin begründet, dass die grammatische Struktur der Ornamen‐
tik auf jenen weit fundamentaleren, die Ausformung der Schöpfung bestimmenden
Strukturprinzipien basiert, nach denen sich das Wachstum der Pflanzen vollzieht.34
Hieraus folge jedoch nicht, dass zur Schaffung gelungener Ornamente die äußere
Erscheinung des Blatt‐ oder Rankenwerks so akkurat als irgend möglich zu
kopieren wäre. Eine derart hervorgebrachte Ornamentik sei geradewegs
Kennzeichen kulturellen Verfalls.35 Inwiefern reale Pflanzen der Ornamentik eine
adäquate Vorlage sein können, zeigt Jones anhand des ägyptischen Ornaments, das
ihm für den Ursprung der Ornamentgeschichte einsteht. Zur anthropologischen
Fundierung des Ornaments eröffnet die Grammar of Ornament zwar mit einem
Kapitel über ‚Savage Tribes‘, doch beginne sich der „ornamentale Instinkt“ auf
dieser Kulturstufe erst allmählich zu regen, während die als Morgenröte der
Zivilisation verstandene, sich durch einen qualitativen Wissenszuwachs auszeich‐
nende ägyptische Kultur den ersten tatsächlichen Ornamentstil hervorgebracht
habe, deren Ornamentik sich im Gegensatz zu den ‚Savage Tribes‘ an konkreten
Pflanzen, dem Lotus und Papyrus, orientiere.36
Dresser 1873, S. 4.
Als Entwurfs‐ und Beurteilungsrichtlinien wurden sie zur Etablierung eines ornamentalen
Kanons bereits vor dem Erscheinen der Grammar für einen Penny seitens der South Kensington
School vertrieben.
Jones 1856, S. 63.
Jones 1856, S. 24 .
35 Jones 1856, S. 70.
36 Jones 1856, S. 13. Eine Argumentation, die Adolf Loos in Ornament und Verbrechen (1908)
umkehren und die Ornamentik innerhalb des zivilisatorischen Fortschritts als Atavismus
brandmarken wird.
34
35
31
32
33
34
�9. Owen Jones, Grammar of Ornament, Tafeln XXXIV, XXXVI, XLVL.
Um die Art und Weise der naturalistischen Erdung des Ornaments zu veranschauli‐
chen, zeigt Jones als Eröffnung des insgesamt acht Tafeln umfassenden Kapitels
zum ägyptischen Ornament eine Zusammenstellung der vorbildlichen Pflanzen und
ihrer ornamentalen Ausformungen (Abb. 10). Als Bekrönung der Mittelachse ist auf
der Tafel eine Lotusblüte „drawn from Nature“ dargestellt, neben der jeweils links
und rechts der ägyptischen Ornamentik entnommene „representations“ des Lotus
zu sehen sind.37 Die Anordnung verdeutlicht, dass die Natur den absoluten Maßstab
darstellt, von dem die Ornamentformen deduziert wurden. Dabei ist die ‚veristi‐
sche‘ Darstellung des Lotus durch die Negation der Eigenräumlichkeit des pflanzli‐
chen Motivs bereits derart stilisiert, dass sie selbst wie ein ornamentales Muster
wirkt. Einzig der durchschnittene Stiel gibt die flächenhafte Form als dreidimensio‐
nales Gebilde zu erkennen. Aufgrund dieser Seherfahrung vermag sich innerhalb
der Blüte ein moderater farbperspektivischer Raum zu etablieren, der durch die
gelben, den Blütenboden anzeigenden Farbsprengsel und den Farbverlauf inner‐
halb der Blütenblätter evoziert wird. Die ornamentale oder, in Jones` Terminologie,
die repräsentationale Darstellung des Lotus fixiert das im veristischen Abbild
37
Jones 1856, S. 19.
36
10. Owen Jones, Grammar of Ornament, Tafel IV.
37
�aufscheinende Ordnungsmuster vermittels einer vollständigen Negation der
Eigenräumlichkeit auf der Fläche. Der Lotusstiel ist zur querschnittlosen Linie
geworden, die, um ihren Charakter als Stiel in der Fläche zu bewahren, von einer
braunen Kontur nach außen hin begrenzt wird. Die Konturlinie überwölbt auch die
einzelnen Blütenblätter, wodurch eine nach außen abgegrenzte Form erzeugt wird,
die sich als Figur vom Grund der Tafel abhebt, mit dem sie durch ihren Flächencha‐
rakter zugleich in ein Korrespondenzverhältnis tritt, welches bei der Darstellung
des Naturvorbildes nicht gegeben ist und die im ersten Abschnitt dargelegte
ornamentale Räumlichkeit forciert. Erst die raumreduzierende Entmaterialisierung
des Naturvorbildes stellt jene ideale flatness her, die es erlaubt, das Ornament als
surface decoration in die Oberfläche einzulassen und auf diese Weise eine ornamen‐
tal verfasste Bildräumlichkeit zu erzeugen, was anhand der zweiten Abfolge von
‚veristischer‘ Darstellung und ornamentaler Repräsentation verfolgt werden kann.
Die Figuren sieben, acht und neun veranschaulichen Stamm und Blüte der Papy‐
rus‐Pflanze, während die Figur zehn ihre Repräsentation zeigt, deren Dreigliedrig‐
keit aus Basis, Schaft und Kapitell zugleich das Modell der ägyptischen Säule
vorgibt. Von diesem ornamentalen Säulenschema ausgehend, das abermals durch
eine raumreduzierende Entmaterialisierung des Naturvorbildes hergestellt wurde,
wird dann, so die bildliche Argumentation, die Materialität der Säule wiederge‐
wonnen, was auf Tafel VI (Abb. 11) veranschaulicht wird. Figur eins zeigt ein
Kapitell aus Luxor. Seine Hohlkehle wird von gleichmäßig angeordneten filigranen
Blütenstengeln durchzogen, so dass der Kapitellkörper strahlenförmig aus den
stilisierten Blättern des Kapitellkranzes hervorzuwachsen scheint. Dieser Effekt
stellt sich gerade dadurch ein, dass sich die ornamentalen Pflanzen nicht als
eigenständige Gebilde frei vor dem Kapitellkörper artikulieren, sondern, in seine
Oberfläche eingelassen, mit dieser einen homogenen Verbund bilden. Um die derart
erzeugte Oberflächenintegrität vor Augen zu führen, sind die untersichtig gegebe‐
nen Kapitelle dezidiert als räumliche Bauteile ausgestellt. Sie weisen – wie der
‚veristische‘ Lotus der zuvor betrachteten Tafel – einen deutlichen Querschnitt auf,
während der Lichtfleck anzeigt, dass die Ornamentik keinen Eigenschatten auf den
Kapitellkörper wirft, sondern einen integralen Bestandteil seiner planen Oberflä‐
chenstruktur bildet. Anders das römische Kapitell (Abb. 12): Hier weist der
38
11. Owen Jones, Grammar of Ornament, Tafel VI.
39
�12. Owen Jones, Grammar of Ornament, S. 46, 47.
ornamentale Akanthus durch seine materielle Erscheinung eine markante Eigen‐
räumlichkeit auf, die weit über jene gegenüber gezeigte veristische Darstellung des
pflanzlichen Vorbildes hinausgeht.
In welcher Weise sich das römische Ornament durch diese Materialisierung vor
dem Grund artikuliert, führt wiederum die Tafel XXVI vor Augen (Abb. 13).
Insbesondere auf der Figur fünf wirft das kräftige Rankenwerk einen den eigentli‐
chen Baukörper verdunkelnden Schatten. Hier tritt die Eigenkörperlichkeit der
Ornamentik an die Stelle der beim ägyptischen Kapitell so prägnant hervorgehobe‐
nen Körperlichkeit des Bauteils, wodurch die Konsistenz der vom Baukörper
vorgegebenen Oberflächenstruktur zerstört wird. Wie bei den Objekten der
Weltausstellung beklagt, überwuchert das Ornament den Gegenstand. Es ist
Addendum, nicht Ingredienz. Nur wenn die Ornamentik, so die Position der
40
13. Owen Jones, Grammar of Ornament, Tafel XXXVI.
41
�Grammar, auch innerhalb der Baukunst im Modus der flatness gegeben ist, vermag
zu verleihen.39 Auf diese Weise entsteht eine den ornamentalen Kanon der
charakterisieren. Damit ist eine seine Eigenmaterialität negierende Oberflächenor‐
Naturgesetzmäßigkeiten eine subjektive Ausformung darstellt. Trotz der subjekti‐
sie als integraler Teil der Oberflächenstruktur des Baukörpers diesem eine
ornamentale Räumlichkeit einzuschreiben und ihn auf diese Weise wesentlich zu
namentik keineswegs oberflächlich, sondern für den Baukörper semantisch von
fundamentaler Bedeutung.
Darüber hinaus wird das Flächenornament, wie das Kapitell von Luxor vorführt,
auch plastisch wirksam, indem die Lotusblüten vermittels ihrer Oberflächenintegri‐
tät die scharfe Begrenzungskontur des Kapitellkörpers vorgeben. Das materiell‐
haptische Rankenwerk des römischen Kapitells hingegen reduziert die Ornamentik
jeweiligen kulturellen Sphäre bildende conventional form, welche bezüglich eben
dieser Sphäre objektiv ist, während sie hinsichtlich der qua Ornamentik aktivierten
ven Komponente ist das Ornament als conventional form jedoch kein den Schriftzei‐
chen vergleichbares arbiträres Gebilde, da seine Syntax auf strukturellen Naturge‐
setzmäßigkeiten basiert, die bei der Generierung der Ornamente eine spezifisch
ausgeprägte Modifikation erfahren.
Aufgrund der beschriebenen Polarität zwischen seiner ‚objektiven‘ und ‚subjek‐
tiven‘ Dimension kommt dem historischen Ornament eine doppelte Relevanz als
auf eine bloße Oberflächenerscheinung, so dass die Natur gerade durch die
Erkenntnisform zu: Zum einen stellt es durch die visuelle Präzisierung der
Imitation der äußeren Erscheinung eines raumreduzierenden Abstraktionsaktes,
ihres Entstehens. Damit ist die Grammar of Ornament nicht nur eine Grammar of
naturalistische Ausformung der Ornamentik denaturalisiert wird. Um demgegenü‐
ber eine gelungene ornamentale representation zu erzeugen, bedarf es anstatt der
der die Struktur des Naturvorbildes von den äußerlichen Kontingenzen purifiziert
und auf diese Weise das sich in allen Exemplaren durchhaltende Naturgesetz zur
Erscheinung bringt.38 Damit wächst dem Ornament das Potenzial einer naturwis‐
senschaftlichen Erkenntnisform zu: Im Modus der abstrahierenden flatness wird
die strukturelle Beschaffenheit der natürlichen Pflanzen in einer Deutlichkeit
sichtbar, wie sie am Naturobjekt selbst nicht zutage tritt. Indem die ornamentalen
Formen die harmonisch gefügte Proportionalität der Naturgesetzmäßigkeiten in
ihrer Schönheit zur Darstellung bringen, veranschaulichen sie die idea der Pflanze
und mit ihr diejenige des pflanzlichen Wachstums überhaupt. In dieser Hinsicht ist
die Grammar of Ornament zugleich eine Grammar of Nature.
Allerdings wurde die objektive Seite der ornamentalen Idealisierung innerhalb
der von Jones in der Grammar of Ornament entfalten Ornamentgeschichte jedoch
um willen ihrer subjektiven Dimension unreflektiert praktiziert: Stets ging die
Pflanzenstrukturen ein Wissen über die Natur bereit, zum anderen eröffnet es
durch das Wie der jeweiligen Präzisierung ein Wissen über die kulturelle Formation
Nature, sondern zugleich eine Grammar of Culture.
Die einzelnen Ornamentstile stehen aber keineswegs gleichberechtigt nebenei‐
nander. Bei der Beurteilung ihrer Qualität ist die subjektive Seite, der sich in der
Ornamentik artikulierende kulturelle Ausdruckswille, der objektiven Seite,
inwiefern die Ornamentik tatsächlich gemäß Naturgesetzmäßigkeiten ausgeführt
wurde, nicht allein untergeordnet; der Ausdruckswille weist genau dann eine umso
höhere moralische Dignität auf, je adäquater die Ornamentik entsprechend den
Naturgesetzlichkeiten konstruiert worden ist, was wiederum ihre überzeitlich
wirksame Schönheit verbürgt. In ihr liegt die aktuelle Potenzialität einer solchen
Ornamentik, auch wenn sie durch eine spezifisch kulturelle Einfärbung nicht
einfach übernommen werden darf.
„[…] for the most perfect examples of what is usually termed „Conventionalized nature” […] are
manifestations of natural objects as undisturbed by surrounding influences and unmarred by
casualties.” (Christopher Dresser: The Art of Decorative Design, London 1862, S. 38).
39 Entsprechend lautet Jones` proposition 2: „Architecture is the material expression of the wants,
the faculties, and the sentiments, of the age in which it is created” (Jones 1856, S. 5). Im Ägypten‐
Teil wird dann die symbolische Kraft einer freilich genuin zur architektonischen Struktur
gehörenden Ornamentik zum primären kulturellen Ausdrucksmittel: „Ornament ever has
expressed the sentiments of the age” (Jones 1856, S. 23). Diese semantische Dimension des
Ornaments hebt Dresser ebenfalls hervor: „[…] ornament, like architecture, must express the
sentiments of the age in which it is created” (Dresser 1862, S. 10).
42
43
entdeckte Struktur mit einer ornamentalen Rekonfiguration einher, die von einem
Ausdruckswillen gesteuert darauf zielt, dem Ornament einen symbolischen Gehalt
38
�Indem die Naturgesetzmäßigkeiten derart als Bewertungskriterium den kulturellen
Ausprägungen übergeordnet sind, ist Jones` in der Grammar of Ornament prakti‐
zierter Historismus durch eine radikale Enthistorisierung angeleitet, die es
ermöglicht, die verschiedenen Ornamentformen nach denselben Kriterien zu
analysieren und zu bewerten. Daher steht auch nicht die spezifische Motivik in
ihrer historisch gegebenen Symbolik im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die
jeweilige Behandlung der Formen. Ein Vorgehen, das zusätzlich gestützt wird,
indem die kulturellen Sprünge innerhalb der Ornamentgeschichte weniger durch
Erfindungen neuer Motive bestimmt seien, als dass sie von einer anderen Durchbil‐
dung derselben Formen gekennzeichnet würden.40 Hierin kündigt sich eine
Auffassung der Ornamentgeschichte als von einem Wollen getragener formimma‐
nenter Entwicklungsprozess an, wie ihn Alois Riegl ausarbeiten wird, so dass die
Entstehung der formalistischen Kunsttheorie gleichsam aus dem Geist der
Ornamentik hervorgeht. 41
Riegl nimmt dabei allerdings die Ornamentik der von Jones als Verfallszeit
übergangenen Spätantike in den Blick, um ihr formproduktives Potenzial aufzuzei‐
gen, das gerade unabhängig von Jones` naturalistisch fundierten Richtlinien
wirksam ist. Damit entbindet Riegl die Ornamentgeschichte vom Maßstab der
Natur, weshalb er das die Ornamentik formierende Prinzip dezidiert als Kunstwol‐
len
bezeichnet.42
Der angezeigte Vorgriff auf die Perspektive Riegls geht in der
Grammar of Ornament mit einem im Moment ihres Aufkommens erfolgenden
Auseinandertreten von formalem und ikonographischem Zugang einher, lange
bevor sich diese mit Riegl und Panofsky methodisch verfestigen sollten und zum
bewusst reflektierten Vermittlungsproblem wurden.
Wie aber ist die jenseits dieser beiden Methoden angesiedelte, von ihnen aus‐
geblendete naturalistische Rückbindung zu verstehen? Und wie sind die von Jones
als Grammar bezeichneten ornamentalen Strukturprinzipien genau beschaffen?
VI. Die die grammatische Struktur des Ornaments
Derjenige ornamentale Stil, welchem aufgrund des Maßstabs erfüllter Naturge‐
setzmäßigkeiten die größte überzeitliche Relevanz zukommt, ist Owen Jones
zufolge der maurische (Abb. 14), weshalb er die wichtigsten ornamentalen
Gestaltungsprinzipien anhand dieser Ornamentik erläutert. Zunächst und vor allem
zeichne sie sich durch eine vollkommene Figur‐Grund‐Relation aus: „In Moresques
ornament the relation of the areas of the ornament to the ground is always perfect;
there are never any gaps or holes”.43 Figur und Grund sind auf eine sich gegenseitig
durchdringende Art und Weise ineinander gesetzt, wie dies eingangs anhand von
Dressers Muster‐Emblem aufgezeigt wurde. Dadurch wird ein intensiver ornamen‐
taler Spannungsraum erzeugt, dessen strukturelles Gefüge entsprechend dem
Diktum natura non facit saltus keinerlei Abgründe aufweist. Und eben hierin zeigt
sich die Naturanalogie dieses offensichtlich doch geometrischen Gefüges: Die
ornamentale Struktur wird nicht durch die Anwendung einer sie von außen
kontrollierenden Regel gebildet, sondern stellt die Freisetzung der internen
Organisationsform des Ornaments selbst dar. „Every ornament“, so Jones, „contains
a grammar in itself.”44 Die konstruktive Entfaltung des Ornaments folgt mithin
keinem willkürlichen Akt, sondern exekutiert die als Eigengesetzlichkeit gegebene
grammar des Ornaments: das ihm – in Entsprechung zur Natur – a priori einge‐
schriebene Prinzip, von dem einzig im Modus der Degeneration abgewichen wird.
Das grammatische Prinzip basiert auf der Vermittlung der ornamentalen Syntax,
die aus drei „primary figures“ besteht. Bei diesen handelt es sich nicht um die
paradigmatischen geometrischen Formen Dreieck, Quadrat und Kreis, sondern, was
eine höherstufige Geometrie impliziert, um Linientypen: Gerade, Diagonale und
Kurve.45 Die grammatische Verbindung dieser syntaktischen Elemente zu einer
ornamentalen Ganzheit hat, wie Jones beispielhaft erläutert, in graduellen Über‐
gängen zu erfolgen (Abb. 15). Während die Linie A eine ausgewogen propor‐
Jones 1856, S. 58.
Jones 1856, S. 66.
45 Diese Linientypologie folgt William Robsons Grammigraphia, or the Grammar of Drawing
(1799). Siehe dazu auch: David Brett: Drawing and the Ideology of Industrialization. In: Design
Issues 3,2 (1986), S. 59‐72.
43
Dresser 1873, S. 9.
Alois Riegl: Stilfragen. Grundlegung zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893.
42 Alois Riegl: Spätrömische Kunstindustrie, Darmstadt 1992.
40
41
44
44
45
�15. Owen Jones, Grammar of Ornament, S. 67. 16. Owen Jones, Grammar of Ornament, S. 68.
tionierte Stufung aufweist, erzeugt die in der Figur B die beiden Kurven miteinan‐
der verbindende Vertikale aufgrund ihrer Länge einen Bruch im Liniengefüge: Das
Auge ist daran gehindert über die Zäsur hinwegzugleiten und die Figuration als
Bewegungsfluss wahrzunehmen. Eben dieses irritierende Missverhältnis findet sich
auch bei der Figur D. Komplettiert das Auge die Figur A durch eine imaginäre, in
der Figur C dargestellten Linie, wird es im Fall der Figur D auf konträren Bahnen in
verschiedene Richtungen geleitet, wodurch die Struktur ihre den Blick absorbie‐
rende Kraft verliert. Anderseits darf, damit sich das Auge nicht in einer undurch‐
schaubar bleibenden Ordnung verliert, die Lineatur keine kontinuierlich fließende
sein. Es bedarf verschiedener zu vermittelnder Linientypen, damit sich eine durch
feste Distributionsverhältnisse fixierte Struktur etabliert, welche die Lineatur in
eine den Grund einbindende Flächenformation überführt und die Struktur visuell
als gesetzmäßig verfasstes Ordnungsgefüge transparent werden lässt.
Auf welche Weise die drei Linientypen zusammenwirken, erläutert Jones an‐
hand eines weiteren ‚gestaltpsychologischen‘ Schemas (Abb. 16). Grundlage des
ornamentalen Gefüges ist ein aus geraden Linien bestehendes Raster, das als
solches zwar symmetrisch ausgewogen sei, aber monoton wirke. Werden an den
Kreuzungspunkten des Rasters Diagonallinien eingetragen, wird das Auge von
diesen Spannungspunkten angezogen, was der visuelle Sinn als Wohlgefallen
erlebe. Durch Hinzufügung der aus kurvierten Linien bestehenden Kreise ist
14. Owen Jones, Grammar of Ornament, Tafel XLII.
46
schließlich ein aus den drei Linientypen zusammengesetztes harmonisches
Verhältnis hergestellt, das eine genussvolle Betrachtung eröffne.
47
�17. Albrecht Dürer, Unterweysung der Messung, 1525.
Obwohl ein solches Schema innerhalb der Argumentation dezidiert nicht als
Ornament, sondern als Veranschaulichung des visuellen Zusammenwirkens der
18. Owen Jones, Grammar of Ornament, S. 73.
drei Linientypen zu verstehen ist, verweist es in seiner ersten Stufe – dem Raster –
ton School lehrte, stellt Jones fest, die rastererzeugende Tätigkeit des Webens „give
rendes Liniengerüst, das als velum zwischen Motiv und Bild situiert ist, wie es die
nenen Kenntnissen der Naturgesetzlichkeiten, ein ornamental produktives
dennoch auf die spezifische Existenzebene des Ornaments, das gleichsam innerhalb
der Quadratur situiert ist. Hier ist sie jedoch kein virtuelles, die Motivik adjustie‐
bekannte Darstellung in Dürers Unterweysung der Messung (1525) zeigt (Abb.17).
Auch ist das Raster nicht als Hilfsliniengefüge im Bild situiert, das innerbildlich eine
der Darstellung externe Metaebene eröffnet, die nur um willen der Übertragbarkeit
des Motivs nicht wieder entfernt wird. Bei dem fraglichen Raster handelt es sich
vielmehr um eine die ornamentale Formierung bestimmende Modifikationsmatrix,
die als Grundlage der ornamentalen Struktur unauflöslich mit dieser verwoben
ist.46
Entwicklungsgenetisch betrachtet hat das beim Weben materiell angefertigte
Raster überhaupt erst eine naturanaloge Ornamentik evoziert. In Übereinstimmung
to a rising people the first notion of symmetry, arrangement, disposition, and
distribution of the masses”.47 Damit ist bereits, unabhängig von empirisch gewon‐
Empfinden für das die Natur durchwaltende „universal law of equilibrium“
gegeben. Darüber hinaus bleibt die Materialität von Jones innerhalb seiner von der
geistigen Entwurfstätigkeit her gedachten Ornamenttheorie allerdings unberück‐
sichtigt und wird erst durch Semper als formbestimmender Faktor aufgezeigt.
Bei Jones sind die Raster Idealitäten, innerhalb deren sich die Ornamentik noch
vor ihrer materiellen Ausführung konkretisiert. So zeigen die diagrammatischen
Schemata (Abb. 18) zwei um diagonale Linien ergänzte Rasterstrukturen, die der
auf Tafel XXXIX gezeigten maurischen Ornamentik unterliegen. Damit aus den
Eine Verhältnisbestimmung von Matrix, Raster und Ornament bietet Christian Spies: Das
Ornament als Matrix. Zwischen Oberfläche und Bild. In: Vera Beyer; Christian Spies (Hg.):
Ornament. Motiv – Modus – Bild, München 2012, S. 374‐400.
47 Jones 1856, S. 24. Gottfried Semper beschreibt die textile Kunst als „Urkunst“, da sie neben der
Zweckmäßigkeit zuerst eine auf Verschönerung abzielende bewusste Formenwahl ermöglichte,
womit Ornament und Kunst als gleichursprünglich gefasst werden (Gottfried Semper: Der Stil in
den technischen und tektonischen Künsten, oder Praktische Ästhetik. Ein Handbuch für Techniker,
Künstler und Kunstfreude. Erster Band: Textile Kunst, Frankfurt a. M. 1860, S. 13). Vgl. Dazu: Birgit
Schneider: Die Konsequenz des Stoffes. Eine Medientheorie des Ornaments ausgehend von
Gottfried Semper. In: Ornament. Motiv – Modus – Bild. Hrsg. v. Vera Beyer u. Christian Spies,
München 2012, S. 255‐279.
48
49
mit Gottfried Semper, der während seines Londoner Exils nicht allein an der
Einrichtung der Weltausstellung beteiligt war, sondern auch an der South Kensing‐
46
�Abkunft der bei der selbstreproduktiven Verästelung des Rasters waltenden
graduellen Übergänge der Linientypen.
Abschließend fasst Jones die wichtigsten, vom maurischen Ornament erfüllten
Gesetzmäßigkeiten nochmals zusammen: „equal distribution, radiation from parent
stem, continuity of line, tangential curvature”.49 Diese durch Dressers Emblem
mustergültig in ihrem Zusammenwirken exemplifizierten Prinzipien verbürgen die
innere Lebendigkeit, mit der das Diagramm ornamental belebt wird.
Vermittels der aufgezählten grammatischen Prinzipien, nach denen die drei
Linientypen als syntaktische Elemente miteinander verbunden werden, wird eine
ornamentale Struktur generiert, die als geometrisches Arrangement gegeben ist.
19. Owen Jones, Grammar of Ornament, S. 69.
Diagrammen Ornamente werden, müssen sich die Figur‐Grund‐Relationen visuell
‚substanzialisieren‘. Dies geschieht zum einen durch die ‚Verräumlichung‘ des
Liniengefüges zu Binnenflächen, zum anderen durch die bisher unberücksichtigt
Folglich lautet die achte proposition: „All ornamentation should be based upon a
geometrical construction“.50 Dabei sind, gemäß der klassischen Definition der
Grazie, diejenigen Proportionsverhältnisse am schönsten, deren Gesetzmäßigkeit
am verborgensten bleibt, weshalb Dresser den „want of simplicity“ als einen „chief
fault” bezeichnet.51 Vielmehr seien, im Anschluss an Hogarths Line of Beauty,
Beide
intrikate Formverhältnisse höherer Ordnung zu kreieren, die nicht auf der
die das Ornament vom Schema unterscheidet und mit den lebendigen Strukturen
nen des menschlichen Körpers (1854) dargelegten Goldenen Schnitt zu Nutze
gebliebene, ebenfalls gesetzmäßigen Verhältnissen folgende
Farbgebung.48
Mittel aktivieren die internen Figur‐Grund‐Wechselwirkungen, wodurch eine
Dressers Muster‐Emblem entsprechende ornamentale Räumlichkeit entfaltet wird,
der Natur verbindet, denen in der schematischen Darstellung kein Artikulations‐
raum zur Verfügung steht.
Die grammatischen Prinzipien, nach denen die drei Linientypen zu vermitteln
seien, leitet Jones folgerichtig wiederum aus der Natur ab (Abb. 19). Wie die
veristische Darstellung des Akanthus (Abb. 12), veranschaulicht hier das Weinblatt,
dass das Raster nicht vorgängig gegeben ist, sondern sich seinerseits innerhalb
eines dynamischen Prozesses entfaltet, der im Pflanzenreich stets von der Hauptli‐
nie eines Mutterstamms ausgeht, die sich zusehends verästelt. Damit ist das
ornamentale Raster eine lebendige Struktur, dessen Selbstreproduktion wiederum
das Kastanienblatt aufzeigt, indem ein Blatt – proportional variiert – aus dem
anderen hervorwächst. Das eingerollte Blatt schließlich demonstriert die natürliche
48
22 der von Owen Jones formulierten 37 prospositions beziehen sich auf Farbverhältnisse.
50
Kreisform, sondern der Hyperbel basieren und sich proportionale Differenzialver‐
hältnisse wie den von Adolf Zeising in seinem Werk Neue Lehre von den Proportio
machen.52
VII. Die botanische Natur des Ornaments
Stellt die Natur mit der Lotusblüte auf der ersten Tafel zum ägyptischen Ornament
den Initialpunkt der ornamentgeschichtlichen Entwicklung dar, sind, wie Jones
anhand des maurischen Ornaments aufzeigt, auch für die abstraktesten Ornament‐
formen aus der Natur deduzierte Gesetzmäßigkeiten maßgeblich. Darüber hinaus
Jones 1856, S. 69.
Jones 1856, S. 5.
51 Dresser 1873, S. 108.
52 Dresser 1862, S. 92, 102.
49
50
51
�schließt die Grammar of Ornament mit einem Kapitel „Leaves and Flowers from
Nature“. Die zehn Tafeln dieses Teils hat Dresser angefertigt. Sie stellen seine
ersten öffentlichen Arbeiten dar und können als Ausgangspunkt seines eigenen
Schaffens angesehen werden.
Die erste Tafel (Abb. 20) zeigt abermals Kastanienblätter, die so gegeben sind,
als ob sie sich von unten gegen eine Glasscheibe drückten, wodurch ihre Struktur
im Modus einer raumreduzierenden flatness freigegeben wird und die schattenlo‐
sen grün‐weißen Blätter vor dem ockerfarbenen Grund in einer äquidistanten
Distribution als Strukturverbund erscheinen. Die Überschneidungen der Blätter
und die in den Raum zurücktretenden verschatteten Stiele verweisen allerdings
darauf, dass es sich nicht um Ornamentik, sondern um eine veristische Darstellung
handelt, welche die Blätter jedoch nicht allein für ihre ornamentale Verwendung
prädisponiert, sondern zudem das gesamte Wissen ornamentaler Gesetzmäßigkei‐
ten enthält: „The single example of the chest‐nut leave contains the whole of the
laws which are to be found in Nature.“53 Dennoch sind, Jones` und Dressers
Verständnis zum Trotz, solche ornamentalen Vorstudien, insbesondere von der arts
and crafts‐Bewegung, als Ornamentik verwendet worden.
Bereits im Vorwort der Grammar hatte Jones gefordert: „return to Nature for
fresh inspiration”.54 Eine Forderung, die jedem Studenten mit dem letzten Teil der
Grammar aufgegeben war, dessen Tafeln der Naturbetrachtung die adäquate
ornamentale Ausrichtung verleihen sollten. Damit endet der ornamentgeschichtli‐
che Parcours der Grammar mit dem Ruf: „Zurück zur Natur!“ Eine Parole, die aber
nicht im Sinne Rousseaus als Versuch missverstanden werden darf, eine verloren‐
gegangene Naivität wiederzugewinnen, welche die wilden Stämme gesetzmäßig
formierte Ornamente habe schaffen lassen. Schließlich, so zitierten wir Jones,
entfaltet sich der ornamentale Trieb erst mit dem zivilisatorischen Wissensschub
der Ägypter, die ihre Ornamentik nicht aus Naivität, sondern aufgrund ihres
Wissens als Erste unmittelbar aus der Natur ableiteten. Der gravierende Unter‐
schied zur ägyptischen Epoche besteht allerdings darin, dass die Ornamentik – wie
53
54
Jones 1856, S. 157.
Jones 1856, S. 2.
20. Owen Jones, Grammar of Ornament, Tafel XCI.
52
53
�jeder eigenständige ornamentale Stil – symbolisch den gemeinsamen Grund des
besteht der Ausdrucksgehalt nun in den Strukturgesetzen der Natur selbst. Der
angesichts der ornamentalen Sprachverwirrung der Weltausstellung aber offen‐
feststellt: „Knowledge is the great source of ornament”.58 Damit fällt der kulturrela‐
Ornamentsprachen keinerlei die gegenwärtige Gesellschaft bindende Kraft auf,
Emblem programmatisch veranschaulichte Ziel zu erreichen, stehen zwei mitei‐
kulturellen Gefüges zum Ausdruck bringt, wodurch das Ornament eine die
Gesellschaft bindende sympathetische Kraft ausstrahlt. Ein solcher Grund ist
sichtlich verlorengegangen. Jones spricht von einem „uncertain state“, sogar von
einem „present chaos“.55 Die kopierten Stile weisen als historisch vergangene
weshalb Jones` durchaus berechtigte Befürchtung darin bestand, mit seiner
Grammar of Ornament zum bloßen Kopieren historischer Stile noch beizutragen,
obwohl sein Werk dezidiert kein Vorlagenbuch sein sollte. Vor diesem Hintergrund
ist der letzte Teil des Buches als programmatischer Einschnitt innerhalb des
ornamentgeschichtlichen Ablaufs zu verstehen, der sich zur Schaffung einer
zeitgemäßen Ornamentik nicht einfach zurückblättern lasse.
absolute Maßstab zur qualitativen Beurteilung der Ornamentik soll seinerseits
ornamental zum Ausdruck gebracht werden, weshalb Dresser programmatisch
tive Aspekt der Ornamentik mit ihrer naturalistischen Rückbindung zusammen, die
subjektive Seite soll in der objektiven aufgehen. Um dieses von Dressers Muster‐
nander verbundene Wissensressourcen zur Verfügung: die von Owen Jones`
Grammar abgedeckte Ornamentgeschichte und die Botanik, deren Erkenntnisse
Dresser in seinen Schriften für eine ornamentale Entwurfslehre fruchtbar gemacht
hat, um Kunst und Wissenschaft wieder einander anzunähern – „art and science
dwell too widely apart”. 59
In einer zwölfteiligen, 1858 in der South Kensington School abgehaltenen Vorle‐
Welchen Gehalt aber könnte eine neue Ornamentik zum Ausdruck bringen? Auf
sungsreihe Botany as adapted to the arts and artmanufactors, fordert Dresser
‚instiktmäßig‘ eine Ornamentik geschaffen wurde, welche die jeweilige kulturelle
Beobachten einer einzelnen Pflanze – wozu er den Zeitrahmen von einem Monat
sende Antwort: Das Charakteristikum der eigenen Zeit bestehe in einem
zur Anwendung kommt.
welchen semantischen Fokus hin sind die als propositions formulierten Regeln
anzuwenden, wenn seit jeher vermittels eines ornamentalen Kunstwollens
Formation wie selbstverständlich adäquat zum Ausdruck brachte? Hierauf gibt
Dresser die für die South Kensington School und ihre Entwurfspraxis richtungswei‐
epistemischen Vorsprung, weshalb er dazu aufruft: „Manifest the knowledge of our
age! Proclaim to generation yet unborn the nature and extent of our discoveries”.56
Folglich stellt das Wissen selbst, einschließlich seiner methodischen Gewinnung
denjenigen Gehalt dar, den eine künftige Ornamentik zum Ausdruck zu bringen
habe: „[...] we have knowledge which is waiting to be embodied in form […]”.57
Damit ist nicht allein ornamentgeschichtlich, sondern innerhalb der geistesge‐
schichtlichen Entwicklung der Menschheit ein prekärer Punkt erreicht: Wurde in
der Ornamentik der Vergangenheit unbewusst auf die Strukturprinzipien der Natur
zurückgegriffen, um sie gemäß eines Ausdruckswillens produktiv anzuwenden,
Jones 1856, S. 156.
Dresser 1862, S. 168.
57 Dresser 1862, S. 15.
55
56
54
eindringlich zum Studium der Botanik auf. Im Rückgriff auf Goethes Versuch die
Metamorphose der Pflanze zu erklären (1790) erläutert er, dass das minuziöse
empfiehlt – mehr Wissen eröffne, als das hastige Betrachten der floralen Fülle
vieler Länder.60 Ein Wissen, dass in der prozessualen Struktur des Muster‐Emblems
Die von Jones vor allem auf die äußerlich sichtbaren Strukturen bezogenen
Gesetzmäßigkeiten werden von Dresser nun im ‚Innenraum‘ der Pflanzen aufge‐
funden, wodurch ornamentale Strukturen hervorgebracht werden können, die
weitgehend vom pflanzlichen Phänotyp entkoppelt sind und dennoch denselben
Dresser 1862, S. 17.
Dresser 1862, S. 43. Für seine 1859 erschienenen Werke Unity in Variety as Deduced from the
Vegetable Kingdom und The Rudiments of Botany, Structural and Physiological erhielt Dresser auf
Betreiben von Matthias Schleiden seitens der Jenaer Universität die Ehrendoktorwürde (David
Brett. The Interpretation of Ornament. In: Journal of Design History 1,2, (1988), S. 103‐111, hier S.
110). 1860 sollte schließlich die Berufung Dressers auf den Lehrstuhl für Botanik der Londoner
Universität erfolgen. Schleidens eigene Bücher, die wiederum Dresser als Ausgangspunkt seiner
Forschungen dienten, waren auf Englisch verfügbar: The Plant. A Biographie (1848) und Principles
of Scientific Botany (1849).
60 Dresser 1862, S. 23.
58
59
55
�organischen Strukturprinzipien folgen; Prinzipien, wie sie etwa aus Matthias
Schleidens 1838 für die Pflanzen formulierter Zelltheorie hervorgehen, nach der
das Kontinuum des Wachstumsprozesses nicht homogen, sondern – wie auf
Dressers Muster‐Emblem – durch die selbstreproduktive Vervielfältigung eines
Grundelements in sich diskret strukturiert ist und als Zellenverbund eine lebendige
Rasterform bildet.61 Damit wird die Ornamentik selbst zur Wissenschaft, deren
Forschungspraxis das ornamentale Entwerfen darstellt, das auf nicht weniger zielt
als „to discover the ultima thule of life“.62
Für ein solches ornamentales Erforschen der Prozesse des Lebendigen kann die
Botanik nicht der Ziel‐, sondern nur der Ausgangspunkt sein. Neben den anderen
an der South Kensington School unterrichteten naturwissenschaftlichen Disziplinen
stellt sie aber aus mehreren Gründen die Leitdisziplin dar. Sie lässt nicht allein die
struktur des Organischen garantiert das Kristalline die sich noch in unendlicher
Repetition durchhaltenden, gesetzmäßig verfassten Strukturverhältnisse. Damit
liefert Dresser eine aus dem Zentrum des Organischen abgeleitete Rechtfertigung
für die Prävalenz der unveränderlichen Struktur gegenüber der veränderlichen
äußeren Erscheinung, von welcher zur Gewinnung einer conventional form
abstrahiert werden müsse.
Diese Abstraktion abstrahiert nun gerade nicht von der Lebendigkeit, wodurch
sie einzig eine tote Form hervorbringen würde, wie Ruskin der South Kensington
School vorwirft, sondern zielt geradewegs auf den Kern des Lebendigen.64 Damit
zeigen sich die späterhin von Worringer in Abstraktion und Einfühlung (1907)
schroff gegeneinander gestellten Paradigmen des Organischen und des Kristallinen
hier in gegenseitiger Durchdringung, wobei die abstrakte Ornamentik der South
Strukturen des Lebendigen auf eine anschauliche Weise zugänglich werden; der
Kensington School sogar dezidiert das Potenzial einer Einfühlung bereitstellt, die
Pflanzen die anorganische und die organische Natur miteinander verbinden.63 In
werden.
Flora kommt als Untersuchungsgegenstand darüber hinaus innerhalb der als
prozessualer Zusammenhang verstandenen Natur eine Schlüsselposition zu, da die
Unity in Variety as Deduced from the Vegetable Kingdom (1860), dem botanischen
Propädeutikum zur Art of Decortive Design, weist Dresser darauf hin, dass die
Zellkerne der Pflanzen eine kristalline Struktur aufweisen. Als festgefügte Kern‐
In Rekurs auf Schleiden ist für Dresser die Zelle das strukturbildende Apriori der Pflanzenfor‐
men: „The prototype of all vegetable structures is a cell” (Christopher Dresser: Unity in Variety,
London 1860, S. 6). Daher gilt im Pflanzenreich das auch für die Ornamentik fundamentale
Prinzip: „[...] the growth in principle consists in nothing more than the addition of sucessive units
[...] (Dresser 1860, S.33). Des Weiteren stellt Dresser fest: „[...] all vegetable increase by developing
in a centrifugal manner“ (Dresser 1860, S. 12), was die Wirbelmotivik seines Muster‐Emblems
ornamental zur Darstellung bringt.
62 Dresser 1862, S. 49. Barbara Whitney Keyser arbeitet vor diesem Hintergrund die Relevanz der
auf morphologischen Strukturäquivalenzen basierenden transzendentalen Anatomie, wie sie von
Richard Owen vertreten wurde, für die Ornamentik der South Kensington School heraus (Barbar
Whitney Keyser: Ornament as Idea. Indirect Imitation of Nature in the Design Reform Movement.
In: Journal of Design History 11,2 (1998), S. 127‐144).
63 Dresser 1862, S. 118: „[...] the vegetabel world stands between the mineral and the animal
kingdom – that vegetable arrange the mineral constituents of the earth into organic matter such as
is suited to the bulding up the animal body – […]”. Pflanzen vermitteln zwischen dem minerali‐
schen und dem animalischen Bereich der Natur, indem sie Mineralien in organische Stoffe
umwandeln, die wiederum den animalischen Körper aufbauen.
61
56
Dresser als sympathetische Kommunikation konzeptualisiert, der wir – als höchster
Form der ornamentalen Wissenschaft – im abschließenden Kapitel nachgehen
VIII. Die Poetik des Ornaments
„The designer`s mind”, formuliert Dresser die einzulösende Utopie der ornamenta‐
len Wissenschaft, „must be like the vital force of the plant.”65 Ist dies der Fall, ist der
Ornamentkünstler keineswegs zum bloßen Medium der Natur geworden, in dessen
Werken sich ihre Wachstumsprinzipien als potenziell unendlich variable Struktu‐
ren selbst zur Darstellung bringen. Vielmehr ist er ein zweiter Schöpfer, der seine
Ideen in einer der Natur analogen Weise ornamental ausformt. Damit ist die
64 John Ruskin: The Deteriorative Power of Conventional Art over Nations (1858). In: The Two
Path: Being Lectures on Art and its application to Decoration and Manufacture, Delivered in 1858‐
1859, Kent 1887, S. 1‐53.
65 Dresser 1862, S. 188 f. Erste Überlegungen zum Status des ‚mind‘ in Dressers Ornamenttheorie
bietet: Andrea Schlieker: Theoretische Grundlagen der „Arts and Crafts“‐Bewegung. Untersuchun‐
gen zu den Schriften von A. W. N. Pugin, J. Ruskin, W. Morris, C. Dresser, W. R. Lethaby und C. R.
Ashbee, Bonn 1986, S. 171‐173.
57
�höchste der von Dresser angeführten drei Stufen ornamentalen Schaffens erreicht.
Zuunterst steht „natural adaption”, die angepasste Wiedergabe der äußeren
Erscheinung der Pflanzen, wie sie an den westlichen Produkten der Weltausstel‐
lung allerorts zu beobachten war und insbesondere bei den sich durch eine
materielle flatness auszeichnenden, ikonisch verfassten Gegenständen praktiziert
worden ist (Abb. 21), während die indischen Teppiche eine ihrer materiellen
flatness adäquate ornamentale flatness aufweisen.66
Auf „natural adaption“ folgt „conventional treatment”, welches – wie Dressers
Kastanienblatt – die von allen äußerlichen Einflüssen purifizierte „intention of
nature“, also einen geistigen Gehalt veranschaulicht. Dabei stellt die Konturlinie für
die Flächenstruktur der conventional form zwar ein entscheidendes Moment dar,
sie wird aber keineswegs durch diese konstituiert. Während die Umrisslinie als
eine gleichsam eigenständige Entität die äußere Form bestimmt, soll demgegenü‐
ber das innere Design des Erkenntnisgegenstandes, von dem die conventional form
abgeleitet ist, zur Darstellung kommen, wofür die Farbe eine der Linie nebengeord‐
nete Bedeutung hat. Die conventional form ist keine durch eine Konturlinie
bestimmte Figur, sondern eine aus der raumreduzierenden flatness hervorgehende,
sich aus relationalen, ihrerseits flächenbestimmten Teilen zusammensetzende
Figuration, weshalb Dresser fordert, auf die Ausarbeitung der Zwischenräume
ebensoviel Sorgfalt zu verwenden wie auf die positiven Formen selbst.67 Der sich
figurativ‐flächenhaft aufspannende Charakter der conventional form, auf welchem
auch die genuin ornamentale Ausformung basiert, stellt den wesentlichen Unter‐
schied zum konturbestimmten klassizistischen Ornament einerseits und zur
kontinuierlichen Lineatur des romantischen Ornaments andererseits dar.
Anhand der conventional form soll vermittels der wesentlichen Merkmale des
Darstellungsgegenstandes ein Schema seines Typus geschaffen werden. Grundlage
des Schemas ist allerdings nicht der Gegenstand selbst, sondern die Reflexion auf
sein mentales Bild. Wie wirksam solche von mentalen Bildern ausgehenden
Darstellungen sind, belegt Dresser anhand der populären Schematisierung von
66
67
Alle folgenden Zitate: Dresser 1862, S. 37 ff.
Dresser 1862, S. 182.
21. The Industry of All Nations, Illustrated Catalogue, 1851, S. 135.
58
59
�Blumen: Bereits ein Punkt und konzentrisch angeordnete, in einer intensiven Farbe
wurde, sondern – einer idea folgend – selbst geistigen Ursprungs ist. Diese Idee hat
gehaltenen Kreise um diesen Punkt sind hinreichend, um die Idee einer Blume zu
sich allerdings aus den Strukturgesetzmäßigkeiten der Natur zu speisen: „[…] the
trufacsimilie des Darstellungsgegenstandes zu schaffen, ohne dazu das Original
object nor any intention of nature”.71 Diese höchste Stufe ornamentalen Schaffens
erwecken.68 Demgegenüber muss die wissenschaftliche conventional form aller‐
dings all jene Eigenschaften veranschaulichen, die es ermöglichen, nach ihnen ein
next grade of decorative art is the embodying in form a mental idea which has been
suggested by nature, and yet the form neither represents any actually existing
gesehen haben zu müssen.69 In dieser Hinsicht ist die conventional form ein Bauplan
ist im Verhältnis zur untersten, der „natural adaption“, als „embodiment of mind in
auf die in ihm ausgestellten Pflanzen bezieht, denen im Ausstellungskatalog ein
Schöpfung übersteigende geistige Entität schafft „[a] purely ideal ornament“.73 Statt
seines Darstellungsgegenstandes, worin die Verwandtschaft zur Ingenieurkunst
des Crystal Palace liegt, der sich als überdimensionales ‚Gewächshaus‘ seinerseits
eigenes, von dem an der South Kensington School lehrenden Botaniker und
Zoologen Edward Forbes verfasstes Kapitel – On the vegetable world as contributing
to the great exhibition – gewidmet ist.70
Zur Erstellung der conventional form einer Pflanze sind zwei ihrer Ansichten –
Aufsicht und Querschnitt – zu bevorzugen. Sie verobjektivieren den subjektiven
form” keine abgeleitete Imitation, sondern selbstverursachte Kreation: „it being
wholly a creation of the soul”.72 Eine Kreation, die eine die Faktizität der ontischen
Gedankenbilder als conventional forms von empirischen Gegenständen abzuleiten,
besteht die höchste Form der Ornamentik also darin, Gedankenbilder zu schaffen,
deren Darstellungsgegenstand selbst gedanklich verfasst ist. Hiermit eröffnet sich
die künstlerisch‐poetische Dimension der ornamentalen Wissenschaft.
Wissenschaft ist eine solche Ornamentik nicht allein, weil sie auf den qua con
Blickpunkt und offenbaren in ihrer der conventional form affinen raumreduktiven
ventional forms entdeckten Strukturgesetzmäßigkeiten der faktischen Schöpfung
werden. Damit gibt die conventional form durch ein Weniger an Wahrnehmbaren
so Dresser, „is the image in man of the creator”.74 Als apriorisches Prinzip kann der
Prävalenz zugleich die wesentlichen Merkmale der Pflanze, die dann, vom phäno‐
menalen Überschuss purifiziert, in der conventional form als Strukturgefüge fixiert
mehr zu sehen: Das vermittels akkurater Betrachtung entstandene, zur konkret
sichtbaren conventional form präzisierte mentale Bild ermöglicht es dem Betrach‐
ter, den Darstellungsgegenstand wesentlich zu erfassen, so dass er ihn mental zu
re‐konstruieren vermag. Damit wird der Rezipient zum produktiven Nachschöpfer;
nicht des als conventional form gegebenen ornamentalen Bildes, sondern des
Erkenntnisgegenstandes selbst, den er dank seiner ornamentalen Darstellung
geistig nachzubilden vermag.
Die conventional form ist ein „vehikle of thougt“ – ein Gedankenbild, das dann
am reichhaltigsten ist, wenn es nicht von einem realen Gegenstand abgeleitet
Dresser 1862, S. 32.
69 Christopher Dresser: Botany, as adapted to the Arts and Art‐Manufacture. Lectures on Artistic
Botany in the Department of Science and Art XI, In: Art Journal 48 (Dec 1858), S. 362‐ 364, hier S.
363.
70 Edward Forbes: On the vegetable world as contributing to the great exhibition. In: The Industry
of All Nations 1851. Illustrated Catalogue, London 1851, S. I‐VIII.
68
60
basiert, sondern vor allem, da nun der den Menschen mit Gott verbindende Geist
als strukturgesetzmäßig verfasster Erkenntnisgegenstand zugänglich wird. „Mind”,
Geist allerdings nicht als solcher angeschaut und daher auch nicht in eine conven
tionl form gebracht werden. Aus diesem Grund bleibt die ornamentale Kreation auf
die entdeckten Strukturgesetzmäßigkeiten der vegetabilen Natur verwiesen: „[…]
modified and adapted, and clothed in the mind of the artist, and yet be sufficiently
characteristic to awaken the desired thought.”75
Während die Idee einer naturalistisch fundierten ornamentalen Einkleidung
bedarf, spricht sich sowohl im Eingekleideten wie in der Art der Einkleidung der
ornamental Präsenz gewinnende Geist des Urhebers aus: „[…] the ornamental
Dresser 1862, S. 39.
Dresser 1862, S. 40.
73 Dresser 1862, S. 40.
74 Dresser 1871, S. 218.
75 Dresser 1862, S. 33. Entsprechend lautet Jones` proposition 13: „Flowers and other natural
objects should not be used as ornaments, but conventional representations founded upon them
sufficiently suggestive to convey the intended image to the mind […]” (Jones 1856, S. 6).
71
72
61
�composition […] must embody the mind of its producer“.76 In eben diesem geistigen
Gehalt liegt die ornamentale Qualität des Ornaments, während die auf rein
Ausformung auf eine Sublimierung der ornamentalen Struktur zielt. So zeichne sich
das Ornament der Griechen weniger durch eine spezifische Symbolik als durch
mechanische Weise erzeugten Formen, wie diejenigen des Kaleidoskops, dieser
jahrhundertelange Verfeinerung der einmal gefundenen Formen aus.80 Die
which mind is conveyed throughout the world”.78
Strukturen verbürgt. Damit ist die höchste Form der Ornamentik keineswegs
gedanklichen Dimension entbehren.77 Aufgrund des für das Ornament konstituti‐
ven mentalen Gehalts stellt Dresser fest: „Decorative art is an ornamental car in
Der Weg zur Erzeugung derart gedanklich verfasster ornamentaler Formen war
das Experiment, das eine analytische und eine synthetische Seite aufwies: Im
zerlegenden Experimentieren wurden Strukturen der Pflanzen entdeckt, die
ornamentale Ideen evozierten. Den analytischen Vorgang ornamentaler Konventio‐
nalisierung beschreibt Richard Redgrave rückblickend als revolutionäre Methode
der Formgewinnung: „To erxercise their invention, the following method was
devised by the art superintendent – a method wholly new […]. It consisted first in
the ornamental analyses of plants and flowers, displaying each part separately
according to its normal law of growth, not as they appear viewed perspectively, but
diagrammatically, flat to the eye; so treated, it was found that almost all plants
contain many distinct ornamental elements, and that the motives to be derived
from the vegetable kingdom were
inexhaustible.”79
Die analytisch entdeckten
Strukturen wurden zum Ausgangspunkt eines synthetischen Experimentierens, das
eine durch diese Strukturen hervorgerufene poetische Idee vermittels von Form‐
und Farbverhältnissen in ein adäquates ornamentales Gedankenbild überführt.
Damit kann die derart praktizierte Erzeugung von Ornamenten als eine Form von
Gedankenexperimenten gefasst werden, die darauf zielen, einer Idee konkrete
Anschauung zu verleihen.
Die semantische Artikulation der Idee speist sich bei der idealen Ornamentik
nicht aus ikonografischer Symbolik, wie dies beim Lotus der Ägypter als Fruchtbar‐
keitssymbol der Fall war, sondern aus der jeweiligen Konkretion der Formen, deren
potenziell universale Verständlichkeit solcher aus ‚sublimierten‘ Formen bestehen‐
den ornamentalen Gedankenbilder wird wiederum durch ihre naturanalogen
esoterisch, vielmehr hat sie einen „cosmopolitan character“, der das Esoterische als
konkrete Formerfahrung exoterisch zugänglich werden lässt.81 Sie ist ein a‐
symbolischer Symbolismus, dessen Gehalt sich in einer lebendigen Anschauung
vermittelt, wie dies eingangs anhand von Dressers Muster‐Emblem dargelegt
worden ist.
Die Kapazität zu einem unmittelbaren Verstehen unterscheidet die Ornamentik
kategorial von der Historienmalerei: „Ornamentation is [...] symbolised imagination
or emotion, simply and purely; and herein it differs essentially from pictorial art,
which in its highest development is symbolized imagination or emotion, represen‐
ting idealized reality”.82 Damit wird – was die Grenzen der konventionellen Kunst
übersteigt – die Formierung eines semantischen Gehalts unter Absehung einer
gegenständlich verfassten Bildrealität ermöglicht. Vor diesem Hintergrund zeigt
sich der Ursprung der abstrakten Kunst aus dem Geiste des Ornaments.83
Das anhand von Dressers Muster‐Emblem eingangs exemplifizierte Seh‐Erlebnis
ist eine unmittelbare mind‐to‐mind Kommunikation,84 die es erlaubt, den als
conventional form gegebenen ornamental verfassten Gedanken, die „poetic idea”,85
in einer sie re‐produzierenden Weise nachzuvollziehen.86 Ziel ornamentaler Kunst
ist es, dass der Künstler ein möglichst intensives Erleben der ornamental evozier‐
76 Christoper Dresser: Development of ornamental Art in the International Exhibition, London
1862, S. 6.
77 Dresser 1862, S. 96.
78 Dresser 1862, S. 35.
79 Richard Redgrave: A century of painters of the English School, with critical notes of their works,
and an account of the progress of art in England. Bd. II, London 1866, S. 564 f.
Dresser 1873, S. 9.
Dresser 1871, S. 219.
82 Dresser 1871, S. 218.
83 Vgl. dazu: Markus Brüderlin: Die Einheit in der Differenz. Die Bedeutung des Ornaments für die
abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts. Von Philipp Otto Runge bis Frank Stella, Wuppertal 1995.
84 Dresser 1862, S. 34.
85 Jones 1856, S.23.
86 Dresser 1862, S. 34.
62
63
80
81
�ten, als Erkenntnisgegenstand gegebenen „mental idea“ bewirkt.87 Damit ist das
ornamentale Erkennen affektiv bestimmt. Die in ihrer Intensität mit der Wirkung
separation in order to impress the cosmetic of nature on the production of human
industry”.92 Die Kosmetik der Natur ist also nichts um ephemerer Effekte willen
von Musik in Analogie gesetzte mentale Bewegtheit wird von Jones und Dresser als
äußerlich Aufgetragenes, sondern basiert auf der Ordnungsstruktur des Kosmos
power“.89 Der repose entspricht ein als „great want of repose“ anthropologisch
tet. Um als ein derartiger „moral teacher“ zu wirken, muss die Ornamentik „truthful,
„repose“
gefasst,88
wobei Dresser den energetischen Aspekt weit mehr als Jones
betont: „Nothing is so pleasing as the [ornamental] manifestation of a strong vital
fundiertes psychisches Verlangen, welches das Ornament, wie das Brot für den
Körper, zur mentalen Notwendigkeit
macht.90
‚Repose‘ wird einerseits im Anschluss an Kants als harmonisch austariertes,
lustvoll empfundenes freies Spiel der Verstandeskräfte, andererseits, im Anschluss
an Schopenhauer, als „absent of any want“ gefasst, wobei die repose allerdings –
anti‐schopenhauerianisch – von einer die Schöpfung durchwaltenden Harmonie
getragen wird. Eben diese Harmonie soll Dressers Muster‐Emblem in ihrer
selbst, die an der Oberfläche zur sichtbaren Schönheit wird. Sie vermag den Geist
des Betrachters zu veredeln, was eine Sensibilisierung seines moral sense beinhal‐
beautiful and powerful in expression [...]“ sein.93 Schlechte Ornamentik hingegen
vermag den Charakter zu degradieren. Damit ist der für die Kunst der Aufklärung
fundamentale Zusammenhang des Wahren, Guten und Schönen, bevor er sich als
Leitkategorie der Kunst gänzlich auflösen sollte, auf das Terrain der Ornamentik
hinübergewechselt, die damit für eine kurze Zeit zur höchsten aller Künste
aufsteigt.
strukturellen Lebendigkeit erfahrbar machen, womit es zu einem überkonfessionel‐
len Mediationsbild wird. Durch seine eingangs analysierte räumliche wie zeitliche
Sowohl‐als‐auch‐Struktur, nach der jedes seiner Elemente sowohl flächen‐, wie
raum‐, sowohl bewegungs‐ wie simultanitätsbildend ist, ist die Betrachtung des
übergeordneten harmonisch austarierten Gefüges des Musters zugleich eine Form
höchster Bewegtheit. Ein gutes Ornament, so Dressers test of intimacy, hält diese
Bewegtheit aufrecht; es zeichnet sich dadurch aus, dass, je länger seine Betrachtung
währt, es desto schöner wirke.91
Die Schönheit als Kern der ornamentalen Poesie stellt bereits die Primärqualität
der empirisch gewonnenen conventional form dar, wie es William Dyce in seinem
zur Gründung der Government School of Design verfassten programmatischen
Lehrbuch von 1842/43 darlegt. Mit der qua mentaler Reduktion freigelegten
Struktur werde zugleich die essentielle Schönheit des Gegenstandes extrahiert:
„Beauty is a quality separable from nature`s objects. […] [The Designer] makes the
Dresser 1862, S. 39.
Jones 1856, S. 5 (proposition 3), Dresser 1862, S. 150.
89 Dresser 1862, S. 98.
90 Jones 1865, S. 15.
91 Dresser 1862, S. 6.
Basel, 2012
87
88
64
92 William Dyce: The Drawing Book of the Government Schools of Design, London 1842‐43. Zitiert
nach: Brett 1986, S. 62.
93 Dresser 1871, S. 220
65
�Literatur
Ausstkat.: The Industry of All Nations 1851. Illustrated Catalogue, London 1851.
Bätschmann, Oskar: Realismus im Ornament. Ferdinand Hodlers Prinzip der Einheit.
In: Ferdinand Hodler. Eine symbolistische Vision. Hrsg. v. Katharina Schmidt,
Ostfildern 2008, S. 19‐33.
Bell, Quentin: The Schools of Design, London 1963.
Beyer, Vera; Christian Spies (Hg.): Ornament. Motiv – Modus – Bild, München 2012.
Boehm, Gottfried: Ausdruck und Dekoration. Matisse auf dem Weg zu sich selbst. In:
Matisse. Figur. Farbe. Raum. Hrsg. v. Pia Müller‐Tamm, Ostfildern 2005, S. 277‐289.
Boehm, Gottfried; Gabriele Brandstetter, Achatz von Müller (Hg.): Figur und Figuration.
Studien zu Wahrnehmung und Wissen, Paderborn 2007.
Bosbach, Fanz; John R. Davis: Die Weltausstellung von 1851 und ihre Folgen, München
2002.
Brett, David: Drawing and the Ideology of Industrialization. In: Design Issues 3,2
(1986), S. 59‐72.
‐ ders.: The Interpretation of Ornament. In: Journal of Design History 1,2 (1988), S.
103‐111.
Brown, Frank P.: South Kensington and its Art Training, London 1912.
Brüderlin, Markus: Die Einheit in der Differenz. Die Bedeutung des Ornaments für die
abstrakte Kunst des 20. Jahrhunderts. Von Philipp Otto Runge bis Frank Stella,
Wuppertal 1995.
Cutler, Thomas W.: A Grammar of Japanese Ornament and Design, London 1880.
66
Dresser, Christopher: Botany, as adapted to the Arts and Art‐Manufacture. Lectures on
Artistic Botany in the Department of Science and Art, XI. In: Art Journal 48 (Dec
1858), S. 362‐ 364.
‐ ders.: Unity in Variety as Deduced from the Vegetable Kingdom, London 1860.
‐ ders.: The Art of Decorative Design, London 1862.
‐ ders.: Development of ornamental Art in the International Exhibition, London 1862.
‐ ders.: Ornamentation considered as High Art. In: Journal of the Society of Arts 19 (Vol.
951), 1871, S. 217‐221.
‐ ders.: Principles of Decorative Design, London ‐ Paris ‐ New York, 1873.
Flores, Carol A. Hrvol: Owen Jones. Design, Ornament, Architecture, and Theory in an
Age in Transition, New York 2006.
Frayling, Christopher: The Royal College of Art. One Hundred and Fifty Years of Art and
Design, London 1987.
Greenberg, Clement: Modernist Art. In: Art in Theory. 1900‐1990. An Anthology of
Changing Ideas, Hrsg. v. Charles Harrison u. Paul Wood, 1992, S. 754‐760.
Hetzer, Theodor: Das Ornamentale und die Gestalt, Stuttgart 1978.
Jones, Owen: The Grammar of Ornament, London 1856.
Keyser, Barbara Whitney: Ornament as Idea. Indirect Imitation of Nature in the Design
Reform Movement. In: Journal of Design History 11,2 (1998), S. 127‐144.
Kimball, Fiske: The Creation of Rococo Decorative Style, New York – Dover 1980.
Kirves, Martin: Das gestochene Argument. Daniel Nikolaus Chodowieckis Bildtheorie
der Aufklärung, Berlin 2012.
67
�Sybille Krämer: ‚Operationsraum Schrift‘. Über einen Perspektivenwechsel in der
Betrachtung der Schrift. In: Schrift. Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und
Maschine. Hrsg. v. Gernot Grube, Werner Kogge und Sybille Krämer, München 2005,
S. 23‐57.
Krauss, Rosalind, E.: The Optical Unconscious, Cambridge 1993.
Krubsacius, Friedrich August: Gedanken von dem Ursprunge, Wachsthume und dem
Verfalle der Verzierungen in den schönen Künsten, Leipzig 1759.
Loos, Adolf: Sämtliche Schriften in zwei Bänden. Hrsg. v. Franz Glück, Wien ‐ München
1962.
Lüttichau, Mario‐Andreas von: Die deutsche Ornamentkritik im 18. Jahrhundert,
Hildesheim u.a. 1983.
Macdonald, Stuart: The History and Philosophy of Art Education, London 1970.
Masheck, Joseph: The Carpet Paradigm. Critical Prolegomena to a Theory of Flatness.
In: Art Magazine 51, 1976, S. 82‐109.
Morris, William: Artist, Writer, Socialist, 2 Bd. Hrsg. von May Morris, London 1966.
Nordenfalk, Carl: Bemerkungen zur Entstehung des Akanthusornaments. In: Acta
Archaeologica 5, 1934, S. 257‐265.
Pächt, Otto: Gestaltungsprinzipien der westlichen Malerei des 15. Jahrhunderts. In:
ders.: Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften, München
1977, S. 17‐58.
Piel, Friedrich: Die Ornament‐Grotteske in der italienischen Renaissance. Zu ihrer
Pohlheim, Karl Konrad: Die Arabeske. Ansichten und Ideen aus Friedrich Schlegels
Poetik, München u.a., 1966.
Richard Redgrave: A century of painters of the English School, with critical notes of
their works, and an account of the progress of art in England. Bd. II, London 1866.
Riegl, Alois: Stilfragen. Grundlegung zu einer Geschichte der Ornamentik, Berlin 1893.
‐ ders.: Spätrömische Kunstindustrie, Darmstadt 1992.
Robson, William: Grammigraphia, or the Grammar of Drawing, London 1799.
Ruskin, John: The Stones of Venice, London 1851.
‐ ders.: The Deteriorative Power of Conventional Art over Nations (1858). In: The Two
Paths: Being Lectures on Art and its Application to Decoration and Manufacture,
Delivered in 1858‐1859, Kent 1887, S. 1‐53.
Schlieker, Andrea: Theoretische Grundlagen der „Arts and Crafts“‐Bewegung.
Untersuchungen zu den Schriften von A. W. N. Pugin, J. Ruskin, W. Morris, C.
Dresser, W. R. Lethaby und C. R. Ashbee, Bonn 1986.
Semper, Gottfried: Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder
Praktische Ästhetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreude. Erster
Band: Textile Kunst, Frankfurt a. M. 1860.
Whiteway, Michael: Christoper Dresser. A Design Revolution, London 2004.
Worringer, Wilhelm: Abstraktion und Einfühlung, München 1976.
kategorialen Struktur und Entstehung, Berlin 1962.
Poe, Edgar Allan: Philosophy of Furniture. In: The Complete Works of Edgar Allan Poe,
Bd. 10: Miscellany, New York ‐ London 1900, S. 44‐53.
68
69
�
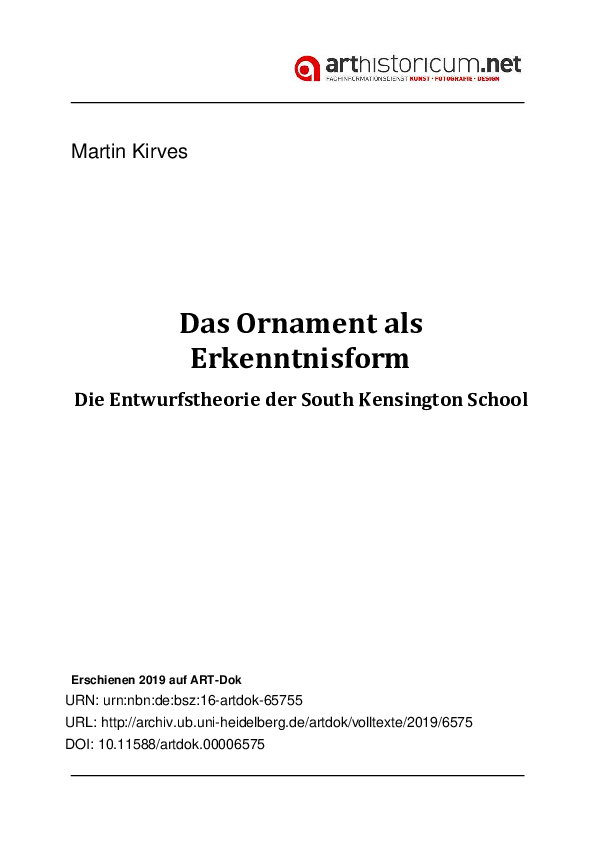
 Martin Kirves
Martin Kirves