Die Form des Buches
Oder warum das absolute Buch bei Novalis Seiten hat
Matthias Bickenbach
Das Wesentliche der Darstellung ist
– was das Beywesentliche des Gegenstands ist. […] Das Beywesentliche
muß nur als Medium, als Verknüpfung
behandelt werden – also nur dieses
Aufnehmende und Fortleitende Merckmal muß ausgezeichnet werden.1
Wenn man Kunstwerke als Kunstwerke
auf ihr Formenspiel hin beobachten
will, muß man nach ihrem Ornament
fragen. […] Indem das Ornament sich
als Verzierung ins Äußerliche verliert,
entsteht es im Inneren neu.2
In einem literaturwissenschaftlichen Kontext nach der Form des Buches zu
fragen, mag absurd erscheinen, darf doch das Wissen darüber, was ein Buch
ist und welche Form es hat, vorausgesetzt werden. Dieses implizite Wissen ist
zugleich für unsere Gesellschaft insgesamt anzunehmen. Die massive Digitalisierung von Texten in den letzten Jahrzehnten scheint dem Wissen über das
Buch als Ding aus Papier sogar zuträglich sein, sind doch vermehrt Publikationen jenseits der Spezialdisziplinen zur Buchwissenschaft zu verzeichnen,
1
2
Novalis: »Fichte-Studien«, in: ders.:Werke, Tagebücher und Briefe, hg. v. Hans-Joachim
Mähl und Richard Samuel, Bd. 2, München 1978, S. 194.
Luhmann, Niklas: »Medium und Form«, in: ders.: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt
a.M. 1995, S. 165-214, hier S. 197.
�140
Matthias Bickenbach
die daran erinnern, was ein Buch ausmacht und wie komplex seine typographisch gestaltete Form inklusive seiner Paratexte ist.3 Doch was genau wäre, mit Novalis formuliert, »das Beywesentliche« als Form des Buches? Hätte
auch das absolute Buch Seiten und ein Cover? Ist der frühromantische Gedanke eines absoluten Buches heute nicht eher als digitaler Hypertext und
universell erweiterbares Netz zu denken? In der Gegenüberstellung von Buch
und absolutem Buch drängt sich die Frage nach der Form des Buches auf.
In der aktuellen Medienkonkurrenz gedruckter und digitaler ›Bücher‹
erodiert praxeologisch wie epistemologisch die Grenze zum Ding aus Papier,
spätestens seitdem von E-Books die Rede ist und second screens zwischen
Smartphones und Tablets das Lesen am Bildschirm so bequem und flexibel
machen wie die Lektüre gedruckter Bücher. Seitdem sind Differenzierungen
hinsichtlich der Form des Textes wie der möglichen Unterschiede für die
Rezeption notwendig geworden. Nach dem allzu gerne bemühten Topos vom
›Ende des Buches‹ in einer Zeit, in der mehr Bücher gedruckt wurden als
jemals, hat der Diskurs über die Zukunft des Buches inzwischen differenzierte Beobachtungen hervorgebracht. Einerseits stellen viele Studien auf
die empirische Verbreitung von Bildschirmmedien ab, andererseits stellen
neuere neurokognitive Untersuchungen eine für etwa 1999 noch undenkbare
Gleichwertigkeit der Lesbarkeit von Texten an den neuen Bildschirmen mit
gedruckten Texten fest.4 Die Literatur- und Medienkulturwissenschaften
reagierten ihrerseits – angesichts der Open-Access-Initiative der EU und des
Bundesbildungsministeriums – mit der Etablierung von Digital Humanities
sowie mit einer Differenzierung von Lektüreformen und –funktionen. Der
abwertende Topos nur oberflächlicher »Häppchenlektüre« am Bildschirm gegenüber einem idealisierten close oder deep reading im Buch wird inzwischen
3
4
Vgl. Houston, Keith: Book. A Cover-to-Cover exploration of the most powerful object of our
time, New York/London 2016; Amaranth, Borsuk: The Book, Cambridge, MA 2018. Für
den deutschen Kontext: Reuß, Roland: Die perfekte Lesemaschine. Zur Ergonomie des Buches, Göttingen 2014; Hagener, Michael: Zur Sache des Buches, 2. überarbeitete Auflage,
Göttingen 2015; Spoerhase, Carlos: Linie, Fläche, Raum. Die drei Dimensionen des Buches in
der Diskussion der Gegenwart und der Moderne, Göttingen 2016.
Der Anteil an E-Books im Buchmarkt stieg nach 2007 mit Amazons »Kindle« deutlich
an, stagniert aber mittlerweile um 10 %. Vgl. Bestle, Sarah: Das Medium E-Book und die
Zukunft der Literatur, München 2011; Gerlach, Jin: Die Akzeptanz elektronischer Bücher.
Eine umfassende Analyse der Einflussfaktoren, Wiesbaden 2014.
�Die Form des Buches
erheblich differenzierter in Bezug auf Leseinteressen und Lektüretechniken
wie scanning, skimming oder hyper reading gefasst.5
Nun hat jüngst die so genannte Stavanger-Erklärung des EU-Forschungsnetzwerks e-read ein Fazit aus zahlreichen empirischen Studien und MetaStudien gezogen, in dem die Gleichwertigkeit der Lektüre am Bildschirm einerseits bestätigt, aber zugleich den Vorteil des Lesens von längeren Texten
in der Form von Büchern für die vertiefende Erfassung, Reflexion und Erinnerung an Inhalte deutlich hervorgehoben.6 Für Bildung, verstanden als intensivierte individuelle Aneignung und Auseinandersetzung, ist die Form des
Buches unverzichtbar. Doch warum genau gerade die Form des Buches trotz
möglicher Gleichrangigkeit der visuellen Erfassung von Text am Bildschirm
vorteilhaft sein soll, ist nach wie vor ungeklärt, die neurokognitive Perspektive
führt das Konzept der »embodied cognition« an.7 Hieran kann eine formtheoretische orientierte Perspektive anknüpfen.8 Dabei soll nicht die Geschichte
des Buches oder unterschiedliche Gestaltungen und Formate im Vordergrund
stehen, sondern ein abstrakt gehaltener Ansatz, der übergreifend in der Form
5
6
7
8
Vgl. Hagner: Zur Sache des Buches (Anm. 3), S. 227f. Hagner unterscheidet fünf Leseformen (narrativ, analytisch, selektiv, scannend, wild); Hayles, Katherine N.: »How We
Read: Close, Hyper, Machine«, in: ADE Bulletin 150 (2010), S. 62-79. Für einen aktuellen Überblick im Kontext des Forschungsnetzwerks »e-read«: Wolf, Maryanne: Schnelles
Lesen, langsames Lesen, München 2019. Der deutsche Titel referiert auf die vorgebliche
Leitdifferenz. Doch langsames Lesen ist nicht notwendigerweise immer und für alle
Stoffe das bessere Lesen wie umgekehrt schnelle Lektüre nicht per se schlechteres Lesen ist. Beide Tempi haben Vor- und Nachteile, die seit dem 18. Jahrhundert diskutiert
werden. Vgl. Bickenbach, Matthias: »Formen individuellen Lesens«, in: Alexander Honold/Rolf Parr (Hg.): Lesen. Grundthemen der Literaturwissenschaft, Berlin/Boston 2018,
S. 256-272.
»Stavanger-Erklärung« (2018) unter: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/
themen/stavanger-erklaerung-von-e-read-zur-zukunft-des-lesens-16000793.html
(zuletzt aufgerufen am 20.8.2019). Anders noch bezüglich Röhrenmonitoren: Ziefle,
Martina: Lesen am Bildschirm. Eine Analyse visueller Faktoren, Münster 2002, vgl. Ziefle,
Martina: »Lesen an digitalen Medien«, in: Christine Grond-Rigler/Wolfgang Straub
(Hg.): Literatur und Digitalisierung, Berlin/Boston 2013, S. 223-250.
Vgl. die Arbeitsgruppe 4 von »e-read«: »The ergonomics of reading (physiology;
haptic & tactile feedback)« unter: http://ereadcost.eu/wg-4 (zuletzt aufgerufen am
27.9.2019).
Für einen Überblick zur Formtheorie vgl. Erdbeer, Robert Matthias/Kläger, Florian/Stierstorfer, Klaus (Hg.): Literarische Form: Theorien – Dynamiken – Kulturen. Beiträge zur literarischen Modellforschung, Heidelberg 2018.
141
�142
Matthias Bickenbach
des Kodex eine besondere »Affordanz« vermutet,9 die einerseits Implikationen für seinen Gebrauch nahelegt, diesen Gebrauch jedoch strikt an seine
Form koppelt. Man sieht dann deutlicher, dass etwa das Blättern in Büchern
eine bestimmte Kulturtechnik ist, die andere Voraussetzungen und Effekte
hat als scrollen, wischen oder zoomen von digitalen Texten.10 Was jedoch als
Form des Buches zu bezeichnen ist, bleibt genauer zu bestimmen. Es ist jedenfalls nicht sein Format (Folio oder Duodez, »Wälzer« oder Taschenbuch),
sondern das ihnen jenseits der je unterschiedlichen Anmutungen Gemeinsame. Es geht auch nicht nur um den Buchblock oder die Peritexte von Büchern
als typographisch gestalteten Objekten,11 sondern um die Form, die genau
diese Komplexität von Materialität, Format und Heterogenität als Einheit einer Vielfalt von Text und Design, Typographie, Haupt- und Peritext, erlaubt.
»Diese Formendifferenz ist nicht durch Formenwahl bedingt (dann könnte sie
vermieden werden), sondern durch das jeweils zugrundeliegende Medium,
dessen lose Kopplung strikte Kopplung ermöglicht.«12 Dass eine formtheoretische Reflexion des Buches dann möglicherweise auch die Formtheorie selbst
betrifft, indem sie über die üblichen binären Schemata von Form/Inhalt oder
Form/Gehalt hinausgeht, verschiebt die Annahme, bereits zu wissen, was Bücher sind und wodurch sie sich von digitalen Texten unterscheiden.
9
10
11
12
Der Begriff Affordanz wurde durch James Gibson 1977 als weder objektiver noch rein
subjektiver Aufforderungscharakter von Dingen in der Umwelt von Lebewesen eingeführt. Gibson, James J.: »The Theory of Affordances«, in: Robert Shaw/John Bansford (Hg.): Perceiving, Acting, and Knowing. Toward an Ecological Psychology, Hilldale 1977,
S. 67-82. Zum Ansatz und zur Anwendung auf Bücher vgl. Benne, Christian: Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit, Frankfurt
a.M. 2015, S. 108-152.
Vgl. Piper, Andrew: Book was there. Reading in electronic times, Chicago/London 2012;
Bickenbach, Matthias: »Opening, Turning, Closing: The Cultural Technology of Browsing and the Differences between the Book as an Object and Digital Texts«, in: Nicolas
Pethes/Pál Kelemen (Hg.): Philology in the Making. Analog/Digital Cultures of Reading and
Writing, Bielefeld 2019, S. 163-176.
Stanitzek, Georg: »Buch: Medium und Form – in paratexttheoretischer Perspektive«, in:
Ursula Rautenberg (Hg.): Buchwissenschaft in Deutschland, Berlin/New York 2010, S. 157201.
Zum Ansatz Luhmann: »Medium und Form« (Anm. 2), S. 186.
�Die Form des Buches
I. Druckbücher im digitalen Kontext
Auf amazon.de erhält man beim Klick auf den Button »Blick ins Buch« zunehmend gerade nicht einen Blick in das Buch, sondern auf sein digitales Double. Auf einem Reiter oben in dem Fenster, das sich geöffnet hat, wird die
Unterscheidung zwischen »E-Book« und »Druckbuch« angeboten. Die Logik
dieser Unterscheidung scheint klar und ist doch zu hinterfragen. Der Begriff
des »Druckbuches« ist jedenfalls nicht länger eine Tautologie. Der Terminus
printed books erinnert immerhin daran, dass Bücher historisch nie nur auf
gedruckte Bücher einzuschränken waren, aber auch daran, dass die Gleichsetzung von Druck und Buch die printing culture zu stark verkürzt.13 Die Form
des Buches ist damit nicht allein durch die Herstellung im Druck zu bestimmen. Die Standarddefinition des Buches ist allerdings nach wie vor, wie Ursula Rautenberg notiert, ein »gebundenes Druckwerk«,14 oder laut UNESCO
Definition eine Publikation von mindestens 49 Seiten. Im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm aber steht es historischer und genauer.
Der Buchstabe B wird von Jacob Grimm 1860 noch selbst bearbeitet. Dort
heißt es schlicht: »mehrere blätter machen ein buch«.15
Über die Form des Buches ist damit bereits viel gesagt. Medium der Kopplung sind Seiten oder Blätter. Genau das macht buchhistorisch die Form des
Kodex aus. Das aber heißt schlicht, dass digitale Texte und E-Books keine Bücher sind und sein können, sondern nur so heißen. Man mag zwar darüber
streiten, ob digitale Texte noch Seiten haben oder ob die Rede etwa von webpages nur metaphorisch, aber nicht technisch zutrifft. Selbst das PDF-Format,
das als einziges digitales Format die Form der Seite eines Dokuments grundsätzlich bewahrt, kann als paradoxe digitale Simulation einer Seite angesehen
werden.16 HTML-Texte und E-Books dagegen beruhen auf einer Textkodierung, die heute den Namen reflowable text trägt. Die Form der digitalen Seite
passt sich an das jeweilige Ausgabegerät an. Deshalb kennen E-Books keine
Seitenzahlen mehr, sondern so genannte Positionsnummern. Doch was bei
13
14
15
16
Vgl. Gitelman, Lisa: Paper Knowledge. Toward a Media Theory of Documents, Durham/London 2014.
Rautenberg, Ursula: »Buchmedien«, in: Natialie Binczek/Till Dembeck/Jörg Schäfer
(Hg.): Handbuch Medien der Literatur, Berlin 2013, S. 235-246, hier S. 235.
Art. »Buch«, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. 2, Reprint München 1984, Sp. 467.
Gitelman: »Near Print and Beyond Paper: Knowing by *.pdf«, in: dies.: Paper Knowledge
(Anm. 13), S. 111ff.
143
�144
Matthias Bickenbach
Seiten immerhin noch streitbar scheint und in der Textpräsentation der Digitalisate in Online-Repositorien durch Faksimile-Bilder der gescannten Buchseiten zumindest als visuelle Form bewahrt bleibt, wird durch die Grimmsche
Definition – »mehrere blätter machen ein buch« – die Differenz festgeschrieben. Es gibt keine Blätter im digitalen Universum, allenfalls ein einziges universales ›Blatt‹ ohne Rückseite, nämlich die Oberfläche des Bildschirms.
All das mag man noch für banal halten, auch wenn es bereits auf die Differenzqualität des Buches verweist. Gedruckte oder digitale Seite – der Unterschied erscheint nicht groß. Doch es geht hierbei nicht einfach um die
Form des Textes, seine transponierbare visuelle Form oder Gestalt, sondern
um die Affordanz der Form als Medium strikter Kopplung, in der die Materialität einen Unterschied macht. Natürlich stellen sich auch in der rein
visuellen Form der Textpräsentation am Bildschirm schon Unterschiede ein.
Digitale Texte brauchen andere Typografien – ohne Serifen, das ist besser
lesbar am Bildschirm, während auf Papier Schriften mit Serifen (als Unterlägen) besser lesbar sind – so Christoph Bläsi zur »buchnahen Textgestaltung
am Bildschirm«.17 Auch das Seitenlayout verändert sich. Während die Zeilenlänge in Büchern auf eine für das lesende Auge günstige Zeichenverteilung
eingerichtet werden, vergessen elektronische Texte dies mitunter oder präsentieren gleich nur sehr kurze Texte mit kurzen Zeilenlängen, so dass das
Lesen längerer Texte geradezu verlernt werden kann, weil längere Zeilen nun
als anstrengend empfunden werden, durch die Gewöhnung an wenige Sakkaden, die Sprünge, die das Auge beim Lesen durch den engen Schärfebereich
der Fovea tun muss. Kulturkritiker wie Nicolas Carr oder Manfred Spitzer
setzen genau hier mit ihren Warnungen vor dem Bildschirm an: Durch Gewöhnung an »Häppchenlesen« verlerne man die Konzentration und Aufmerksamkeit für längere Texte und damit – so etwa auch Roland Reuß – Reflexion
und Urteilskraft.18 Auch wenn diese Kritiker die positiven Möglichkeiten beschleunigten Textumgangs zu ignorieren pflegen und implizit ein vermeint17
18
Bläsi, Christoph: »Gleiche Ziele, andere Lösungen: Buchnahe Gestaltung am Bildschirm«, in: Cornel Dora (Hg.): Buchgestaltung: Ein interdisziplinäres Forum, Tagung der
Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, St. Gallen, Wiesbaden 2008,
S. 129-142.
Vgl. Carr, Nicholas G.: Wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn solange?
Wie das Internet unser Denken verändert, München 2010; Spitzer, Manfred: Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Stuttgart 2012. Vgl. auch
Reuß, Roland: Ende der Hypnose. Vom Netz zum Buch, 4. Auflage, Frankfurt a.M./Basel
2012.
�Die Form des Buches
lich ideales Lesen im Sinne des sukzessiven Durchlesen naiv voraussetzen,
das historisch wie aktuell nie ohne Alternativen war, markiert diese Debatte,
dass Veränderungen in der Form des Textes hohe Relevanz für die Rezeption haben. Damit macht die Digitalisierung von Texten etwas deutlich, dass
in der Texttheorie bislang so kaum thematisiert worden ist: Der Inhalt von
Texten kann nicht unabhängig von ihrer visuellen und materiellen Form als
beliebig und ohne Veränderung transponierbar behandelt werden. Die Abstraktion des Inhalts von seiner Form, gleich welcher typographischen, drucktechnischen oder digitalen Umsetzung, als ›Dasselbe‹ nur in anderer Form,
geht von einem »dingontologischen« metaphysischen Standpunkt aus, der die
Bedeutung der Zeichen ins Jenseits ihrer Formen verlegt, ohne die Rekursivität von Wahrnehmung und Inhalten zu reflektieren.19 Wenn aber die Ansätze einer Theorie der »embodied cognition«, in der die Körpermatrix für
Wahrnehmung und Orientierung sowie in Folge für die Erinnerung an Inhalte eine größere Rolle als bislang angenommen einnimmt, wenn Räumlichkeit
von Textgestaltung, zwei- wie dreidimensional, einen größeren Einfluss auf
die Rezeption haben, weil der Ort des lesenden Auges und die Taktilität des
Textes orientierte Faktoren auch für den Inhalt des Gelesenen bilden, dann arbeitet die Form des Textes mit an unseren Gedanken, wie man Nietzsches bekannt gewordenen Satz über Schreibmedien replizierend, formulieren kann.
Die scheinbar einfache Frage nach der Form erhält dadurch neue Relevanz.
Doch welche Form formt das Buch? Wohl kaum nur sein Format. Vielmehr ist
zu fragen, was ist ein Blatt – verstanden als Form?
II. Die Zwei-Seiten-Form
Von der visuellen Form eines Textes, seiner Wahrnehmung als typographische
Gestalt, muss eine andere Form der Form unterschieden werden. Allerdings
impliziert das Zauberwörtchen »Form« bereits stets seine Gegenbegriffe –
wie Gehalt, Inhalt oder Medium –, und ist, so Luhmann, als Unterscheidung
19
Vgl. Luhmann: »Medium und Form« (Anm. 2), S. 166. »Mit der Unterscheidung Medium/Form wird eine andere Ausgangsdifferenz vorgeschlagen [als Ding/Eigenschaft,
Substanz/Akzidenz u.a.], die das dingontologische Konzept ersetzen, das heißt: überflüssig machen soll.« Dazu ist nicht die Differenz Medium/Form ausschlaggebend,
sondern die Reflexion, dass diese Beobachtungen eines Beobachters bzw. eines Systems sind und »Information ein rein systeminternes Produkt« (ebd.).
145
�146
Matthias Bickenbach
selbst »eine Form mit zwei Seiten«,20 die je nach Beobachtung und Bezeichnung jeweils unterschiedlich adressiert werden kann: Die Form als strikte
Kopplung kann unter anderen Gesichtspunkten als Medium loser Kopplung
gelten und umgekehrt, so dass
die Unterscheidung in sich selbst wiedereintritt, in sich selbst auf einer ihrer Seiten wiedervorkommt. Formen werden in einem Medium durch feste
Kopplung seiner Elemente gewonnen. Auch dabei sind zwei Seiten der Form
vorausgesetzt. Unser Begriff der Zwei-Seiten-Form bleibt also auch in diesem Kontext erhalten. Formen, die durch feste Kopplung der Möglichkeiten
eines Mediums gebildet werden, unterscheiden sich selbst (Innenseite) von
den anderen Möglichkeiten, die das Medium bietet (Außenseite).21
Die Form des Buches als Medium aus geschichteten Blättern resultiert aus
der Form des Blattes, der Seite, die ihrerseits eine bestimmte Form (ein Format) hat und wiederum Medium für typographische Formen ist. Damit aber
scheint der Begriff der Zwei-Seiten-Form noch nicht erschöpft. Denn die Rede von den zwei Seiten der Form nimmt, wie auch immer metaphorisch, die
Form der Seite als eine Zwei-Seiten-Form in sich auf. Die (Buch-)Seite als Modell der Form verweist damit auf etwas grundlegend Anderes als auf die nur
visuelle Gestalt etwa eines Ornaments oder einer Figur, einen Umriss, einer
Gestalt. Als Zwei-Seiten-Form der Seite ist nicht nur ihre Ausdehnung und relative Dicke, sondern ihre Dreidimensionalität in der Differenz von Vor- und
Rückseite maßgebend. Genau das macht ja die Buchseite als Blatt aus: recto
und verso, Vor- und Rückseite.
Formtheorie muss mithin, wenn sie die abstrakte Allgemeinheit von Luhmanns Reflexionsansatz verlassen will, zwischen zwei verschiedenen Formen
von Form unterscheiden können: zwischen visueller und plastischer Gestalt,
zwischen einem Bild als Form und der Form des Bildes als Objekt – und das
heißt auch: zwischen dem Text und seiner Materialität.
Auch die Etymologie von forma gibt einen Hinweis auf diese feine Unterscheidung innerhalb des Begriffs. Es gibt eine Differenz zwischen »form,
gestalt [und] figur«, weil nur letzteres »die ganze gestalt« meine, während
die Form »nur den umrisz« bezeichne.22 Damit scheint Form zunächst nur
20
21
22
Luhmann: »Medium und Form« (Anm. 2), S. 169.
Ebd.
Art. »Form«, in: Deutsches Wörterbuch (Anm. 15), Bd. 3, Sp. 1898.
�Die Form des Buches
als eine Reduktion der ganzen (dreidimensionalen) Gestalt oder Figur aufgefasst zu sein, als die visuelle Form als Umriss, die jene andere Form in der
Unterscheidung von Umriss und Gestalt ausschließt. Doch so einfach ist es
nicht. Die visuelle Form als Umriss ist nur eine etymologische Seite, deren andere in der Geschichte der Wortbedeutung in den Hintergrund getreten ist.
Sie ist in der älteren Wortform in der Bedeutung »barm« als »dem tragenden
Schoß« zu finden.23 Der tragende Schoß mag ein sehr aufgeladenes Bild sein,
das vieles impliziert (u.a. Weiblichkeit, Fruchtbarkeit, Geborgenheit), doch es
markiert jedenfalls nicht einfach nur einen Umriss. Die Wortbildung »Form«
stammt denn auch etymologisch vom lateinischen ferre (bringen, tragen, etragen) ab, »weil die gestalt das mit sich, an sich getragene ist.«24 Man möchte an
diesem Dickicht der Sprache verzweifeln, die zwischen Redundanz und Differenz kaum zu unterscheiden vermag. Doch deutlich wird, dass die Unterscheidung zwischen Umriss und Gestalt hier nicht die Form nur auf die Seite
des Umrisses platziert, sondern die Form der Gestalt als ›tragender Schoß‹
erstens als eine selbstreferentielle Schließung definiert, als erkennbare Abgrenzung »mit sich« von anderen, und zweitens eine plastische Dimension
»an sich« impliziert, die die Form trägt bzw. sie selbst ist. Die Form der Form
ist Träger und Getragenes und folglich gleichsam Gefäß oder Behälter, also eine dreidimensionale Form, die Formen ermöglicht – so wie die Rahmen der
Buchdrucker zum Schöpfen von Papier und zur Einrichtung der Lettern im
Fachjargon »Form« heißen. Diese Rahmen sind, real wie metaphorisch, materielle Formen, die der visuellen Form vorausgehen und sie gleichsam tragen
oder konstituieren.
Wozu dieser sprachliche Aufwand, nur um visuelle und plastische Formen
zu unterscheiden? Weil dies, im Fall der Form des Buches, so offenkundig Bücher dreidimensionale Objekte aus Papier sind, zumindest in der Literaturtheorie und der Reflexion von Texten bislang weitgehend vergessen scheint.
Erst jetzt kann formtheoretisch begründet werden, warum die Form des Buches nicht nur als visuelles, typographisches Objekt, sondern als »das Beywesentliche« der materiellen Gestalt gefasst werden muss.25 Der Buchblock,
der Einband, die Blätter und die Form der Seite, sind als spezifische Form zu
23
24
25
Ebd.
Ebd.
Das gilt auch für das Blatt jenseits der Buchseite. »Das Medium Blatt ist das mit Abstand am meisten vernachlässigte Kommunikationsmedium unserer Zeit«. Faulstich,
Werner (Hg.): Das Alltagsmedium Blatt, Paderborn 2008, S. 7.
147
�148
Matthias Bickenbach
reflektieren, die die visuelle Erscheinung des Textes organisiert. So einfach
dieses Argument scheint, es hat weitreichende kulturtechnische Konsequenzen für den Mediengebrauch, der im Fall von digitalen Texten ganz andere
textual minds und Kulturtechniken des Umgangs mit Information fordert.26
Die Digitalisierung rückt damit nicht nur ihre eigenen Formen von Text (und
Fragen der Vergleichbarkeit, Nachhaltigkeit und Verwendung) in den Blick,
sondern auch das Buch als nicht mehr selbstverständliche Form.
Wenn »mehrere blätter« ein Buch »machen«, dann impliziert diese Materialität notwendig die Dreidimensionalität dieser Form. Die geschichteten
Blätter bilden Haufen relativer Dicke und diese für Leser (aber nicht für Bücherwürmer27 ) scheinbar banale Tatsache, scheint die Buchkultur zu wenig
zu reflektieren – sonst könnte Carlos Spoerhase nicht eigens daran erinnern.
Gegenüber Paul Valérys Beobachtung, dass die beiden Dinge, die ein gutes
Buch ausmachen, in der typographischen Gestaltung der Buchseite als linearsukzessive Lesbarkeit einerseits, aber auch in der Gestalt der Seite als visuelles Ganzes andererseits bestehen, verweist Spoerhase darauf, dass damit die
Dreidimensionalität des Buches vergessen werde, auch wenn Valéry die den
typographischen Satz mit Architektur vergleicht.28 Valéry bezieht sich nur auf
die visuelle Form der Gestaltung des Textes.29 Leider führt Spoerhase diesen
Gedanken mit Blick auf besonders dicke Romane als »Wale« jedoch nur wenig
aus. Diese Wälzer aber erinnern, über ihr Gewicht und den Anspruch an Leser hinaus, besonders deutlich an die Arbeit des Blätterns, die jeder Lektüre
notwendig vorangehen muss. Das Wal und Wälzer in der Etymologie einen
gemeinsamen Ursprung haben (Wal kommt vom »wallen«, rollen, wälzen),
26
27
28
29
Vgl. van der Weel, Adrian: Changing our textual minds. Toward a digital order of knowledge,
Manchester 2011.
Was auch immer Bücherwürmer sind (Holzwürmer, Käfer, Silberfischchen, es gibt rund
160 Arten von Buchschädlingen): Die vom Buchdrucker William Blade 1879 erstmals
versuchte Zucht einer Holzkäferlarve scheiterte mehrfach, weil diese nur unter dem
Anpressdruck der Buchseiten im geschlossenen Buch fressen können. Daher ist der
Rat Johann Hermanns, dessen Aufsatz über Bücherwürmer 1774 preisgekrönt wurde,
die Bücher fleißig zu blättern und am besten selbst zu einem Bücherwurm zu werden. Bibliotheken müssten dann aber »eine Menge Diener« für das Umblättern einstellen. Hermann greift auf die erst von Lessing (im Frühwerk Der junge Gelehrte) 1754
eingeführte Metapher des Lesers als Bücherwurm zurück. Vgl. Harskötter, Hektor: Der
Bücherwurm, Darmstadt 2010, hier S. 24, S. 44 und S. 62f.
Spoerhase: Linie, Fläche, Raum (Anm. 3), S. 13.
Valéry, Paul: »Die zwei Dinge, die den Wert eines Buches ausmachen«, in: ders.: Über
Kunst, übersetzt von Carlo Schmid, Frankfurt a.M. 1959, S. 15-22.
�Die Form des Buches
ist hier natürlich ein Witz der Sprache, für den Herman Melvilles Moby-Dick,
dem Ursprung aller dicken Bücher als Wal, nachhaltig als Pate steht.30
Für die Affordanz der Form des Buches ist damit der entscheidende operative Hinweis auf das gegeben, was diese Form ausmacht. Die Schichtung
der Seiten ist nicht nur die optimierte Form eines Speichers für Text, der
in der Geschichte des Buches für die Ablösung der antiken Buchrolle durch
den Kodex steht, sondern zugleich eine spezifische Form der Nutzung. Der
Kodex erfindet die Kulturtechnik des Blätterns. Erst die Schichtung von Seiten erfordert die blätternde Hand. »Wer Bücher liest, der blättert«, schreibt
Christoph Benjamin Schulz in seiner Dissertation Poetiken des Blätterns.31 Aus
dieser Perspektive kann dann deutlich werden, dass Bücher »zu einer Partitur für das Blättern« werden können. Mit Blick auf Romane von Jean Paul und
Laurence Sterne schreibt Schulz: »Indem das Blättern von literarischer Seite
her kalkuliert und vom Text als Option signalisiert wird, ist es zu einem literarischen Ereignis […] erhoben«.32 Das »Beywesentliche« des Buches, seine
äußere Form wird hier zur inneren Form der Narration. Die umfangreiche
Dissertation zeigt unter anderem wie das Blättern im 17. und 18. Jahrhundert
zwischen Willkür und Kunst thematisiert wurde, führt es jedoch als Kulturtechnik konsequent auf die Form des Kodex zurück: Aus dieser Struktur des
Buches ergibt sich eine bemerkenswerte und folgenreiche Konsequenz: Der
Kodex sequentialisiert das Gewebe des Texts unabhängig von möglichen textimmanenten Gliederungen wie Absätzen und Kapiteln. Er verräumlicht den
Text, macht aus ihm einen aus einzelnen Lagen geschichteten greifbaren Gegenstand, der geblättert werden muss. Wenn das Buch ein Leitmedium unserer Kultur ist, dann ist sie nicht nur die Geschichte des Kodex, dann zeigt
sich auch unsere Kulturgeschichte als eine Kultur und eine Geschichte des
Blätterns.33
Das ist vollmundig formuliert, öffnet aber eine neue Perspektive. So vergessen das Blättern in Büchern als Kulturtechnik erscheint – üblicherweise
30
31
32
33
Vgl. Melville, Herman: Moby-Dick oder Der Wal, übersetzt von Matthias Jendis, München 2001, S. 13 zur »Wortkunde«. Bekanntlich teilt Melville in Kapitel 32 Wale nach
Buchformaten ein, S. 231ff. In den Briefen an Nathanael Hawthorne spricht Melville
mehrfach von »meinem Wal« und fragt, ob er ihm »eine Flosse« schicken solle. Melville, Herman: Ein Leben. Briefe und Tagebücher, übersetzt von Werner Schmitz und Daniel
Göske, München 2004, S. 256f. und S. 262.
Schulz, Christoph Benjamin: Poetiken des Blätterns, Hildesheim/Zürich/New York 2015.
Ebd., S. 26.
Ebd.
149
�150
Matthias Bickenbach
wird es allenfalls dem ordentlichen Lesen gegenübergestellt, nicht aber als
Praxis der Textaneignung reflektiert34 –, so deutlich kann man es in der ersten Thematisierung der Form des Buches namens Kodex in der Literatur überhaupt als Argument für seine Form lesen. Der römische Dichter Martial lässt
in seinen Epigrammen gleich das zweite zu einem Werbetext in eigener Sache
werden und betont dabei die Differenzqualität des damals noch neuartigen
Kodex gegenüber den üblichen volumina, den Buchrollen.35 Martial schreibt:
»Du, der du meine Bücher überall bei dir/und als Begleiter wünscht auf weiten
Wegen:/kauf jene, die das Pergament auf schmale Seiten drängt./Die großen
steck in ihre Hüllen. Mich faßt eine Hand.«36
Der Kodex führt die zweiseitig beschriebene Seite ein. Das macht ihn zu
einem effizienteren Textspeicher als die Buchrolle und mehrfach führt Martial
im 14. Buch bewundert gleichsam Werkausgaben von Homer und Vergil in
einem Band aus Pergament an: »Welch kleines Pergament nicht Maro [Vergil]
auf, den riesigen«.37 Die schmalen Seiten und das kleine Format lassen das
Buch handlich werden und damit zu treuen Begleiter, etwa auf Spaziergängen
oder Reisen. Martial stiftet damit den Topos des Vademecums.
Das ist aber nicht alles. Sein Verweis auf die Unhandlichkeit der Buchrollen in ihren Hüllen bezieht sich auf deren aufwändige Gebrauchsweise des
Auf- und Abrollens. Dieses erforderte Übung und vor allem beide Hände,
meist las man laut im Stehen. Der Kodex bietet demgegenüber einen ebenso
einfachen wie flexiblen Gebrauch von Texten: Aufschlagen und Umblättern.
So unscheinbar es ist: Durch diese Form werden weitere neue Kulturtechniken möglich, die letztlich die gesamte Schriftkultur des Abendlandes nachhaltig prägen werden. Allen voran die Lektüre mit dem Stift in der Hand.
Weil der Kodex nur mit einer Hand gehalten werden braucht, ermöglicht er
das Herausschreiben, Anstreichen und Notieren während der Lektüre. Die
34
35
36
37
»[L]ies ordentlich, das blättern hilft nichts«, heißt es im Deutschen Wörterbuch von Jacob
und Wilhelm Grimm (Anm. 13), Bd. 2, Sp. 78. Vgl. Maye, Harun: »Blättern«, in: Heiko
Christians/Matthias Bickenbach/Nikolaus Wegmann (Hg.): Historisches Wörterbuch des
Mediengebrauchs, Köln/Weimar/Wien 2015, S. 135-148.
Vgl.Cavallo, Guglielmo: »Vom Volumen zum Kodex: Lesen in der römischen Welt«, in:
ders./Roger Chartier (Hg.): Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm, Frankfurt a.M. 1999, S. 97-133.
Martial: Epigramme [I,2], übersetzt und herausgegeben von Walter Hofmann, Leipzig
1997, S. 27. Martials Buch war in unterschiedlichen Formaten erhältlich.
Ebd., S. 602.
�Die Form des Buches
Folgen sind nahezu gleichzusetzen mit unserer Schriftkultur selbst. Sie heißen: Kommentar, Exzerpt, Studium und Exegese. Mit dem Kodex entsteht
der Typus des Schriftgelehrten, der untrennbar mit dem Buch verbunden ist.
Evangelisten und Heilige wie Augustinus und Hieronymus werden zu exemplarischen Buchlesern, die in der Malerei des Abendlandes tradiert werden
und bei der Lektüre oft einen Stift in der Hand halten.
Dass gerade die Bibel sich in der Form des Kodex etabliert, stabilisierte
die damals neue Form des Buches nachhaltig bis zum 4. Jahrhundert. Orignes
kommentiert erstmals in Gänze die Bibel und die Exegese braucht Techniken
der Querverweisung, um ihr System des mehrfachen Schriftsinns zu errichten. Dass der Kirchenvater Augustinus zudem seine Bekehrung zu Gott in der
berühmten Leseszene des »tolle lege«, »nimm und lies«, in seinen Bekenntnissen durch das zufällige Aufschlagen einer Bibelseite inszeniert, dürfte diese
Form des Buches nachhaltig empfohlen haben.38 Solche Orakeltechniken sind
mit Schriftrollen ja schlechterdings nicht möglich.
Die Frage nach der Form des Buches ist also nicht mit der nach dem Format zu verwechseln. Zwar geht, wie Michael Niehaus gezeigt hat, alle moderne und nachgerade digitale Formatierung auf den Begriff zurück, den das
Buch geprägt hat, doch das Format ist nur die eine Seite der Form, die von
seiner anderen, der dreidimensionalen Form geschichteter Blätter, zu unterscheiden ist.39 Mag ersteres digital transformiert und kodiert werden, so stellt
letzteres eine Differenzqualität dar, die nicht ohne Verluste und Veränderungen im Mediengebrauch transponiert werden kann. Noch für die Buchseite
selbst ist dies, wie schon angemerkt, fraglich.
III. Rinde, Buch und Seite als Ding und Zeichen
Die Buchseite ist in sich selbst erstens eine künstliche Einheit der Textorganisation. Ihre Gestaltung als Verteilung der Zeichen auf ihrer Fläche hat eine
eigene Geschichte seit der visuellen Gliederung der antiken scriptio continua
durch Spatien und später durch Punkte und Kommata während des Mittelal-
38
39
Aurelius Augustinus: Bekenntnisse, übersetzt von Joseph Bernhart, Frankfurt a.M. 1987,
S. 417.
Niehaus, Michael: Was ist ein Format?, Bielefeld 2018.
151
�152
Matthias Bickenbach
ters.40 Die Buchseite als Einheit der lesbaren Form wird nach Ivan Illich erst
um 1130 entwickelt.41
Dies aber ist nur ihre visuelle Form zu Lesbarkeit. Die Buchseite ist zweitens ein zweiseitiges Ding. Auch diese Form erfindet der Kodex von Beginn an.
Es ist eine komplexe Form, die mehrere Unterscheidungen ermöglicht – eine
doppelte Form der Dopplung: Zum einen die Unterscheidung von recto und
verso, also Vor- und Rückseite des Blattes, wie die alte Bezeichnung bis lange nach dem Buchdruck lautete, bevor die Paginierung dies ersetzt hat. Die
zwei Seiten der Seite motiviert und erzwingt das Umblättern, aus dem kontinuierlichen, ›panomaratischen‹ Leserblick der Buchrolle wird ein fragmentierte, selektiver Blick, der ein ›Fort/Da‹-Spiel spielt.42 Zum anderen ergibt
sich die die Doppelseite im aufgeschlagenen Buch, in der sich recto und verso
gegenüberstehen. Beide Formen der Seite erlauben Orientierungsmerkmale
(links/rechts, oben/unten, vorne/hinten), die wiederum die Orientierung im
Text und die Erinnerung an bestimmte Stellen fördern sowie die Navigation
im Text durch Seitenangaben, Inhaltsverzeichnisse und Register erlauben.43
Die Form des Buches ist damit auch eine mnemotechnische Optimierung.
Mehrere Studien haben inzwischen nachgewiesen, dass die Erinnerung an
Gelesenes in E-Books schwächer ist als die der Lektüre in gedruckten Büchern.
Doch damit nicht genug. Die Erinnerung an das, was im digitalen Text
verschwindet, nämlich dass Bücher Seiten haben, in denen geblättert werden muss, erlaubt es, den Ursprung des Buches als eine komplexe Form noch
genauer in den Blick zu nehmen. Dazu muss man kein Buchwissenschaftler sein. Die genaue Lektüre von historischen Wörterbüchern reicht mitunter
aus. Was besagt die Vor- und Rückseite der Seite als Form? Was ist das Buch
als dreidimensionaler Buchblock?
Nun klingt der Begriff Buch zufällig nach Buche. Etymologisch greift das
Wort also auf jenen Baum zurück, der auch unseren Buchstaben seinen Namen gibt. Die Buche, von dem das Buch seinen Namen nimmt, obwohl viele
frühe Bucheinbände nicht Buchen- sondern eher Eichenholz verwendeten,
verweist nicht auf den Einband, auf Holz oder gar Papier oder ähnliches.
40
41
42
43
Vgl. Parkes, Malcolm B.: Pause and Effect: An Introduction to the History of Punctuation in
the West, Aldershot 1993.
Illich, Ivan: Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne entstand, Frankfurt a.M.
1991.
Vgl. dazu kritisch Cavallo: »Vom Volumen zum Kodex« (Anm. 35), S. 131ff.
Vgl. Mak, Bonnie: How page matters, Toronto 1979.
�Die Form des Buches
Das Spiel der Zeichen Buch/e bringt vielmehr ein komplexes Verhältnis von
Schriftzeichen und Materialität ins Spiel, in der die Form des Buches impliziert ist. Schon lange vor dem Buchdruck Gutenbergs sind Bücher, wie Martial anzeigt, eine Form der Speicherung der Schrift, die nicht nur das materielle Trägermedium meint (Papyrus, Pergament, später Papier) sondern dessen
Einheit als einer Zwei-Seiten-Form. Und diese hat nicht den Baum namens Buche, sondern vielmehr die Rinde des Baumes zum Vorbild. Der Befund ist
erstaunlich. Ob biblios, liber, puoch, book oder livre, die Etymologie von »Buch«
verweist stringent auf die Rinde (lateinisch: liber). Jacob Grimm hält fest:
Dies wort führt unmittelbar in die heidnische zeit. wie den Griechen βύβλος,
βίβλος bast, rinde und dann, weil sie bemahlt, beschrieben wurde, schrift,
brief und buch, den Römern liber bast und buch bedeutete; so gieng unsern vorfahren, die ihre schrift auf steine und zum gewöhnlichen gebrauch
auf büchene breter ritzten, die vorstellung des eingeritzten über auf buche, den namen des baums, aus dessen holz breter und tafeln am leichtesten geschnitten werden konnten; […]. nicht anders bezeichnete auch codex
und tabula sowol das beschriebene holz als hernach das buch. […] da die
bücher blätter haben, erscheint die verwandtschaft zwischen buch und buche begründet und höchst passend. schon Mathesius erreichte die richtige
deutung, obwol er ohne noth die bretter des einbands statt der buchstaben
selbst ins auge faszt.44
Ob der Analogieschluss überzeugt oder nicht: Der Übergang vom Ritzen auf
Steinen zum weicheren organischen Material entspricht also kulturgeschichtlich dem Wechsel des Schreibens vom exklusiven »zum gewöhnlichen gebrauch«. Bücher sind also profane Alltagsmedien. Ihren Namen aber haben
sie von einem Schreibmedium her, das nicht nur die besondere Eigenschaft
der leichteren Einschreibung bedeutet, sondern die Einheit von Außen- und
Innenseite. Die Rinde des Baumes mit seiner helleren und weicheren Innenseite und einer dunkleren und härteren Außenseite ist das Modell der
Form des Buches. Die Verwechslung des Mathesius, (die »bretter des einbands« zum Kritierium zu nehmen), ist symptomatisch. Das beschriebene
Holz aber, das Grimm zur Herleitung des Namens dient, ist ebenfalls nur die
halbe Wahrheit. Denn wenn das Buch etymologisch auf Rinde verweist, dann
ist die Einheit von Innen und Außen, von Buchdeckel und Seite, von Vorder- und Rückseite als Form bereits immer schon gegeben. Noch das absolute Buch müsste
44
Art. »Buch«, in: Deutsches Wörterbuch (Anm. 15), Sp. 467.
153
�154
Matthias Bickenbach
zwei Buchdeckel und Seiten haben. Ein Buch ist folglich immer schon und
grundsätzlich Einband und Inhalt, materieller Behälter und organsierte Zeichenmenge zugleich, eine Form der Vorder- ohne Rückseite nicht zu haben
ist. Dies gilt natürlich auch dann und erst recht, wenn die Rückseite keine
Zeichen aufweist und leer bleibt.
Die Etymologie zeigt jedoch auch die Ironie des Zeichens selbst auf.
»Buch« und »Buche« sind ja nur konventionelle, arbiträre Bezeichnungen.
Sie haben keine natürliche oder ursprüngliche Beziehung zu dem, was sie
bezeichnen, sondern sind Elemente in einem Sprachsystem, die ihre Bedeutung durch Relation zu anderen Zeichen erhält. Diesen Grundgedanken der
Linguistik und des Strukturalismus fasste Ferdinand de Saussure bekanntlich
in einem anschaulichen Beispiel zusammen, das den Begriff der Arbitrarität
doppelsinnig und ironisch, wenn nicht subversiv, am französischen Wort
für Baum (frz. Arbre) illustriert. Das Wort Baum ist arbiträr und sagt dies
paradoxerweise auch. So schreibt de Saussure den Baum als Denkmodell
des Zeichens ein. Zugleich aber ist ein Zeichen für Saussure immer schon
die untrennbare Einheit seiner zwei Seiten: Signifikant und Signifikat. Die
Einheit der Unterscheidung macht es unmöglich, ein Beispiel für ein Signifikat zu nennen – es wäre immer schon der Signifikant – ebenso wie dieser
nie ›rein‹, ohne Vorstellung dessen, wofür er steht, erscheinen kann. Zur
Veranschaulichung dieser Einheit wählt Saussure ein weiteres Bild: In der
»langue« gehörten Signifikant und Signifikat zusammen wie die Vor- und
Rückseite eines »feuille de papier«.45
Zeichen und Sprache, Buch und Buchseite sind mithin Zwei-SeitenFormen, das heißt Modelle der Einheit einer Relation (Innen/Außen, Form/Inhalt, Bezeichnung/Bedeutung, System/Umwelt). Genau dafür steht die Rinde
des Baumes ein. Auch das Wort Kodex stammt vom lateinischen caudex ab:
Rinde. Für die Form des Buches aber bedeutet das Modell der Zwei-SeitenForm dann auch, dass ein Buch die Einheit seiner Unterscheidung ist. Etwa von
Haupttext und Vorwort oder von Text und Fußnote, aber auch von Text und
Gestaltung und allen ›äußeren‹ Paratexten, die im gedruckten Buch Innen
und Außen untrennbar miteinander verbindet. Paratexte wie Umschlag,
45
»La langue est encore comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto et le son
le verso; on ne peut découper le recto sans verso.« de Saussure, Ferdinand : Cours de
linguistique générale, Paris 1971, S. 157.
�Die Form des Buches
Schmutztitel oder Klappentexte, Impressum oder Vorwort sind daher keine
Nebensächlichkeiten, die vom eigentlichen Text trennbar wären.46
Erst die generalisierende Rede vom Text lässt die Entkopplung von Gestaltung und Bedeutung zu und der digitale Text verzichtet dann auch gerne
auf Paratexte. Er gestaltet freilich auch neue, schneidet jedoch von digitalisierten Büchern allzu oft die vermeintlich äußere Information ab. E-Books
springen sofort auf die erste Seite des Haupttextes. Sie simulieren damit das
Aufschlagen und den sofortigen Beginn der Lektüre, aber sie überspringen
den orientierenden Zugang, bei dem Umschlag, Schmutztitel und Verlagsangaben oder Inhaltsverzeichnis erst überblättert werden müssen, aber eben
als orientierende Paratexte präsent sind. Covergestaltung und Einband oder
Typographie verraten immer auch etwas über das Genre und die Zeit, in der
das Buch publiziert wurde. Die Form des Buches ist daher ein Orientierungsrahmen der Lektüre, der im digitalen Text verschwindet. Wie wirkungsvoll
aber diese Form ist, wird einmal mehr, scheinbar ganz banal, beim Lesen von
Büchern deutlich: »Beim Lesen wird der vordere Teil dicker, während der hintere abnimmt«, so der Produktdesigner Mark Rolston zum Manko des Kindle,
denn genau das vermittele »ein starkes Gefühl von Fortschritt« und stärkt so
die Lesemotivation.47 Digitale Texte müssen sich anstrengen, um solche Effekte der Motivation erst zu erzeugen. E-Books zeigen dann Fortschrittsbalken oder kalkulierte Rest-Lesezeit an, aber dies erreicht Leser nur auf einer
abstrakt-visuellen Ebene, während die Seiten eines Buches plastisch einen
Unterschied machen.
IV. Novalis’ Leseszene und das absolute Buch
Die neue Perspektive auf das Buch als Form lässt nun in der Literatur das, was
man als Leseszene bezeichnen kann, anders beobachten. Stand im Fokus dieser Forschung bislang die Figur von Lesers und Leserin in der Literatur und
wurden ihre Lektüreweisen zum Teil der deutschen Literatur insbesondere
des 18. Jahrhunderts, wurden das Was und das Wie der Lektüre zum Fokus.
46
47
Vgl. Stanitzek: »Buch: Medium und Form« (Anm. 11).
Rohwetter, Marcus: »Niemand wird das Buch abschaffen. Produktdesigner Mark Rolston über hässliche Lesegeräte, falsche Versprechungen und die Zukunft des gedruckten Wortes« in: Zeit Online (23.10.2008), unter: https://www.zeit.de/2008/43/KindleInterview-Rolston (zuletzt aufgerufen am 23.9.2019).
155
�156
Matthias Bickenbach
Ob Werther oder Anton Reiser, viele Figuren in Romanen und Dramen lesen
bestimmte Stoffe und verstehen sie auf ihre Weise. Man kann in diesen Leseszenen selbstreflexive sowie sozial- und buchgeschichtliche Spezifika entdecken. Zuweilen rückt das kleine Format oder die Lektüre im Freien in den
Blick oder auch die körperliche oder geistige Haltung der Leserin oder des
Lesers dem Text gegenüber.48 Von der formtheoretischen Perspektive auf das
Buch aus, werden nun die Formen dieses Mediengebrauchs namens Lesen im
Buch ebenfalls relevant. Das macht einen Unterschied. Für die berühmte Leseszene in Augstinus Bekenntnissen heißt dies, dass man eben nicht das stille
Lesen für sich einzige als Besonderheit dieser Leseszene hervorhebt, sondern
auch den Gebrauch des Kodex in seinem Zusammenhang zu Orakeltechniken,
die Augustinus damit umdeutet.
Damit aber verschiebt sich auch der Begriff der Leseszene. Analog zu Rüdiger Campes Begriff der »Schreibszene« ist der Begriff des Lesens weiter zu
fassen, als die Rezeption des Textes durch das Auge. Campes Relationen einer
Trias von Kognition, Medium und Körper für das Schreiben ist auf Lesen zu
übertragen.49 Die Wahrnehmung des Textes durch das Auge und seine Sakkaden und dem Spezifika des jeweiligen Textmediums ist der Körper des Lesenden hinzuzufügen, nicht nur die Körperhaltung, sondern auch die blätternde
Hand. In literarischen Leseszenen entdeckt man erst dann Details, die zuvor
wenig Aufmerksamkeit fanden. Wo werden Bücher aufgeblättert, umgeblättert, zu- oder aufgeschlagen, mit welchen Emotionen, in welchem Kontext
und in welcher Funktion für die Handlung oder die narrative Struktur des
Textes? Spiegelt gar der Texte die Struktur des Blätterns, zwingt er Leser zum
Zurück- oder Vorblättern? Lädt er sie zur Navigation in der Geschichte ein?
Mit Laurence Sternes Tristram Shandy tritt ab 1759 ein Buch in Erscheinung,
das schon alle Register einer solchen narrativen Einbindung und Reflexion
zieht. Die berühmten Merkmale des so avantgardistischen Textes, seine Erzählabbrüche und Digressionen, die Anrede von Leserin und Leser, die ominöse schwarze Seite im Text, der äußerst brüchige verschlungene Erzählfaden, all das findet sich auch im Motiv der Lektüre wieder, die hier jedoch
gerade nicht auf das geistige Erfassen, das Verstehen von Text, beschränkt
48
49
Vgl. Marx, Friedhelm: Erlesene Helden.Don Sylvio, Werther, Wilhelm Meister und die Literatur, Heidelberg 1995.
Campe, Rüdiger: »Die Schreibszene. Schreiben«, in: Hans Ulrich Gumbrecht/Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.): Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche, Frankfurt a.M. 1991, S. 759772.
�Die Form des Buches
ist, wie Schulz herausgearbeitet hat. Bei Sterne sieht Buchlektüre etwa so
aus: »Die ersten dreißig Seiten, sagte mein Vater, indem er die Blätter umschlug, – sind ein wenig dröge; und alldieweil sie mit dem Thema nicht eng
verknüpft sind, ––– wollen wir sie einstweilen überspringen […].«50 Was hier
als Parodie des unsachgemäß überblätternden Lesens erscheinen mag – das
angesprochene Thema ist nichts weniger als die Entstehung der Menschheit
–, macht auf der Erzählebene, was der gesamte Roman zelebriert: Es unterbricht einen Zusammenhang, hält inne, verzögert und verlagert den Diskurs.
Die blätternde Hand wird zur eingreifenden Geste, die Geschichten beginnen
oder enden lassen kann.
Damit schlug mein Vater das Buch zu, – indes nicht so, als sei er resolviert,
nicht weiter draus zu lesen, denn er beließ den Zeigefinger im Kapitel: –––
auch nicht verdrießlich, – denn er schlug das Buch langsam zu; sein Daumen
lag danach auf dem vorderen Einbanddeckel, währen drei Finger, ohne das
mindeste gewaltsame Pressen, den Hinterdeckel trugen. –––51
Sterne beschreibt die lesende Hand an vielen Stellen so auffällig und detailliert, dass dieser Roman geradezu als Reflexion des Buches als Objekt gelten
kann. Die Leseszenen im Tristram Shandy führen so auf ein umfassendes Spiel
mit dem Leser, der selbst um-, vor- und zurückblättern soll. Dafür steht exemplarisch eine Szene, in der eine Leserin explizit angesprochen wird.
Wie konnten Ihr, Madam, beim Lesen des letzten Kapitels nur so unaufmerksam sein? Ich teilte Euch darin mit, Daß meine Mutter keine Papistin war. –––
Papistin! Nichts dergleichen habt Ihr mir mitgeteilt, Sir. Madam, ich bin so
frei, es noch einmal zu wiederholen, Daß ich es Euch wenigstens so deutlich
gesagt habe, wie es sich Euch mit Worten, aus denen glatte Schlußfolgerungen gezogen werden können, nur sagen läßt. –– Dann, Sir muß mir eine Seite
entgangen sein. – – Nein, Madam, – nicht ein Wort ist Euch entgangen […]
zur Strafe bestehe ich darauf, daß Ihr unverzüglich zurückblättert, das heißt,
sobald Ihr beim nächsten Punkt angekommen seid, das ganze Kapitel noch
einmal durchlest.52
50
51
52
Sterne, Laurence: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman, übersetzt von Michael Walter, Bd. 5, Zürich 1988, S. 116f.
Ebd., S. 126f.
Ebd., S. 128.
157
�158
Matthias Bickenbach
Der Punkt, der diesen Satz beschließt, ist ein Hyperlink avant la lettre für eine
erneute Lektüre, bei der man also genauer auf Details im Text achten soll.
Dieser Text ist performativ, er macht etwas mit seinen Lesern und versucht
das Leseverhalten zu beeinflussen, indem das Zurückblättern zum Teil der
Geschichte wird.
Man mag dies für ein außergewöhnliches Buch und damit für eine Ausnahme halten. Doch sicher ist das nicht. Wer in Romanen blättert, ist bislang
über Schulz’ Dissertation hinaus kaum in den Blick genommen worden. Ein
für die Form des Buches interessantes Beispiel ist die bekannte Leseszene in
Novalis Heinrich von Ofterdingen. Im Inneren des Berges trifft Heinrich auf den
Einsiedler und sieht in einem alten Buch unbekannter Sprache auf Bilder sich
selbst und seine Geschichte. Natürlich steht dies nicht nur im Zusammenhang mit dem Mythos von Barbarrossa, sondern wesentlich auch mit Novalis’ Komposition des Romans, dessen Fortführung auch die historische Zeit
wie die Lebenszeit des Einzelnen als Ewigkeit neu fasst, so dass Erinnerung
und »Ahndung« einer Zukunft zusammenfallen können. Die Zeit wird dann
ja auch im Klingsohr-Märchen am Ende im »Reich der Ewigkeit« suspendiert.
Das geschichtsphilosophische Thema überschneidet sich mit dem der Selbsterkenntnis und dem schaffenden Ich, das letztlich die Welt erschafft. Es ist
für Novalis »das Beywesentliche«, das als Medium alles miteinander verbindet:
Das Wesentliche der Darstellung ist – was das Beywesentliche des Gegenstands ist. […] Wie findet man in Theilen das Ganze und im Gantzen die Theile? Das Beywesentliche muß nur als Medium, als Verknüpfung behandelt
werden – also nur dieses Aufnehmende und Fortleitende Merckmal muß
ausgezeichnet werden.53
Doch Novalis schreibt hier nicht über Bücher oder Poetologie, sondern über
Fichtes Philosophie des sich selbst setzenden Ichs. Dieses denkbar zentrale
Motiv für die Frühromantik, in dem das Ich »als Medium, als Verknüpfung«
und damit als »das Beywesentliche« gedacht wird, verbindet sich hier jedoch
hermeneutisch (Teil und Ganzes) mit dem Verstehen und lenkt damit die Aufmerksamkeit auch auf das Buch als Medium des Geistes. In Novalis Heinrich
von Ofterdingen wird nun beides miteinander verbunden, die Findung des Ichs,
das Motiv der Selbsterkenntnis der Bestimmung Heinrichs zum Dichter, wird
53
Novalis: »Fichte-Studien«, (Anm. 1), S. 194.
�Die Form des Buches
durch ein altes Buch befördert. Doch wie beschreibt Novalis das Buch in dieser Leseszene genau? Er liest ja nicht, sondern sieht sich schöne gemalte Bilder in einem Buch an. Dies jedoch auf eine Art und Wiese, die der Form des
Buches geschuldet ist.
Heinrich sieht zunächst »auf einer steinernen Platte ein großes Buch liegen«,54 später »mehrere Bücher auf der Erde«.55 Es geht also nicht einfach um
das eine Buch. Nach den Ausführungen darüber, wie man Geschichte richtig
lesen solle (es sei mehr Wahrheit in den Märchen), zeigt der Einsiedler seine
Bücher näher.
Der Einsiedler zeigte ihnen seine Bücher. Es waren alte Historien und Gedichte. Heinrich blätterte in den großen schöngemahlten Schriften, die kurzen Zeilen der Verse, die Überschriften, einzelne Stellen, und die sauberen
Bilder, die hier und da, wie verkörperte Worte, zum Vorschein kamen, um
die Einbildungskraft des Lesers zu unterstützen, reizten mächtig seine Neugierde. (311)
Hier ist nicht von Lektüre die Rede, sondern von einer Annäherung an ein
fremdes, nahezu unbekanntes, wertvolles Objekt, das sich durch eine Vielzahl
von Attraktionen auszeichnet: »schöngemahlte[n] Schriften, Überschriften,
kurze Verse, »saubere Bilder«. Markant an diesen Büchern ist mithin ihr Ornament, vom Text oder Inhalt ist hier nicht die Rede. Dieser Blick von außen
auf das Buch – situiert im fiktiven mittelalterlichen Kontext – hebt die Form
des Buches als visuelle Attraktion hervor. Heinrich reizen die »schöngemahlten Schriften« und wenig später bittet er darum, mit ihnen allein zu bleiben.
Doch Heinrich liest nicht, er liest auch nicht irgendwo hinein. Vielmehr heißt
es: »Er blätterte mit unendlicher Lust umher.«56 Erst dieses Umherblättern
und Stöbern ermöglicht es schließlich, dass er dann ein Buch auswählt:
Endlich fiel ihm ein Buch in die Hände, das in einer fremden Sprache geschrieben war, […]. Es hatte keinen Titel, doch fand er noch beim Suchen
einige Bilder. Sie dünkten ihm ganz wunderbar bekannt, und wie er recht
zusah, entdeckte er seine eigene Gestalt ziemlich kenntlich unter den Figuren. Er erschrak und glaubte zu träumen, aber beym wiederholten Ansehen
54
55
56
Novalis: Heinrich von Ofterdingen, in: ders.: Werke, Tagebücher und Briefe, hg. von HansJoachim Mähl und Richard Samuel, Bd. 1, München 1978, S. 302.
Ebd., S. 304.
Ebd., S. 312.
159
�160
Matthias Bickenbach
konnte er nicht mehr an der vollkommenen Ähnlichkeit zweifeln. […] Die
letzten Bilder waren dunkel […]; der Schluß des Buches schien zu fehlen.57
Auch den Dichter Klingsohr wird er in diesem Buch schon gesehen haben,
wie er sich später in Augsburg erinnert. Doch warum hat dieses prophetische Buch keinen Titel? Es ist offensichtlich ein Fragment. Das alte Buch
kennzeichnet nicht nur die fremde, provenzalische, also romantischer Volkssprache, die Heinrich nicht lesen kann, sondern eine Form, die es als Buch
(schöngemalte Schrift, saubere Bilder) auszeichnet und dennoch vom Buch
unterscheidet: »Es hatte keinen Titel […] der Schluß des Buches schien zu
fehlen«.
Die Frage aus formtheoretischer Sicht zu dieser Leseszene bei Novalis in
der geblättert, aber nicht gelesen wird, ist nicht, wie plausibel die Symbolik
der Figur der Kreisform oder Ewigkeit als goldenes Zeitalter ist, sondern vielmehr wie gerade diese Form des Buches als Fragment mit diesem geschichtsphilosophischen Denken zusammenhängt. Die Leseszene verweist, anders
gesagt, auf den Mythos des absoluten Buches. Das Buch, in dem die Geschichte eines jeden Ichs bereits geschrieben steht wäre ja ein denkbar absolutes
Buch oder die Schöpfung selbst. Nicht zufällig notiert Novalis im Kontext der
Romanentstehung: »Aufgabe – in einem Buche das Universum finden.«58 Im
104. Blüthenstaub-Fragment aber heißt es demgegenüber: »Die Kunst Bücher
zu schreiben ist noch nicht erfunden.« Die gegenwärtigen Bücher seien nur
Fragmente, jedoch: »Fragmente dieser Art sind litterarische Sämereyen« von
denen also vielleicht einmal ein Körnchen aufgehen kann.59 Die Metapher des
Samens verweist auf den Namen Novalis selbst zurück, der sich ja eigens für
diese Blüthenstaub-Fragmente im Athenäum diesen Namen zulegte: »Der Neuland rodende«, der auf dem harten Berg dürftige Samen aussäht. Das Motto
der Fragmenten-Sammlung verknüpft Namen, Saat und Fragment denkbar
eng miteinander. Dass die Frühromantiker zudem das Fragment zur Form
der Gedanken der Moderne werden lassen, ist einschlägig bekannt. Wie aber
lassen sich Fragment und absolutes Buch zusammendenken?
In der Forschungsliteratur ist erstaunlich wenig zu diesem Thema zu finden. Das gilt für Mallarmés späte Notizensammlung ebenso wie für Novalis
57
58
59
Ebd.
Novalis: »Fragmente 1799/1800«, in: ders.: Werke, Bd. 2 (Anm. 1), S. 838.
Novalis: »Blüthenstaub-Fragmente«, ebd., S. 274.
�Die Form des Buches
oder Friedrich Schlegel.60 Tatsächlich gelten auch nur vergleichsweise sehr
wenige Bemerkungen der Frühromantiker explizit der Idee eines absoluten
Buches. Die Prominenz dieses Mythos mag vor allem durch die Analogie zur
Tradition eines »Buches der Natur« gestiftet sein, die Hans Blumenberg für
Novalis Enzyklopädie-Projekt aufgezeigt hat.61 Im anschließenden Kapitel
Blumenbergs zum absoluten Buch ist er jedoch gar nicht am Buch interessiert, sondern beschäftigt sich mit dem Vergleich der frühen und späteren
Geschichtsphilosophie Friedrich Schlegels – als ob die Form der Geschichte
die des absoluten Buches sei. Man muss hier jedoch auf andere, konkrete
Bücher schauen, um die Form des absoluten Buches genauer fassen zu können. Die Metapher des absoluten Buches ist nicht nur der frühromantischen
Poetologie im Sinne einer allumfassenden Synthese aller Gattungen und
Wissenschaften, wie sie das Athenäums-Fragment 116 formuliert, geschuldet,
sondern dem Buch der Bücher, der Bibel. Friedrich Schlegel kommt exakt
zu dieser Zeit zu einem ominösen »Bibelproject«. Denn auch als Buch sei
die Bibel ein Paradigma. Novalis bestätigt den Freund. Er schreibt in einem
Brief:
Du schreibst von Deinem Bibelproject und ich bin auf meinem Studium der
Wissenschaft überhaupt – und ihres Körpers, des Buches – ebenfalls auf
die Idee der Bibel geraten – der Bibel – als des Ideals jedweden Buchs. Die
Theorie der Bibel, entwickelt, giebt die Theorie d[er] Schriftstellerey oder
der Wortbildnerey überhaupt – die zugleich die symbolische, indirecte, Construktionslehre des schaffenden Geistes abgibt.62
Die Bibel wäre demnach als Buch eine (symbolische) Konstruktionslehre des
schaffenden Geistes. Was sie auszeichnet ist jedoch weder die Einheit eines
schaffenden Geistes oder Autors, noch ihre religiöse Stellung. Für Schlegel
ist die Bibel als Buch vielmehr ein Buch aus Büchern, eine Heterogenität aus
vielen Büchern, Autoren, Stilen und Zeiten, Legenden und Geschichten. Die
Bibel ist, anders gesagt, ein Fragment aus Fragmenten. Schlegel schreibt: »Als
60
61
62
Vgl. Schreiber, Jens: Das Symptom des Schreibens. Roman und absolutes Buch in der Frühromantik (Novalis/Schlegel), Frankfurt a.M./New York 1983, insbesondere S. 118-140; Kesting, Marianne: »Aspekte des absoluten Buches bei Novalis und Mallarmé«, in: Euphorion 68 (1974), S. 420-436. Übergreifend Jacobs, Angelica: »Metamorphosen des absoluten Buches zwischen 1800 und 1900«, in: Alexander Lasch/Wolf-Andreas Liebert (Hg.):
Handbuch Sprache und Religion, Berlin/Boston 2017, S. 443-482.
Blumenberg, Hans: Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a.M. 1986, S. 267-280.
Novalis: Werke, Bd. 1 (Anm. 54), S. 673.
161
�162
Matthias Bickenbach
Bibel wird das neue ewige Evangelium erscheinen, von dem Lessing geweissagt hat: aber nicht als einzelnes Buch im gewöhnlichen Sinne. Selbst das,
was wir Bibel nennen, ist ja ein System von Büchern.«63 Die Differenz von
»gemeinen« zum »unendlichen Buch« sei in dem Wort »Bibel« bereits gegeben, es gebe kein anderes: »Bibel, Buch schlechthin, absolutes Buch«.64
Damit ist das absolute Buch als Buch aus Büchern definiert. Es ist nicht
universaler Speicher, sondern fragmentarische Heterogenität in symbolischer Form. Dazu zählt auch, was Schlegel dann in den späteren Literarischen
Notizen folgert: »Die Bibel hatte die schöne Anlage zu einem (absolut universellen) Volksroman der immer fortgesetzt werden konnte; Luthers Fehler,
da zu fixieren und die Legenden abzuschneiden.«65 Aus der Heiligen Schrift
wird ein »Volksroman«, der als absolutes Buch keineswegs enzyklopädisch
alles enthält, sondern vielmehr perspektivisch und fragmentarisch ein unsystematisches System hervorbringt, das fortsetzbar, also progressiv ist.
In diesem Sinne ist das Fragment des Buches, in dem Heinrich blättert,
Anstoß und Symbol von Erwartung und Erfüllung, dem seine Bestimmung
zum Dichter folgt. Die Reflexion bei Novalis geht indes noch einen Schritt
weiter. Novalis denkt die Form des Buches nicht einfach als Speicher oder
Behälter von Information. Sondern die Leseszene im Heinrich von Ofterdingen
macht deutlich, dass der Zugang und die Motivation, sich etwas genauer
anzusehen oder anzueignen, im Vorfeld bereits durch die Form des Buches
angeregt wird. Seine Affordanz heißt: blätter mich, schlag mich auf. Die
Form des Buches als Zwei-Seiten-Form des Urmodells der Seite bzw. der
Rinde mit Vorder- und Rückseite motiviert das Umwenden des Blattes. Es ist
so das Blättern in vielen Büchern, das Heinrich erst das eine Buch, das sein
Interesse weckt, überhaupt auswählen lässt und es ist das Blättern in diesem
Buch, das die Bilder finden und zu einer Chronik seines Lebens zusammenstellen lässt. Dass diese stochastische und idonsynkratische Nutzung des
Buches den Text gar nicht lesen kann, spielt hier keine Rolle. Zu deutlich
ist die Verbindung von Buch und Interesse des Ichs, letztlich sich selbst zu
finden, in den Vordergrund gestellt und mit der Frage nach der Bestimmung,
der Bildung des Ichs, zusammengeführt. Novalis’ Heinrich ist ja gezielt als
63
64
65
Friedrich Schlegel: Athenäum (1798), Bd. II, S. 265. Zitiert nach Schreiber: Das Symptom
des Schreibens (Anm. 60), S. 130.
Ebd.
Schlegel, Friedrich: »Literarische Notizen«, Nr. 458. Zitiert nach Schreiber: Symptom des
Schreibens (Anm. 60), S. 130.
�Die Form des Buches
Gegenentwurf zu Goethes Wilhelm Meister konzipiert. Dass diese symbolische Geschichte übertragbar ist und sein muss, notiert Novalis bereits
im unmittelbaren Kontext seiner Thematisierung der modernen Bücher als
Fragmente. In einer Variante heißt es: »Wenn der Geist heiligt, so ist jedes
ächte Buch Bibel«.66 Kurz darauf fällt auch sein bekanntes Diktum vom Leser
als erweiterten Autor. Damit der Geist aber ›heiligen‹, also beseelen kann,
bedarf er der Motivation des Zugangs auf Inhalte, eine Form, in der der Text
zum Lesen, Betrachten, Sich-Vertiefen einlädt. Die Form des Buches, seine
Zwei-Seiten-Form, in der die Gestaltung und der Inhalt verschränkt sind und
die Form der Seite als »das Beywesentliche« und Medium der Verknüpfung,
das zum Blättern motiviert, ist insofern hier als Bedingung der Möglichkeit
des Geistes markiert. Man mag einwenden, dass dies um 1800 nahe liegt.
Doch so historisch determiniert diese Leseszene sein mag, was sie über die
Form des Buches aussagt, legt zumindest die Frage nahe, ob und wie neuere
Medien durch ihre Form funktional äquivalente Alternativen bieten.
66
Novalis: Werke, Bd. 2 (Anm. 54), S. 274.
163
�
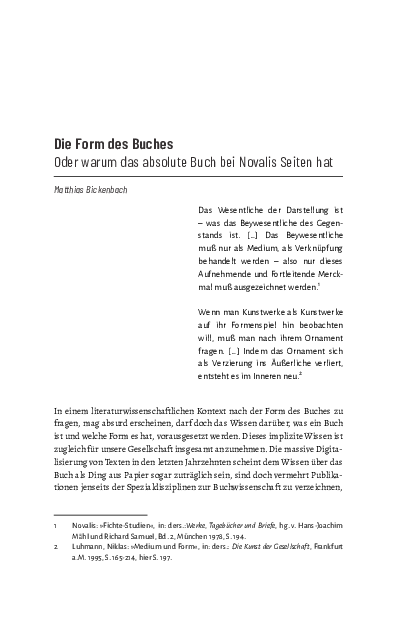
 Matthias Bickenbach
Matthias Bickenbach