Supranationalität
Einleitung
Der Begriff Supranationalität entstammt politisch-rechtlichen Kontexten und bezeichnet die Eigenschaft einer jenseits des Nationalstaates angesiedelten politisch-rechtlichen Autorität, Maßnahmen ergreifen und Gesetze erlassen zu können, die für Nationalstaaten einen (unmittelbar) verbindlichen Charakter haben. Ein Beispiel für eine supranationale Autorität ist die Europäische Union, deren Bestimmungen, bspw. finanzpolitischer Natur, für ihre Mitgliedsstaaten verbindlich sind. Somit unterscheidet sich die Europäische Union von internationalen Institutionen wie der Weltbank, deren politische Maßnahmen erst nach nationalstaatlicher Zustimmung Verbindlichkeit erlangen. Supranationalität zeichnet somit ein politisch-rechtliches System aus, in dem Souveränität nicht ausschließlich auf nationalstaatlicher oder regionalen bzw. lokalen Ebenen, sondern auch auf „über-staatlicher“ Ebene ausgeübt wird. Dieser Eintrag beschäftigt sich jedoch nicht ausschließlich mit rechtlichen Aspekten des Begriffs der Supranationalität bzw. supranationaler Autorität. Er stellt auch dar, inwiefern moral- und politisch-philosophische Auffassungen des klassischen und zeitgenössischen Liberalismus auch jenseits des Nationalstaates normative Geltung beanspruchen und dadurch die auf nationaler Ebene ausgeübte Souveränität in Frage stellen oder an Bedingungen knüpfen, deren Verletzung Grund für internationale Kritik bzw. im Extremfall sogar eine militärische Intervention sein kann.
Historische Einordnung
Eines der zentralen Motive neuzeitlicher liberaler Denker wie John Locke besteht in der Rechtfertigung staatlicher Herrschaftsgewalt. Zu diesem Zwecke charakterisieren sie einen vorstaatlichen Naturzustand, der ihnen als Kontrastfolie dient, um die staatlich verfasste Gesellschaft als normativ vorzugswürdig auszuweisen. Diese Rechtfertigungsstrategie geht auf Thomas Hobbes zurück, der in Levitathan (1962 [1651]) diesen Naturzustand als einen Krieg aller gegen alle darstellt. Hobbes argumentiert, dass aufgrund des fehlenden Monopols legitimer Gewalt im Naturzustand jede Person fortwährend befürchten müsse, dass sie angegriffen oder ihres Besitzes beraubt werde. Daher würde jede Person Vorsichtsmaßnahmen treffen, die zwar legitimer Schutz der eigenen Sicherheit seien, für andere aber eine Gefahr bedeuteten. Für jede Person ist es daher im Naturzustand vorteilhaft, das Recht, die eigene Sicherheit unter Anwendung von Gewaltmitteln zu verteidigen, an den Staat abzutreten – zumindest dann, wenn sich in einem Gesellschaftsvertrag alle Personen dazu verpflichten. Hobbes rechtfertigt auf diese Weise jedoch keinen Weltstaat, sondern nur die Existenz von Einzelstaaten, die sich untereinander sowie in ihrem Verhältnis zu Ausländern in einem Naturzustand befinden. Jenseits des Staates gilt daher lediglich das Naturrecht, so dass Staaten und Individuen in diesem internationalen Naturzustand sich selbst verteidigen dürfen und müssen. Hobbes` politische Theorie sieht also keinen Platz für eine supranationale Autorität vor, welche effektiv in der Lage und dazu befugt wäre, eine internationale bzw. globale Rechtsordnung durchzusetzen.
Immanuel Kant vermeidet hingegen eine derart asymmetrische Auffassung, in der lediglich der innergesellschaftliche, nicht aber der internationale Naturzustand durch einen Rechtszustand abzulösen wäre. Im Anschluss an die von Pierre St. Abbé 1717 angestoßene Debatte um einen ewigen Frieden in Europa verteidigt Kant (2005 [1795], S. 212) in seiner Friedensschrift Zum ewigen Frieden zwar keinen Weltstaat, aber dennoch einen Völkerbund als „Surrogat des bürgerlichen Gesellschaftsbundes“, um den internationalen Naturzustand aufzuheben. Kants Argument gegen die Errichtung eines Weltstaates lautet, dass ein solcher notwendigerweise despotisch sei und die kulturell geprägten Interessen einzelner Gruppen und Individuen nicht adäquat berücksichtigen würde. Dies führe zu einem Aufbegehren gegenüber einem solchem und würde einen (globalen) Bürgerkrieg auslösen. Nichtsdestotrotz erkennt Kants politische Theorie die Notwendigkeit supranationaler Institutionen und Normen in Form eines Völkerbunds und eines weltbürgerlichen Gastrechts an. Die herzustellende globale politisch-rechtliche Ordnung charakterisiert Kant durch folgende „Definitivartikel“: erstens, dass die bürgerliche Verfassung eines jeden Staates republikanisch sei; zweitens, dass das Völkerrecht auf einem Föderalismus freier Staaten beruhe; und drittens, dass sich das Weltbürgerrecht auf ein Gastrecht beschränke. Kants Philosophie weist also über den anarchischen Charakter internationaler Verhältnisse hinaus und fordert die Errichtung einer kosmopolitischen Verfassung. In dieser globalen rechtlichen Ordnung sollen nicht nur Bürger innerhalb von Staaten, sondern auch Staaten untereinander und Weltbürger in ihrem Verhältnis zu fremden Staaten als Rechtspersonen auftreten können, die weder willkürlich behandelt werden dürfen noch von der kosmopolitischen Gesinnung staatlicher Repräsentanten abhängig sein sollen. Um eine solche Ordnung zu erreichen, fordert Kant als Übergangslösung die Einhaltung sechs sogenannter Präliminarartikel, die u.a. in der Abschaffung stehender Heere und dem Verbot von Angriffskriegen bestehen.
Kants kosmopolitische Theorie ist visionär, da die internationale politische Ordnung insbesondere im Verlauf des 20. Jahrhunderts in mehreren Hinsichten die Wende von einem anarchisch zu einem rechtlich verfassten Zustand vollzogen hat. Die seit 1648 geltende „westphälische“ internationale Ordnung sah weder in den inneren noch in den äußeren Verhältnissen der Staaten supranationale Einschränkungen staatlicher Souveränität vor. Sie entsprach daher im wesentlichen Hobbes` Auffassung, dass sich Staaten untereinander in einem Naturzustand befänden, die sich auf internationaler Ebene nur um ihre eigene Sicherheit kümmern müssten und innerstaatlich keine universal geltenden Normen zu befolgen hätten. Die zentralen internationalen Menschenrechtsdokumente des 20. Jahrhunderts – die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR, 1948), das Internationale Abkommen bürgerlicher und politischer Rechte (1966) und das Internationale Abkommen ökonomischer, sozialer und kultureller Rechte – artikulierten jedoch Grundsätze wie das Recht auf Selbstbestimmung (AEMR, Art. 21), das Recht auf Asyl (AEMR, Art. 14) und die Gewissens-, Gedanken-, Rede- und Pressefreiheit (BP, Art. 18 und 19), welche beanspruchen, staatliche Souveränität im Äußeren sowie im Inneren einzuschränken. Diese völkerrechtlich anerkannten Grundsätze sind inhaltlich also sogar deutlich anspruchsvoller als Kants Grundsätze globaler Ordnung.
Positionen des zeitgenössischen Liberalismus
Angesichts der tiefgreifenden Entwicklungen des internationalen öffentlichen Rechts sowie der Herausbildung der Europäischen Union als Staatenverbund, ist es wenig verwunderlich, dass zeitgenössische liberale Debatten die existierende kosmopolitische Ordnung nicht grundsätzlich in Frage stellen, sondern deren inhaltlichen Ausgestaltung behandeln (vgl. Held 2013). Viele liberale Theoretiker beschäftigen sich also nicht mehr mit der Rechtfertigung des Staates und dessen normativen Bedingungen, sondern mit der Rechtfertigung der bestehenden kosmopolitischen Ordnung und deren supranationale Geltung beanspruchenden normativen Bedingungen. Zentrale liberale Strömungen zeitgenössischen internationaler politischer Theorie sind der Globalismus, der Nationalismus, der Etatismus und der Internationalismus.
Charles Beitz (1979) legte in Political Theory and International Relations einen liberalen Globalismus vor, indem er im Ausgang von John Rawls` (1976) Eine Theorie der Gerechtigkeit für eine globale Auffassung liberaler politischer und sozialer Gerechtigkeit argumentierte. Beitz erachtete Rawls`s auf dem sogenannten Urzustand basierende Begründung für seine Gerechtigkeitsgrundsätze – dem Grundsatz gleicher Grundfreiheiten, dem Grundsatz fairer Chancengleichheit und dem Differenzprinzip – als gültig, behauptete jedoch, dass die Anwendungsbedingungen für diese Grundsätze nicht nur innerstaatlich, sondern auch global vorlagen. Diese Anwendungsbedingungen bestünden nämlich in einem System wechselseitiger Abhängigkeit, welches spätestens seit den internationalen politischen und ökonomischen Neuordnungen im Anschluss an beide Weltkriege gegeben sei.
Eine der normativen Implikationen der globalen Gültigkeit der Rawls`schen Auffassung von Verteilungsgerechtigkeit sei, so Beitz, dass es unter bestimmten Umständen geboten sei, die global ökonomisch Schlechtestgestellten gegenüber den national ökonomisch Schlechtestgestellten bei institutionellen Reformen vorranging zu behandeln. Beispielsweise könnten die besonders reichen Länder Entwicklungszusammenarbeit nicht aus dem Grund verweigern, dass diese Ressourcen aufbrauche, die für nationale Umverteilung vorgesehen wäre. Beitz (1994) forderte allerdings nicht, dass seine globalistische Gerechtigkeitsauffassung mittels eines Weltstaates zu realisieren sei, sondern stellte klar, dass unterschiedliche Formen politisch-rechtlicher Souveränität diese realisieren könnten. Dennoch ist offensichtlich, dass insbesondere die Befolgung der stark egalitären Auffassung globaler Verteilungsgerechtigkeit weitreichende Einschränkungen staatlicher Souveränität mit sich bringen würde, da die Besserstellung der global einkommens- und vermögensärmsten Gruppe die Richtschnur staatlichen Handelns sein würde.
Liberale Nationalisten wie Yael Tamir (1993) und David Miller (2007) weisen einen solchen Globalismus daher auch deswegen zurück, weil dieser nicht genug Raum für nationale Selbstbestimmung gewährleiste. Der kulturell-perfektionistische liberaler Nationalismus Tamirs erkennt hierin ein schwerwiegendes Problem des Globalismus, weil die volle Entfaltung menschlichen Glücks erfordere, innerhalb seiner jeweiligen nationalen Gemeinschaft seine kulturell spezifische Vorstellung des guten Lebens auszuüben. Der liberal partikularistisch-kommunitaristische Nationalismus Millers (2010) betont den intrinsischen Wert nationaler Beziehungen, der mit dem intrinsischen Wert einer Freundschaft vergleichbar sei. Der Globalismus berücksichtige diesen Wert jedoch nicht angemessen, da er die unter Landsleuten gebotene Parteilichkeit nicht hinreichend anerkenne. Schließlich sei es mit einer vorrangigen Behandlung der global ökonomisch am schlechtesten Gestellten unvereinbar, die Interessen von Mitbürgerinnen stärker zu gewichten als die von Ausländern, was jedoch nationale Parteilichkeit fordere. Zudem sei nationale Parteilichkeit nicht nur intrinsisch, sondern auch instrumentell wertvoll, um auf nationaler Ebene soziale Gerechtigkeit und Demokratie aufrechterhalten zu können, da sie Ausdruck und Quelle gelebter Solidarität sei.
Millers Auffassung ist nichtsdestotrotz „schwach“ kosmopolitisch, weil sie die Gültigkeit menschlichen Grundbedürfnissen dienender Menschenrechte auf globaler Ebene anerkennt. Er beansprucht damit, dass der liberale Grundsatz, dass allen Menschen gleicher moralischer Respekt geschuldet sei, mit jeweils unterschiedlichen Interpretationen auf nationaler und globaler Ebene vereinbar sei. Miller lehnt allerdings die Vorstellung ab, dass die internationale Gemeinschaft als Ganze oder inter- bzw. supranationale Institutionen primäre Verantwortung für die Realisierung von Menschenrechten in anderen Ländern haben könnten. Die Erfüllung von Menschenrechten liege im primären Verantwortungsbereich der jeweiligen Nationalstaaten, die nur im Falle mangelnder staatlicher Kapazitäten auf die Unterstützung jenseits des Nationalstaats angesiedelter Akteure zurückgreifen sollten.
Liberale Etatisten wie Michael Blake (2001) oder Thomas Nagel (2005) stimmen inhaltlich mit Nationalisten überein. Sie lehnen einen „starken“, egalitären Kosmopolitismus im Sinne des Globalismus ab und befürworten einen menschenrechtsbasierten Kosmopolitismus. Zur Begründung dieser Position berufen sie sich jedoch weder auf eine kulturell-perfektionistische noch auf eine partikularistisch-kommunitaristische Position. Vielmehr behaupten sie, dass die spezifische Natur des vom Staat gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern ausgeübten Zwangs es rechtfertige, die Gültigkeit egalitärer Gerechtigkeitsgrundsätze auf innerstaatliche Verhältnisse zu begrenzen. Die staatlich ausgeübte Zwangsgewalt in liberalen Demokratien würde nämlich im Namen der Bürgerinnen und Bürger ausgeübt und außerdem besonders weitreichend, da sie in Eigentumsverhältnisse eingreife. Da eine solche Art der Zwangsausübung auf inter- und supranationaler Ebene nicht aufzufinden wäre, sei es folgerichtig, dass sich die normativen Bedingungen politisch-rechtlicher Autorität auf nationaler Ebene sich von solchen Bedingungen auf inter- und supranationaler Ebene unterschieden. Der liberale Grundsatz, allen Personen gleichen moralischen Respekt zu zeigen, impliziere daher selbst dann auf nationaler Ebene anderes als auf inter- und supranationaler Ebene, wenn die nationalen Beziehungen unter Landsleuten nicht als Voraussetzung gelungener persönlicher Entfaltung oder als intrinsisch wertvoll anerkannt würden. Daher sei es auch nicht erforderlich, inter- oder supranationale Institutionen einzurichten, welche kosmopolitisch-egalitäre Ziele verfolgen, die über einen Menschenrechtsschutz hinausgehen.
John Rawls` (1999) liberaler Internationalismus lehnt den Globalismus auch ab, allerdings aus dem anderen Grund, dass die liberalen Ideen von individueller Freiheit und interpersonaler Gleichheit nicht Teil der globalen öffentlichen Kultur seien. Die vom Globalismus vollzogene globale Ausweitung dieser Ideen bedeute daher, sich intolerant gegenüber nicht-liberalen Gesellschaften und deren Mitgliedern zu verhalten. Die liberale Idee der Toleranz fordere vielmehr, selbstreflexiv die Eigentümlichkeit liberaler Personen- und Gesellschaftsverständnisse anzuerkennen und inter- oder supranationale Institutionen nicht auf Basis solcher Verständnisweisen einzurichten. Nichtsdestotrotz geht Rawls davon aus, dass sich liberale sowie achtbare (decent) Gesellschaften entsprechend internationaler Grundsätze verhalten könnten, welche die Freiheit und Gleichheit aller liberalen und achtbaren Gesellschaften ausdrückten. Rawls kennzeichnet nicht-liberale, achtbare Gesellschaften dadurch, dass sie sich gegenüber anderen Gesellschaften friedlich verhalten und basale Menschenrechte wie Rechte auf persönliche Unversehrtheit, Mittel zur Subsistenz und privates Eigentum anerkennen, auch wenn deren Mitglieder sich nicht als Freie und Gleiche verstehen und keine gleichen politischen Rechte genießen. Nicht-liberale aber achtbare Gesellschaften seien als vollwertige Mitglieder einer gerechten internationalen Gesellschaft anzuerkennen.
Kant folgend fordert Rawls also ebenso keinen Weltstaat, formuliert und rechtfertigt jedoch normative Bedingungen einer auf internationaler Ebene herzustellenden rechtlich-politischen Ordnung, deren Grundstruktur nach zwischengesellschaftlichen Gerechtigkeitsgrundsätzen wie etwa pacta sunt servanda oder dem Menschenrechtsschutz zu regeln ist. Diese Gerechtigkeitsgrundsätze sollen die politische Autonomie und rechtliche Gleichheit aller Gesellschaften gewährleisten sowie darüber hinaus für eine faire Ausgestaltung des internationalen Handels, der internationalen Kreditvergabe und anderer Formen internationaler Zusammenarbeit sorgen. Die Institutionen der globalen Grundstruktur, die Rawls` Auffassung liberaler internationaler Gerechtigkeit gewährleisten würden, können als supranational aufgefasst werden, da sie nationale Souveränität einschränken, auch wenn sich ihr Regelungsbereich hauptsächlich auf Gesellschaften und nicht auf Individuen bezieht.
Gegenüberstellungen und Kontroversen
Martha Nussbaums (2010, S. 112-4) Fähigkeitenansatz verteidigt eine Liste zehn zentraler Fähigkeiten, deren Verfügbarkeit notwendig und hinreichend sind für ein menschenwürdiges Leben. Diese sind: Leben; körperliche Gesundheit; körperliche Integrität; Sinne, Vorstellungskraft und Denken; Gefühle; praktische Vernunft; Zugehörigkeit; andere Spezies; Spiel; Kontrolle über die eigene Umwelt. Obwohl Nussbaums Ansatz selbst dem politischen Liberalismus von Rawls verpflichtet ist, begründet sie anders als die liberalen Vertragstheoretiker diese zehn zentralen Fähigkeiten nicht mittels der kontrafaktischen Überlegung, welche Freiheiten sich als frei und gleich zu begreifende Individuen sich in einer durch den Naturzustand charakterisierten Ausgangssituation zugestehen würden. An dieser Rechtfertigungsstrategie kritisiert sie nämlich, dass – wie insbesondere David Hume dies in seiner Darstellung der Gerechtigkeitsumstände zum Ausdruck bringt – sie Menschen voraussetzt, die sich in physischer und mentaler Stärke weitestgehend ähneln, so dass die durch den Vertragsschluss entstehende gesellschaftliche Zusammenarbeit auch für alle vorteilhaft sei.
Folglich scheitere diese Art der Rechtfertigung daran, die Freiheiten derjenigen zu rechtfertigen, die deutlich schwächer sind als die meisten Menschen und daher nicht unbedingt auf wechselseitig vorteilhafte Weise mit anderen Menschen interagieren können. Hierzu zählt Nussbaum nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Bewohner ökonomisch besonders armer Länder. Die vertragstheoretische Begründung eines liberalen Kosmopolitismus – wie bspw. Beitz und m.E. auch Rawls sie vornehmen – ist Nussbaum zufolge daher nicht im Stande die anzuerkennenden Freiheiten aller Menschen zu rechtfertigen. Nussbaum schlägt daher eine auch als aristotelisch zu verstehender Begründung ihres politisch liberalen Fähigkeitenansatzes vor, die den Menschen als ein von Natur aus soziales und politisches Wesen charakterisiert, dass sich durch die aktive Verfolgung von Zielen auf Basis des praktischen Vernunftgebrauchs auszeichne.
Vertreter des Realismus wie Hans Morgenthau oder des Neo-Realismus wie John Mearsheimer kritisieren die unterschiedlichen Vorstellungen liberaler kosmopolitischer Ordnung dafür zu verkennen, dass in Ermangelung eines globalen Souveräns internationale Beziehungen anarchisch blieben. Hobbes folgend gälten daher auf internationaler Ebene entweder keinerlei moralische Grundsätze oder lediglich der Grundsatz, dass Staaten ihre nationalen Interessen zu verfolgen hätten. In der Folge seien die liberalen Auffassungen idealistisch, da sie weitaus anspruchsvollere normative Bedingungen für Beziehungen jenseits des Staates in Anschlag brächten, die weder begründbar noch realisierbar seien. Liberale Kritiker des Realismus wie Allen Buchanan (2004, S. 31-7) verweisen jedoch auf die große Verflochtenheit zwischen Staaten und über Staaten hinweg, die sich insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herausgebildet hat und unter dem Begriff Global Governance zusammengefasst wird. Aufgrund dieser Verflochtenheit ließe sich die starke normative Dichotomie zwischen den innerstaatlichen und den jenseits von Staaten Geltung beanspruchenden normativen Bedingungen, die der Realismus vertritt, nicht aufrechterhalten.
Philosophinnen und Philosophen der critical race theory, z.B. Charles Mills (2017), weisen darauf hin, dass der Liberalismus auf Basis einer hierarchischen Klassifizierung unterschiedlicher „Rassen“ dem Kolonialismus und Imperialismus dienlich war und somit der bis heute andauernden Vorherrschaft der Weißen (white supremacy) Vorschub geleistet hat. Die gegenwärtig weiterhin große politische und ökonomische internationale Ungleichheit sei daher nicht als Folge der mangelnden Befolgung kosmopolitischer, liberaler Grundsätze zu verstehen, sondern vielmehr die Konsequenz einer sich aus der theoretisch angelegten Ungleichbehandlung weißer und nicht-weißer „Rassen.“ Dass liberale Staaten wie Großbritannien, Kanada und die USA auf der Versailler Friedenskonferenz 1919 den Vorschlag Japans ablehnten, die Gleichheit aller „Rassen“ im Vertrag des Völkerbundes anzuerkennen, sei also z.B. keine Abweichung vom liberalen Skript, sondern vielmehr Ausdruck dessen Befolgung. Ebenso sei der auch nach den beiden Weltkriegen in „liberalen“ Gesellschaften weiterhin grassierende Rassismus keine psychologisch zu verstehende Absonderlichkeit, sondern Ausdruck einer historisch wirkmächtigen Tiefenstruktur des Liberalismus, die auch wissenschaftlich vernachlässigt und verharmlost werde.
Praktische Relevanz
Die hinsichtlich der Art und des Ausmaßes supranational geltender Normen und Institutionen eingenommene Position hat für eine Vielzahl von Handlungsbereichen weitreichende normative Implikationen. Zu diesen zählen u.a. die Bildungs-, Einwanderungs-, Entwicklungs-, Finanz-, Gesundheits-, und Umweltpolitik. Im Bildungsbereich würden etwa Alle liberalen Positionen Menschenrechtsbildung für erforderlich halten und die stark kosmopolitischen Positionen zusätzlich Schulformen und pädagogische Praktiken fordern, die transnationaler Solidarität und somit auch einer Angleichung der Lebensverhältnisse über Staaten hinweg dienlich wären. In der Einwanderungspolitik erkennen alle liberalen Positionen ein Menschenrecht auf Asyl an, unterscheiden sich aber dahingehend, ob eine Öffnung nationaler Grenzen egalitären Zielen wie der Verringerung transnationaler ökonomischer Ungleichheit dienen soll, oder aber deren Schließung zum Schutz nationaler Selbstbestimmung geboten ist. Insofern besteht ein schwach-kosmopolitischer Grundkonsens unter allen liberalen Positionen, der nicht nur dem genannten Realismus widerspricht, sondern auch den ethno-nationalistischen und autoritären Auffassungen, die sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts in populistischen politischen Strömungen finden.
Bibliographie
Beitz, Charles: Political Theory and International Relations [1979]. Princeton 21999.
Beitz, Charles: Cosmopolitan Liberalism and the States System. In: Brown, Chris (Hg.): Political Restructuring in Europe – Ethical Perspectives. London, 1994, 123-136.
Buchanan, Allen: Justice, Legitimacy and Self-Determination. Oxford 2004.
Blake, Michael: Distributive Justice, State Coercion, and Autonomy. Philosophy & Public Affairs 30 (2001), 257-96.
Held, David: Kosmopolitanismus. Idee und Wirklichkeit. Freiburg 2013.
Hobbes, Thomas: Leviathan [1651]. New York 1962.
Kant, Immanuel: Zum Ewigen Frieden. Ein Philosophischer Entwurf [1795]. In: Wilhelm Weischedel (Hg.), Immanuel Kant. Werke in sechs Bänden. Darmstadt 62005, 194–251
Mearsheimer, John: The False Promise of International Institutions. In: International Security 19 (1994/5), 5-49.
Miller, David: National Responsibility and Global Justice. Oxford 2007.
Miller, David: Vernfünftige Parteilichkeit gegenüber Landsleuten. In: Broszies, Christoph und Hahn, Henning (Hg.): Globale Gerechtigkeit. Frankfurt a. M., 2010, 146–171.
Mills, Charles: Black Rights/White Wrongs: The Critique of Racial Liberalism. Oxford 2017.
Morgenthau, Hans: In Defense of the National Interest. New York 1952.
Nagel, Thomas: The Problem of Global Justice. In: Philosophy & Public Affairs 33 (2005), 113–47.
Nussbaum, Martha: Grenzen der Gerechtigkeit. Berlin 2010 (engl. 2006)
Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit [1976]. Frankfurt a. M. 1979 (engl. 1999).
Rawls, John: Das Recht der Völker. Berlin 2002 (engl. 1999).
Tamir, Yael: Liberal Nationalism. Princeton 1993.
1

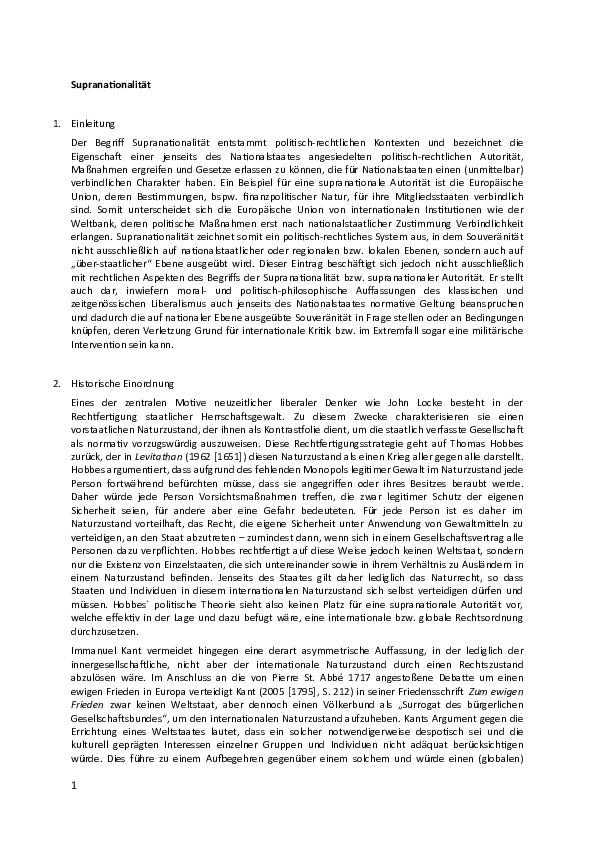
 Julian Culp
Julian Culp