Forschungsbericht
Sabine Buchebner-Ferstl ▪ Christine Geserick
Demenz und Familie
Forschungsbericht Nr. 30 | 2019
Österreichisches Institut für Familienforschung
an der Universität Wien
1010 Wien | Grillparzerstraße 7/9
T: +43(0)1 4277 48901 | info@oif.ac.at
www.oif.ac.at
ARBEITSPROGRAMM 2007
�Forschungsbericht
Sabine Buchebner-Ferstl ▪ Christine Geserick
Demenz und Familie
Nr. 30 | 2019
Februar 2019
Gefördert aus Mitteln des Bundeskanzleramtes über die Familie & Beruf Management GmbH.
Das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien (ÖIF) führt als unabhängiges
wissenschaftliches Institut anwendungsorientierte Studien und Grundlagenforschung zur Struktur und
Dynamik von Familien, Generationen, Partnerschaften und Geschlechtern durch. Die Kooperation mit
internationalen Forschungseinrichtungen und die familienpolitische Beratung zählen dabei ebenso wie
die umfangreiche Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben des ÖIF.
Dieses Werk ist mit CC BY-ND 4.0 International lizensiert.
�Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung .......................................................................................... 4
2 Theoretischer Hintergrund .............................................................. 5
2.1 Was versteht man unter dem Begriff "Demenz"? .......................................................... 5
2.2 Formen von Demenzerkrankungen .............................................................................. 7
2.3 Besonderheiten bei der Betreuung und Pflege von Personen mit Demenz ................... 9
2.4 Diagnose und Therapie .............................................................................................. 12
2.5 Demenz im Kontext Familie ........................................................................................ 14
2.5.1 Männer und Frauen als Pflegende ..................................................................... 15
2.5.2 Demenz in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen .................................. 18
3 Einleitung empirischer Teil ............................................................ 21
3.1 Methode und Soziodemografie ................................................................................... 21
3.2 Kurzbiografien ............................................................................................................ 24
4 Ergebnisse ...................................................................................... 34
4.1 Unterschiedliche Pflegearrangements und Rolle der Interviewpartner/innen .............. 34
4.1.1 Familiale Pflege: Hauptverantwortlich ................................................................ 35
4.1.2 Familiale Pflege: Hauptverantwortlich gemeinsam mit 24h-Betreuung ............... 40
4.1.3 Familiale Pflege: Nicht hauptverantwortlich ........................................................ 43
4.1.4 Nicht familiale Pflege: Wohnt in der Nähe .......................................................... 44
4.1.5 Nicht familiale Pflege: Wohnt in größerer Entfernung ......................................... 46
4.1.6 Nicht familiale Pflege: Heimbetreuung................................................................ 51
4.2 Inanspruchnahme einer 24h-Betreuung ..................................................................... 54
4.2.1 Gründe und Auslöser ......................................................................................... 54
4.2.1.1 Allein lebende Person kann nicht mehr alleine gelassen werden.................. 54
4.2.1.2 Alleinige Betreuung ist nicht mehr zu bewältigen .......................................... 55
4.2.1.3 Andere Betreuungsalternativen werden abgelehnt ....................................... 55
4.2.2 Positive Erfahrungen und Aspekte ..................................................................... 56
4.2.3 Negative Erfahrungen und Aspekte.................................................................... 56
4.3 Inanspruchnahme der Heimbetreuung ....................................................................... 59
4.3.1 Gründe und Auslöser ......................................................................................... 59
4.3.1.1 Alleinige Betreuung nicht mehr zu bewältigen/verantworten ......................... 59
4.3.1.2 Ablehnung der betreuenden Person ............................................................. 61
4.3.1.3 Finanzielle und organisatorische Gründe ..................................................... 61
4.3.2 Positive Erfahrungen und Aspekte ..................................................................... 61
4.3.3 Negative Erfahrungen und Aspekte.................................................................... 62
4.4 Gründe gegen alternative Arrangements .................................................................... 63
4.4.1 Gründe gegen (rein) familiale Pflege .................................................................. 63
4.4.2 Gründe gegen Inanspruchnahme formeller Angebote ........................................ 64
4.4.2.1 Finanzielle und organisatorische Gründe ..................................................... 64
4.4.2.2 Ablehnung durch Betreuten .......................................................................... 65
4.4.2.3 Misstrauen der Angehörigen gegenüber der Betreuungsform ...................... 66
4.4.2.4 "Was denken die anderen?" ......................................................................... 67
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.5 Finanzierbarkeit der Pflege......................................................................................... 68
4.6 Strukturelle Schwierigkeiten und Hürden .................................................................... 74
4.7 Emotional Schwieriges und Entlastendes ................................................................... 77
4.7.1 Schwieriges........................................................................................................ 77
4.7.1.1 Eigenes Wohlbefinden ................................................................................. 77
4.7.1.2 Beziehungsebene......................................................................................... 79
4.7.1.3 Soziale Komponente .................................................................................... 85
4.7.2 Entlastendes ...................................................................................................... 86
4.7.2.1 Zusammenhalt: "Dass man nicht alleine ist" ................................................. 86
4.7.2.2 Austausch: "Dieses gemeinsame Jammern war schon entlastend" .............. 87
4.7.2.3 Verstehen: "Die Diagnose ist fast eine Erleichterung" .................................. 89
4.7.2.4 Ablenkung: "Mit dem beschäftigen, was mir taugt" ....................................... 90
4.7.2.5 Selbstbesinnung: "Zur Ruhe kommen, damit mein Hirn aufhört zu rattern"... 91
4.8 Verantwortung: Engagement und Grenzen................................................................. 93
4.8.1 Verantwortung beanspruchen: "Ich krieg' es nicht übers Herz, da zuzuschauen" 94
4.8.2 Verantwortung annehmen: "Ich kann mich ja nicht einfach so abseilen" ............ 95
4.8.2.1 Generationenbeziehung: "Etwas zurückgeben" ............................................ 97
4.8.2.2 Partnerschaft: "Nicht nur für schöne Tage" ................................................... 99
4.8.3 Pflichtgefühl gegenüber Dritten: "Aus Liebe zu meinem Mann" .........................100
4.8.4 Grenzen ............................................................................................................102
4.8.4.1 Eigene psychosoziale Gesundheit: "Ich war mit den Nerven völlig runter" ...103
4.8.4.2 Beziehungsebene: "Je nachdem, wie das Verhältnis ist" .............................105
4.9 Veränderungen im Familiensystem ...........................................................................108
4.9.1 Neue Rollen und Rollenumkehr.........................................................................108
4.9.1.1 Generationenaspekt: "Wie ein viertes Kind" ................................................108
4.9.1.2 Geschlechteraspekt: "So wie ich früher war, das ist jetzt er!".......................111
4.9.2 Kontinuitäten .....................................................................................................113
4.9.2.1 Positive (Intensivierung von) Beziehungen ..................................................114
4.9.2.2 Schwierige Familienbeziehungen, v.a. unter Geschwistern .........................114
4.10 Reflexion .................................................................................................................120
4.10.1 Ratschläge für andere Betroffene......................................................................120
4.10.1.1 Unterstützung: "Nur ja nicht glauben, man schafft es allein!" .....................121
4.10.1.2 "Ebenen schaffen, damit es dem Menschen gutgeht" ................................125
4.10.1.3 Die Situation annehmen ............................................................................125
4.10.2 Gedanken über die Krankheit............................................................................127
5 Zusammenfassung ....................................................................... 131
6 Literatur ......................................................................................... 137
7 Kurzbiografien der Autorinnen .................................................... 139
2
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Taxonomie der Diagnostik bei "neurocognitive disorders" (NCD) im DSM V ..... 7
Abbildung 2: Demenzursachen.............................................................................................. 7
Abbildung 3: Motive von Männern für die Pflegeübernahme (Dosch 2018)...........................17
Abbildung 4: Überblick über die Interviewpartner/innen ........................................................23
Abbildung 5: Überblick über Betreuungsarrangements (inkl. Interviewnummern) .................35
3
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
1 Einleitung
Dementielle Erkrankungen sind in den letzten Jahren zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Was früher oftmals als "typische Alterserscheinung" abgetan, als "Altersbosheit" oder "Altersstarrsinn" interpretiert oder mit Begriffen wie "Verkalkung" oder "Senilität" bedacht wurde, wird nun als Krankheitsbild wahrgenommen, in das sich die auftretenden kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Veränderungen einordnen lassen.
Der Österreichische Demenzbericht 2014 (Höfler et al. 2015) nennt die Zahl von etwa 130.000
Personen, die in Österreich an einer Form von Demenz erkrankt sind. Aufgrund des kontinuierlichen Altersanstiegs in der Bevölkerung gehen Prognosen davon aus, dass sich diese Anzahl bis zum Jahr 2050 in etwa verdoppeln wird. In Österreich erhalten rund 80 % der (insgesamt) Pflegebedürftigen ausschließlich nicht-stationäre Hilfe (ebd.), und so findet auch die
Pflege Demenzkranker fast überwiegend – und oft über Jahre hinweg – im Familienumfeld
statt. Für pflegende Angehörige ist die Diagnose Demenz mit einer Palette an Herausforderungen und oft nachhaltigen Veränderungen im Familiensystem und in der Gestaltung des
Alltags verbunden.
Die empirische Studie mit qualitativem Design gewährt einen facettenreichen Einblick in
die Lebensrealitäten von pflegenden Angehörigen in unterschiedlichen Familienkonstellationen und Betreuungsarrangements. In verschiedenen Regionen Österreichs wurden insgesamt
17 Leitfaden-Interviews mit Familienangehörigen von Demenzpatient/innen geführt, welche allein oder mit zusätzlicher Unterstützung betreuen bzw. pflegen. An der Studie haben
Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 85 Jahren teilgenommen, die ihren Partner bzw.
ihre Partnerin, einen Eltern- bzw. Schwiegerelternteil pflegen oder auch ihre Großeltern.
Der Bericht gliedert sich in einen einführenden Theorieteil und einen größeren empirischen
Teil. Im Theorieteil wird zunächst das Thema Demenz eingeleitet, zu deren Beginn die Definition und (häufig vernachlässigte) Vielgestaltigkeit der Krankheit erläutert wird, sowie Ansätze
zu Diagnose und Therapie. Auch wird ein erster Blick darauf geworfen, was eine Demenzerkrankung im Kontext von Familie bedeutet, und zwar sowohl für die Angehörigen als auch die
Patient/innen selbst.
Der empirische Teil schließlich stellt die Analyseergebnisse der qualitativen Themenanalyse
zusammen. Sie gibt einen Einblick, wie pflegende Familienangehörige ihre Situation erleben,
wie Entscheidungen für das jeweilige Pflegearrangement getroffen werden, vor welchen strukturellen und emotionalen Herausforderungen sie stehen, wo sie Entlastung finden, welche Veränderungen und Kontinuitäten im Familiensystem erkennbar sind und wie die interviewten
Personen ihre eigene Situation reflektieren, z.B. welche Ratschläge sie für andere Betroffene
parat haben.
So soll die Studie insgesamt dazu beitragen, ein tiefergehendes Verständnis für die Situation
von Familien mit einem/einer an Demenz erkrankten Angehörigen zu entwickeln und letztendlich vielleicht auch dabei helfen, einen lösungsorientierten Ansatz in Hinblick auf den Umgang
mit Demenz als gesellschaftliche Herausforderung zu entwickeln.
4
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
2 Theoretischer Hintergrund
In diesem Abschnitt, der die Hintergrundfolie für den nachfolgenden empirischen Teil bildet,
sollen basale Grundinformationen zu Demenzerkrankungen und dazu, was die Diagnose für
Betroffene und Angehörige bedeutet, dargeboten werden. So wird der Begriff der "Demenz"
an sich einer tiefergehenden Betrachtung unterzogen und Einblick in die unterschiedlichen
Erscheinungsformen der Krankheit gewährt. Weiters wird auf einige Besonderheiten in der
Pflege und Betreuung von demenzkranken Personen eingegangen, der Diagnoseprozess kurz
erläutert und therapeutische Ansätze angeführt. Zuletzt werden noch unterschiedliche Pflegekonstellationen im Familienkontext unter dem Geschlechter- und Generationenaspekt beleuchtet.
2.1
Was versteht man unter dem Begriff "Demenz"?
Das Krankheitsbild "Demenz" wird im ICD-101 als Syndrom infolge einer chronischen bzw.
fortschreitenden Erkrankung des Gehirns definiert, einhergehend mit Störungen und Beeinträchtigungen vieler höherer kortikaler Funktionen. Dazu zählen insbesondere Gedächtnis,
Orientierung, Auffassung, Urteilsvermögen, Lernfähigkeit, Sprache und Rechnen. Als Begleiterscheinungen treten Störungen des Erlebens, Befindens und Verhaltens auf, wie etwa Veränderungen der emotionalen Kontrolle, des Sozialverhaltens oder der Motivation. (vgl. z.B.
Beiglböck et al. 2000: 36, Höfler et al.: 4).
Geht man der Wortbedeutung des Ausdrucks "Demenz" auf den Grund, so sind mit dem lateinischen Begriff "dementia" in erster Linie "Verrücktheit" und "Wahnsinn" assoziiert. Während
"mens" im Lateinischen Geist, Bewusstsein, Denkvermögen und Verstand umschreibt, aber
darüber hinaus begrifflich beispielsweise auch Seele, Gemüt und Charakter umfasst, weist die
Vorsilbe "de-" auf ein Fehlen bzw. einen Verlust dieser Elemente hin ("ab", "fort", "herab",
"nieder").2 Vor diesem Hintergrund formt sich ein sehr bedrohlich anmutendes Bild eines Geisteszerfalls im Kontext von Wahnsinn und gänzlichem Persönlichkeitsverlust, der nicht nur den
Geist, sondern gleichsam auch die Seele miteinschließt.
Unter diesem Gesichtspunkt kann der Bezeichnung "Demenz" eine stigmatisierende Wirkung
unterstellt werden, die möglicherweise auch dazu beitragen kann, dass Betroffene sowie deren
Angehörige zur Verdrängung und Tabuisierung von Symptomen, die auf eine dementielle Erkrankung hinweisen, neigen und Interventionsmaßnahmen daher erst sehr spät zum Einsatz
kommen (können). Dieser Umstand war möglicherweise mit ein Grund, weshalb in der 2013
erschienenen Neufassung des in Amerika verbreiteten Klassifikationssystems DSM der American Psychiatric Association (aktuelle Version: DSM V)3 auf den Begriff "Demenz" gänzlich
verzichtet und stattdessen von sogenannten "Neurokognitiven Störungen" (NCD, engl.: neurocognitive disorders) gesprochen wird. So merken beispielsweise Maier & Barnikol (2014) an:
1
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme); bei dem ICD-10 handelt es sich um die aktuell
gültige Ausgabe dieses Klassifikationsschemas.
2 vgl. https://de.pons.com (Latein-Deutsch).
3
DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
5
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
"Als Vorteil der Bezeichnung majore NCD4 anstelle von Demenzen kann sich eine mögliche
Reduktion des "Stigmas" herausstellen, das dem Begriff Demenz (de mente = "ohne Geist")
anhaftet." (Maier & Barnikol 2014: 567)
Die Hauptintention, die hinter dem Verzicht auf den Demenzbegriff steht, war jedoch, den beträchtlichen Forschungsfortschritt der letzten Jahre im interdisziplinären Bereich neurodegenerativer und neurovaskulärer Erkrankungen diagnostisch adäquat abzubilden. So hat sich
herausgestellt, dass Demenzen neuropsychologisch zu heterogen sind, was sich etwa darin
äußerte, dass bei dementieller Symptomatik infolge vaskulärer Erkrankungen der Begriff "vaskuläre kognitive Beeinträchtigung" anstelle von "vaskulärer Demenz" verwendet wurde. Darüber hinaus war die diagnostische Schwelle für Demenz zu hoch angesetzt. Es ist bekannt,
dass alle zugrundeliegenden Entstehungsursachen meist schon Jahre vor dem Auftreten eines Demenzsyndroms zu neuropsychologischen und klinischen Zeichen führen. Diese konnten mit dem bisherigen Diagnoseschema jedoch nicht adäquat erfasst werden (vgl. Maier &
Barnikol 2014: 564). Eine Früherkennung dementieller Erkrankungen, deren Bedeutung mittlerweile außer Zweifel steht, wird somit deutlich erleichtert, wenn sie auch als solche benannt
werden.
Die im DSM V neu eingeführte diagnostische Gruppe der neurokognitiven Störungen umfasst
neben den bereits erwähnten Differenzierungen "majore" und "minore neurokognitive Störung"
auch noch die Diagnose "Delir". In der unteren Abbildung sind die drei Diagnosebereiche inklusive Spezifikationen ("Specifier") im Überblick dargestellt.5 In der rechten (unteren) Bildhälfte sind die Gründe, die zu einer majoren bzw. minoren neurokognitiven Störung führen
können, aufgeführt, wie etwa die Alzheimer-Krankheit oder ein Schädel-Hirn-Trauma. Auf
diese Ursachen, mit denen gleichzeitig die verschiedenen Formen dementieller Erkrankungen
angesprochen sind, wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen.
4
Unter „NCD major“ werden ausgeprägte kognitive Leistungseinbußen, die Unselbstständigkeit hervorrufen (d.h.
Abhängigkeit von Hilfe bei komplexen Aufgaben) subsummiert. Im Gegensatz dazu führen moderate Leistungseinbußen im Rahmen einer „NCD minor“ zwar zu Funktionseinbußen, jedoch (noch) nicht zu einer Hilflosigkeit.
5 Auf die Diagnose „Delir“ wird in der Abbildung nicht detailliert eingegangen.
6
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Abbildung 1: Taxonomie der Diagnostik bei "neurocognitive disorders" (NCD) im DSM V
Quelle: Maier & Barnikol (2014): 565; eigene Darstellung ÖIF 2018
2.2
Formen von Demenzerkrankungen
Wie im vorherigen Abschnitt erläutert und aus Abbildung 1 ersichtlich, kann neurokognitiven
Störungen, die im allgemeinen Sprachgebrauch als "Demenz" klassifiziert werden, eine Reihe
von Ursachen zugrunde liegen. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Häufigkeit der unterschiedlichen Störungen und Erkrankungen, die eine Demenz zur Folge haben (können).
Dabei ist auch die Kombination zweier Faktoren möglich.
Abbildung 2: Demenzursachen
Quelle: Kurz et al. (2016): 9; basierend auf Schneider et al. (2007); eigene Darstellung ÖIF 2018
7
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Wie in der Abbildung ersichtlich, stellt die als Alzheimer-Demenz bekannte und mit einem hohen Lebensalter assoziierte Erkrankung die mit Abstand am häufigsten auftretende Erscheinungsform dar. Zwei Drittel bis drei Viertel der Demenzformen sind dieser Kategorie zuzuordnen. Demenzen aufgrund von Durchblutungsstörungen des Gehirns (vaskuläre bzw. Gefäßerkrankungen) nehmen ebenfalls einen gewissen Stellenwert ein. In Kombination mit der Alzheimer-Krankheit sind dies gemäß Kurz et al. (2016) mehr als 40 %. Andere Autor/innen geben
einen Anteil von 15 bis 20 % an (z.B. Weyerer 2005, Beiglböck et al. 2000). Darüber hinaus
sind noch zwei weitere Formen der Demenz bekannt, nämlich einerseits die Lewy-KörperchenKrankheit, die bei etwa 10 % der erkrankten Personen diagnostiziert wird, sowie die noch seltener auftretende frontotemporale Degeneration. Die übrigen Demenzformen verteilen sich auf
Stoffwechselerkrankungen, Infektionen sowie Demenzen mit "behebbaren Ursachen" (jeweils
2 %).
Die im Folgenden anschließende kurze Beschreibung der verschiedenen Demenzformen ermöglicht einen Einblick in die Vielfältigkeit des Krankheitsbildes "Demenz" und lässt die damit
verknüpften Herausforderungen bereits erahnen.
Bei der Alzheimer-Demenz als häufigste und bekannteste Form der Demenzerkrankung handelt es sich um eine degenerative Erkrankung des Gehirns mit charakteristischen Kennzeichen
auf neuropathologischer und neurochemischer Ebene. Sie wurde nach dem deutschen Nervenarzt Alois Alzheimer benannt und 1906 erstmals von ihm beschrieben. Bei dieser Erkrankung kommt es zum Absterben von Nervenzellen in bestimmten Gehirnregionen, wofür nach
heutigem Wissensstand zwei Eiweißstoffe (Beta-Amyloid und Tau) verantwortlich sind, die
sich im Gehirn ablagern (vgl. Schweizerische Alzheimervereinigung 2007). Typisch ist der
schleichende Beginn mit langsamer Verschlechterung – nicht selten werden die Anzeichen
einer beginnenden Alzheimer-Demenz als "normale Alterserscheinungen" oder auch als Unwillen oder gar Boshaftigkeit der betreffenden Person missinterpretiert. Neben Problemen mit
dem Gedächtnis oder Wortfindungsstörungen sind insbesondere Veränderungen des Verhaltens (z.B. sozialer Rückzug, Vernachlässigung der Körperpflege) und der Gemütsverfassung
(z.B. depressive Verstimmung) typische Kennzeichen.
Vaskuläre Ursachen für Demenz bzw. neurokognitive Störungen betreffen Gefäßerkrankungen des Gehirns. Die sogenannte vaskuläre Demenz tritt häufig infolge von Gehirninfarkten
(Schlaganfällen) auf und ist mit einer beeinträchtigten Handlungsplanung sowie Sprach-, Aufmerksamkeits- und Denkschwierigkeiten verbunden. Gedächtnisprobleme stehen im Gegensatz zur Alzheimer-Erkrankung nicht im Vordergrund, typisch sind hingegen begleitende körperliche Symptome (Lähmungserscheinungen, epileptische Anfälle), Stimmungsschwankungen und eine generelle Verlangsamung des Denkens (vgl. z.B. Höfler et. al 2014, Schweizerische Alzheimervereinigung 2007). Im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz, die sich typischerweise erst im höheren Lebensalter (nur in sehr seltenen Fällen vor dem 65. Lebensjahr) entwickelt, können auch wesentlich jüngere Menschen mit den entsprechenden Vorerkrankungen
betroffen sein.
Die Lewy-Körperchen-Krankheit als Demenzursache ist mit einer fortschreitenden Gedächtnisstörung, psychotischen Symptomen (z.B. Halluzinationen) und/oder Bewegungsstörungen
(z.B. Zittern) assoziiert. Als typische Symptome werden auch auffällige Schwankungen in Hinblick auf die geistigen Fähigkeiten und die Wachheit im Tagesverlauf angeführt. Zudem ist
8
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
eine hohe Sturzneigung aufgrund von hypotonen Kreislaufstörungen bereits im frühen Stadium
kennzeichnend (vgl. Deutsche Alzheimer Gesellschaft 2011). Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft weist auch darauf hin, dass diese Form der Demenz aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades trotz typischer Symptome häufig als Alzheimer-Demenz fehldiagnostiziert wird.
Gleichzeitig sei die Betreuung gerade durch das Auftreten psychotischer Symptome in Verbindung mit vielen körperlichen Problemen für Angehörige besonders belastend.
Frontotemporale Demenzen machen zwar einen relativ geringen Anteil an Demenzerkrankungen insgesamt aus (rund 5 %), stellen jedoch aufgrund des vergleichsweise frühen Beginns in der Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen die häufigste Demenzform dar. Es sind verschiedene Ausprägungsformen bekannt, bei denen jeweils unterschiedliche Symptome im
Vordergrund stehen. Eine frontotemporale Demenz äußert sich unter anderem in einer gestörten Empathie, stereotypen Verhaltensmustern, Veränderungen des Essverhaltens und
Sprachstörungen (Aphasien) (vgl. Witt et al. 2013).
2.3
Besonderheiten bei der Betreuung und Pflege von Personen mit Demenz
Die Betreuung und Pflege von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist mit besonderen
Herausforderungen verknüpft, die an dieser Stelle kurz erörtert werden sollen. Die Auflistung
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist vielmehr als Gedankenanstoß zu verstehen, der die Vielfalt der Anforderungen, die die Pflege Demenzkranker an Angehörige stellt,
erahnen lässt.
Demenz – die maskierte Krankheit
Gerade die häufigste Form der Demenz – jene vom Typ Alzheimer – entwickelt sich schleichend und wird deshalb oft relativ spät erkannt. So beschreibt etwa auch der Schriftsteller
Arno Geiger die Schwierigkeit, die Veränderungen im Verhalten aufgrund der beginnenden
Demenz des Vaters richtig zu deuten: "Die Krankheit zog ihr Netz über ihn, bedächtig, unauffällig. Der Vater war schon tief darin verstrickt, ohne dass wir es merkten" (Geiger 2012: 19f).
Gerade in der Frühphase der Erkrankung sind auch viele alternative Erklärungsansätze denkbar – manches kann vielleicht noch dem natürlichen Alterungsprozess zugeschrieben werden,
in anderen Fällen kann sie von anderen Erkrankungen (wie etwa einer Depression) zuweilen
nur schwer abgegrenzt werden. Zudem setzen Betroffene oft Kompensationsmechanismen
ein, um ihre Defizite, die sie meist sehr wohl wahrnehmen, zu verbergen (vgl. z.B. Weyerer
2005). Zahlreiche Erfahrungsberichte in einschlägigen Online-Foren verweisen darauf, dass
auch Fachleute mitunter die Symptome falsch deuten. Hier schreibt ein männlicher Patient:
"Wir waren bei so vielen Ärzten. Einer sagte: In Ihrem Alter eine Telefonnummer oder die
Schlüssel zu vergessen, ist doch normal. Ein anderer: Sie stehen unter Stress, entspannen
Sie sich und dann merken Sie sich auch wieder Dinge. Eine Odyssee. Niemand hat mich ernst
genommen. Sogar meine Frau zweifelte an mir und unterstellte mir, dass ich Dinge absichtlich
mache. Warum? Es macht keinen Spaß dumm zu sein und ständig Sachen zu suchen. Ich
kann nichts dafür. Ich bin krank und habe Alzheimer." (https://demenz-portal.at/leben-mit-demenz/erfahrungsberichte/)
9
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Umgang mit dem veränderten Erleben und Verhalten Demenzkranker
Im Österreichischen Demenzbericht (Höfler et al. 2014: 129) werden Verhaltensveränderungen als jene Faktoren bezeichnet, die bei zwei Drittel aller Betroffenen auftreten und gleichzeitig die größte Belastung für pflegende Angehörige darstellen. Zu Auffälligkeiten zählen etwa
ein gestörter Tag- und Nacht-Rhythmus, ständiges Fragen, Misstrauen und Beschuldigungen,
ständiges Umherwandern sowie depressives und aggressives Verhalten. So berichtet etwa
eine 14-jährige Enkelin:
"Da mein Opa nicht von alleine geht, bringe ich ihn in sein Zimmer, ziehe ihn aus, Windelhose
und Schlafanzug an und lege ihn ins Bett. Dann versuche ich ein paar Stunden zu schlafen.
Denn es wird nicht lange dauern, da wird mein Großvater wieder ruhelos im Haus umherstreunen und laut Geschichten erzählen." (http://www.alzheimerandyou.de/was-kannst-du-tun/erfahrungsberichte/)
Weyerer (2005) verweist darauf, dass Verhaltensprobleme wie Unruhezustände, Aggressionen oder psychotische Symptome die Belastung der Betreuungspersonen massiv erhöhen
und oft die primäre Ursache für eine Heimunterbringung darstellen. Die nachweislich deutlich
höhere subjektive Belastung der pflegenden Angehörigen von Demenzkranken (im Gegensatz
zu Pflegenden von Nichtdemenzkranken) wird primär auf die zwischenmenschlichen Konflikte
aufgrund dieser problematischen Verhaltensveränderungen zurückgeführt.
Fortschreitende Verschlechterung bei gleichzeitig fehlender Planbarkeit
Mit dem Beginn einer dementiellen Erkrankung wird ein Prozess eingeleitet, der zwar bis zu
einem gewissen Grad verlangsamt werden kann, aber dennoch unweigerlich fortschreitet und
irreversibel ist. Während beispielsweise die Betreuung eines Kleinkindes mit der unzweifelhaften Aussicht auf eine zunehmende Erleichterung der Betreuungssituation aufgrund der Lernfähigkeit des Kindes verknüpft ist, führen jegliche Unterstützungsmaßnahmen, die auf eine
Verbesserung der Lage im Sinne eines Wiederherstellens von Fähigkeiten abzielen, ins Leere.
Zudem erweist sich das Zusammenleben mit einer an Demenz erkrankten Person nur in begrenztem Ausmaß als planbar: Was heute noch funktioniert hat, kann morgen plötzlich zu einem Problem werden. So beschreibt eine Angehörige in einem Demenzforum:
"Es gibt drei Dinge, die wir in der Betreuung unserer demenzkranken Mutter gelernt haben:
Geduld, Flexibilität und Kreativität. Und: dass kein Tag dem anderen gleicht. Kaum hatten wir
uns auf ein neues Verhalten, eine neue Situation eingestellt, stellte sie uns vor eine weitere
Herausforderung." (https://demenz-portal.at/angehoerige/erfahrungsberichte/)
Pflege- und Betreuungsbedarf – zwischen Selbst- und Fremdbestimmung
Die Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten ist unweigerlich auch mit einem Verlust an
Urteilsvermögen verbunden. Angehörige bewegen sich mit dem Fortschreiten der Erkrankung
rasch in vielerlei Hinsicht auf einem schmalen Grat zwischen verantwortungsvollen Schutzbestrebungen und Freiheitsberaubung bis hin zur Gewalt. Wenn Demenzkranke den Herd vergessen abzudrehen, das Wasser laufen lassen, im Winter leicht bekleidet im Freien umherirren, jegliche Körperpflege ablehnen oder sich nur mehr von Brot ernähren, sehen sich Angehörige auch gegen den Willen der Betroffenen gezwungen einzugreifen. Die Rahmenbedingungen erschweren es in vielen Fällen, die Bedürfnisse der Betroffenen ausreichend zu berücksichtigen. Da keine permanente Beaufsichtigung möglich ist, werden potenziell gefährliche Gegenstände dauerhaft entfernt oder außer Betrieb gesetzt (Messer, Herd…), was die
Selbständigkeit weiter einschränkt. Zeigt die demenzkranke Person eine sogenannte "Weg10
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
lauftendenz", mag es sinnvoll erscheinen, sie in ihrer Wohnung oder gar einem Zimmer einzuschließen, während die Betreuungsperson etwa dringende Einkäufe erledigt. Versucht sie trotz
Gehunfähigkeit ständig, den Rollstuhl zu verlassen, was unweigerlich Stürze und Verletzungen
nach sich zieht, erscheint eine Fixierung oft als einzige sinnvolle Möglichkeit.
Während diese Thematik und mögliche Alternativen vor allem in Zusammenhang mit Fixierungsmaßnahmen und Medikamentengaben in Pflegeheimen intensiv diskutiert werden (vgl.
z.B. Walther 2007), sind Angehörige mit dieser Problematik oft alleingelassen. Die spezifischen Herausforderungen der Demenzerkrankung in Verbindung mit fehlendem Wissen, aber
auch fehlenden Ressourcen bedingen daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Grenze
zur Gewalt mitunter schon überschritten wird. Graß et al. (2007) weisen darauf hin, dass die
Grenzen zwischen angemessener Pflegetätigkeit und Grenzüberschreitung mitunter keineswegs klar definiert sind. Von den Autor/innen wird auch eingeräumt, dass in manchen Fällen
jegliche Handlungsweise der Pflegeperson – eine Intervention gleichermaßen wie eine Unterlassung derselben – als Gewalthandlung interpretiert werden kann:
"(Die) Darstellung von möglichen Gewalthandlungen in der Gegenüberstellung zu Pflegemaßnahmen (…) macht besonders deutlich, dass die Abgrenzung zwischen (noch) notwendiger
Hilfeleistung zur Schadensabwendung von einem Patienten und (schon) gewaltbehaftetem
Übergriff fließend und zuweilen nur schwer zu ziehen ist. Insbesondere die Bereiche der Mobilisierung und der Durchführung von Hygiene- sowie verordneter Therapiemaßnahmen sind
in diesem Zusammenhang bedeutsam. Das Verabreichen von Flüssigkeit, Nahrung oder Medikamenten oder die Mobilisierung hat in der Regel das Ziel, eine Verschlechterung des Gesundheitszustands zu verhindern. Doch sowohl das unangemessene Durchführen als auch
das Unterlassen solcher Maßnahmen wären als Pflegemängel zu rügen." (Graß et al. 2007:
367f.)
Eine massive Einschränkung der persönlichen Freiheit ist de facto auch mit der Wahl einer
Betreuungsform verbunden, wenn die erkrankte Person diese strikt ablehnt (z.B. Pflegeheim
oder 24h-Kraft). So empfinden viele Demenzkranke vor allem in einem früheren Stadium der
Krankheit insbesondere formelle Hilfsangebote oft als Affront. Diese Erfahrung machte auch
eine Angehörige, die in einem Internet-Forum von ihrem Vater berichtet:
"Mein Vater lehnt jede 'fremde' Unterstützung ab und hat die ambulante Pflege von der Caritas
recht 'aggressiv' und eindeutig aus dem Haus geschmissen. 'Ich melde mich, wenn ich etwas
brauche und ansonsten helfen mir die Nachbarn'. Hinterher zu mir: 'Die lasse ich hier nicht
mehr
rein'."
(www.deutsche-alzheimer.de/angehoerige/erfahrungen-von-angehoerigen/ueber-die-kur-ins-seniorenheim-erfahrungsbericht.html)
Der Ratschlag, den Graß et al. (2007) für Betroffene und pflegende Angehörige parat haben,
ist neben der Inanspruchnahme von Entlastungs- und Beratungsangeboten im Akutfall eine
Maßnahme der Primärprävention, nämlich die "ausführliche Beratung von Angehörigen und
Patienten, bevor (!) eine Pflegesituation eintritt" (ebd.: 369).
11
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
2.4
Diagnose und Therapie
Die Diagnose einer Demenzerkrankung erfolgt in der Regel durch niedergelassene Fachärzt/innen aus dem Bereich der Psychiatrie bzw. Neurologie sowie in spezialisierten stationären Einrichtungen und Abteilungen (z.B. Akutgeriatrie). Nicht zuletzt, um andere Ursachen für
die wahrgenommenen Veränderungen auszuschließen, gehen einer fundierten Diagnose im
Regelfall eine Reihe unterschiedlicher Untersuchungen voraus. Weyerer (2005) listet die folgenden bei der Demenzdiagnostik erforderlichen Maßnahmen auf:
Anamnese
Fremdanamnese (Befragung der Angehörigen)
Körperliche Untersuchung
Neurologische Untersuchung
Psychopathologischer Befund
Testpsychologische Untersuchung
Laborparameter
Elektrokardiogramm
Elektroenzephalogramm
Kraniales Computertomogramm oder Magnetresonanztomografie
Was die testpsychologische Untersuchung betrifft, werden Leistungstest wie der Mini-MentalStatus-Test (MMST) eingesetzt, der etwa Fragen zur zeitlichen ("Welche Jahreszeit haben
wir?") und zur örtlichen Orientierung ("Wo sind wir jetzt?") stellt oder verlangt, Zahlen rückwärts
aufzusagen. Auch der sogenannte Uhrentest, bei dem Betroffene aufgefordert werden, ein
vollständiges Ziffernblatt sowie eine bestimmte darauf angezeigte Uhrzeit einzuzeichnen,
kommt hier häufig zum Einsatz. Diese Verfahren erleichtern es, den Schweregrad der Demenz
festzustellen, d.h. in etwa einzugrenzen, ob es sich um eine leichte, mittelschwere oder
schwere Demenz handelt.
Leichte Demenzen sind dadurch gekennzeichnet, dass zwar kognitive Störungen die Bewältigung schwieriger Aufgaben erheblich einschränken, die Personen in ihrem Alltag aber noch
nicht dauerhaft die Unterstützung Dritter benötigen. Im mittelschweren Stadium ist die betroffene Person bereits auf ständige Beaufsichtigung und Begleitung im Alltag angewiesen.
Liegt eine schwere Demenz vor, benötigt der/die Erkrankte eine permanente grundpflegerische Versorgung und ist auch nicht mehr in der Lage, einfachste alltägliche Anforderungen zu
bewältigen (vgl. Weyer 2005).
Was die Behandlung der Demenzerkrankung betrifft, so lassen sich unterschiedliche Ansätze unterscheiden. So stellen etwa psychologische und soziale Interventionen wichtige Elemente dar, die als mindestens ebenso bedeutsam einzuschätzen sind wie die Verabreichung
im Fall der Demenz indizierter Medikamente.
Die medikamentöse Therapie setzt einerseits bei den kognitiven Symptomen, andererseits bei
den oft mit der Demenzerkrankung assoziierten nicht-kognitiven Störungen an. Für erstere
stehen sogenannte Antidementiva zur Verfügung, die den kognitiven Abbau in leichten bis
mittelschweren Fällen etwas verlangsamen können. Zur Therapie der nicht-kognitiven Störungen im Kontext der Demenzerkrankung, die das Erleben und Verhalten betreffen, können je
12
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
nach Störungsbild Antipsychotika, Antidepressiva oder Benzodiazepine zum Einsatz kommen
(vgl. Höfler et al. 2014).
Höfler et al. weisen im Österreichischen Demenzbericht (2014: 46ff.) auch auf die Bedeutung
nicht-medikamentöser, d.h. psychosozialer Intervention durch andere Gesundheitsberufe hin,
um die Lebensqualität der Betroffenen und deren betreuenden Angehörigen zu verbessern.
Konkret werden angeführt:
Ergotherapie
Diätologie
Logopädie
Orthoptik
Physiotherapie
Musiktherapie
Insbesondere bei beginnenden Demenzen sind auch psychologische Interventionen z.B. im
Sinne eines verhaltenstherapeutischen Kompetenztrainings sinnvoll (vgl. Erhardt & Platter
1999).
Auf der Beziehungs- und Kommunikationsebene setzt die Maßnahme der Validation an, die
darauf ausgerichtet ist, durch Verständnis und Akzeptanz die Lebensqualität der Betroffenen
– und damit rückwirkend auch der betreuenden Angehörigen – zu verbessern (vgl. Weyerer
2005). Diese Methode wurde ursprünglich von der amerikanischen Gerontologin Naomi Feil
entwickelt und stellt mittlerweile ein etabliertes Instrument in der Betreuung und Pflege demenzkranker Personen dar. Kennzeichnend für diese Herangehensweise ist ein wertschätzender und nicht wertender Umgang mit der Wahrnehmung und dem Verhalten der demenzkranken Person. Es wird beispielsweise darauf verzichtet, logische Ungereimtheiten richtigzustellen (z.B. 90-jährige Frau sucht ihre Mutter), stattdessen liegt der Fokus darauf, die dahinter
liegenden Bedürfnisse und Ängste zu erspüren und darauf einzugehen. Neu (2016) führt eine
Reihe von Faktoren auf, die kennzeichnend für validierendes Verhalten sind.
Betreuungspersonen…
…lernen desorientiertes Verhalten als Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen zu
entschlüsseln
…stellen sich empathisch auf ihr Gegenüber ein
…hören achtsam und aktiv zu
…bieten die Nähe an, die das Gegenüber braucht
…spiegeln Emotionen und Bedürfnisse auf der Basis von Empathie auch nonverbal
und mittels Musik
Auf einer weiteren Ebene setzen schließlich ökologische und soziale Interventionen an. Hier
ist zu allererst die unmittelbare materielle Umgebung für den/die Demenzkranke/n angesprochen, die seinen bzw. ihren Bedürfnissen gemäß gestaltet werden soll. So soll diese die Orientierung unterstützen, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, stimulierend sein, soziale Interaktionen ermöglichen, aber auch Rückzugsräume bieten (vgl. Weyer 2005: 18f.). Dieser
13
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Faktor ist vor allem auch dann von Bedeutung, wenn ein Umgebungswechsel (z.B. der Umzug
in ein Pflegeheim) stattfindet.
2.5
Demenz im Kontext Familie
Eine dementielle Erkrankung leitet nicht nur bei der betroffenen Person einen irreversiblen,
fortschreitenden Veränderungsprozess ein, sondern tangiert auch das Leben nahestehender
Menschen, insbesondere Familienangehöriger, in fundamentaler Weise. Nicht unbedingt in
erster Linie das Nachlassen des Gedächtnisses und das Schwinden von Erinnerungen, sondern vielmehr das veränderte Erleben und Verhalten des Partners, der Mutter, des Großvaters
können eine zuweilen unbewältigbar erscheinende Herausforderung darstellen. Während die
Realität für den erkrankten Angehörigen zunehmend in Auflösung begriffen ist, ist es für das
nicht dementiell beeinträchtigte familiäre Umfeld die Person selbst in ihrer Identität und Persönlichkeit, die sich gleichsam aufzulösen scheint und augenscheinlich immer weniger mit
dem Menschen zu tun hat, den man viele Jahre zu kannte. Neben den mit der Pflege und
Betreuung verbundenen faktischen – z.B. zeitlichen – Belastungen stellt sich für pflegende
Angehörige somit auch die Aufgabe, Abschied von einem geliebten Menschen, so, wie man
ihn gekannt hat, zu nehmen und gleichzeitig Vertrautheit und Nähe inmitten der zunehmenden
Fremdheit so gut wie möglich zu bewahren.
Innerfamiliale Pflege nimmt immer auch Einfluss auf das Beziehungsgefüge in der Familie und
bringt Veränderungen im Familiensystem mit sich. So beschreibt etwa Hamill (2012), dass es
auch für die Enkelkinder nicht ohne Auswirkungen bleibt, wenn die Eltern die Pflege für den
Großvater oder die Großmutter übernehmen. Möglicherweise wird von den Kindern nun mehr
Selbstständigkeit erwartet, vielleicht finden gemeinsame Unternehmungen von Eltern und
Kind/ern nun deutlich seltener statt, eventuell schlüpfen Enkelkinder auch in die Rolle von
Hilfs-Pflegepersonen, wenn sie etwa bei Abwesenheit der Eltern den demenzkranken Großelternteil beaufsichtigen. Rollen können sich umkehren: War es vor einigen Jahren noch die
Großmutter, die Verantwortung für das Enkelkind übernommen hat, ist es nun das Enkelkind,
das die Großmutter (mit)betreut.
Je nachdem, in welchem Verhältnis die an Demenz erkrankte und die pflegende bzw. betreuende Person zueinander stehen und in welchem familiären und sozialen Kontext (z.B. externe
Unterstützungsmöglichkeiten) die Situation eingebettet ist, können auch die individuellen Anforderungen variieren. So kommt die angesprochene Rollenumkehr sehr stark in Eltern-KindBeziehungen, wenn also das Kind einen Elternteil pflegt, zum Tragen. Ehepartner/innen fortgeschrittenen Alters wiederum sehen sich in die Lage versetzt, ihre Vorstellungen vom gemeinsamen Lebensabend über weite Strecken revidieren zu müssen.
Auch das Geschlecht der Personen, die Pflege- und Betreuungsaufgaben übernehmen, ist ein
Faktor, der zu berücksichtigen ist. So entsprechen die damit verbundenen Tätigkeiten einschließlich der Unterstützung bei der Haushaltsführung stärker dem traditionellen weiblichen
Rollenbild, und auch die gesellschaftlichen Erwartungen an Angehörige differieren, je nachdem, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.
In der Folge sollen verschiedene Pflegekonstellationen und die damit verbundenen Besonderheiten und Konsequenzen nun kurz beleuchtet werden.
14
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
2.5.1
Männer und Frauen als Pflegende
Die Angehörigenpflege ist ähnlich wie die Kinderbetreuung noch immer sehr stark weiblich
konnotiert. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass es sich bei rund vier Fünftel der betreuenden Familienmitglieder um Frauen handelt. Dosch (2018) weist in diesem Zusammenhang
jedoch darauf hin, dass sich die Prävalenzraten danach unterscheiden, welcher Pflegebegriff
zugrunde gelegt wird. Wird dieser weiter gefasst (indem zum Beispiel auch die Organisation
der Pflege einbezogen wird), so kann von einem Männeranteil von etwa einem Drittel ausgegangen werden (vgl. Langehennig 2012).
Verschiedene Studien belegen zudem, dass sich die Übernahme von Pflegeaufgaben im Lebensverlauf von Männern und Frauen unterschiedlich gestaltet. Rothgang et al. (2016) zeigen
für Deutschland anhand von SOEP-Daten6, dass die überwiegende Zahl der pflegenden
Frauen innerhalb der Altersspanne von 40 bis 74 Jahren anzutreffen ist, während Männer in
einem höheren Lebensalter (55 bis 85 Jahre) – überwiegend in der nachberuflichen Phase –
entsprechende Aufgaben übernehmen. Langehennig (2012) grenzt den Altersbereich, in dem
Pflege hauptsächlich stattfindet, bei Frauen auf 50 bis 55 Jahre und bei Männern auf 80+ ein.
Auf Basis dieser Daten erscheint es auch plausibel, dass Männer in erster Linie intragenerative
Pflege praktizieren, also hauptsächlich die Partnerin betreuen, während Frauen in erster Linie
intergenerative Pflege leisten, d.h. vor allem Eltern oder Schwiegereltern pflegen, und erst in
zweiter Linie im Kontext Partnerschaft Unterstützung bieten (vgl. Dosch 2018).
Da Frauen im Gegensatz zu Männern somit deutlich häufiger noch im erwerbsfähigen Alter
pflegen und zumeist auch intensiver in die Pflege involviert sind, sind sie stärker von sozialer
Ungleichheit betroffen und schlechter ökonomisch abgesichert als Männer. Eine vergleichende
Studie von Costa und Ranci (2010), die 15 EU-Mitgliedsstaaten umfasste, kommt zu dem
Schluss, dass ab einem Pflegeumfang im Ausmaß von 28 Stunden pro Woche (oder vier Stunden täglich) die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege nicht mehr möglich ist und infolgedessen eine Erwerbstätigkeit eingeschränkt oder aufgegeben werden muss.
Dosch (2018) hat die vergleichsweise kleine Gruppe der pflegenden Männer im erwerbsfähigen Alter herausgegriffen und konnte in ihrer empirischen Untersuchung mit insgesamt 30
männlichen Pflegepersonen vier unterschiedliche Typen identifizieren:
Typ 1: organisierende Pflegetätigkeit
Typ 2: supplementäre Pflegetätigkeit
Typ 3: prävalente Pflegetätigkeit
Typ 4: solitäre Pflegetätigkeit
Die vier Typen unterscheiden sich in Hinblick auf Aspekte wie Pflegeverhalten, Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen oder der Art der Delegation.
Männer vom Typ 1 – sie gehen alle einer Vollzeitbeschäftigung nach und weisen überwiegend
eine hohe Karriereorientierung auf – nehmen ausschließlich die organisatorischen Aspekte
der Pflege wahr, delegieren direkte pflegerische Tätigkeiten und auch hauswirtschaftliche Auf-
6
SOEP = sozioökonomisches Panel (repräsentative Wiederholungsbefragung in Deutschland).
15
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
gaben hingegen vollständig. Dazu werden insbesondere formelle Dienstleistungen zur ambulanten Versorgung, aber auch zum Beispiel Tagesbetreuungseinrichtungen in Anspruch genommen. Es finden jedoch regelmäßige Besuche zur Beziehungspflege statt. Im Gegensatz
zu den anderen Typen werden Beratungsangebote zum Beispiel von Fachkräften von Beratungsstellen und Pflegediensten stark genutzt. Das Internet spielt zur Informationsrecherche
ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese Gruppe ist nur in geringem Ausmaß bereit, das berufliche
und private Leben zugunsten der Pflegetätigkeit zurückzustellen.
Die größte Gruppe stellen Männer vom Typ 2. Diese delegieren ein bis mehrmals täglich körpernahe Pflegetätigkeiten zur Sicherstellung ihrer Berufstätigkeit (vorwiegend an formelle Anbieter), nehmen einen Teil dieser Aufgaben jedoch neben organisatorischen Tätigkeiten außerhalb der Erwerbszeiten wahr. Delegiert werden insbesondere ungewohnte oder unangenehme Pflegetätigkeiten (etwa Intimpflege), aber auch Haushaltstätigkeiten. Hier ist oft ein
höherer Pflegeaufwand gegeben, der neben der Erwerbstätigkeit nicht geleistet werden kann.
Beratungsleistungen werden seltener in Anspruch genommen und häufiger als nicht erforderlich, oder aber als unzureichend bzw. nicht passgenau eingeschätzt.
Bei der prävalenten Pflegetätigkeit (Typ 3) erfolgt eine Delegation von Aufgaben deutlich seltener, nämlich zweimal wöchentlich bis einmal monatlich. Ähnlich wie bei den anderen Typen
sind es wiederum ungewohnte und unangenehme Tätigkeiten und Aufgaben im Haushalt, die
vorwiegend delegiert werden. Der Pflegeaufwand ist hier oft noch geringer. Im Unterschied zu
Typ 1 und 2 werden neben formellen auch informelle Unterstützungsmöglichkeiten in nennenswertem Ausmaß in Anspruch genommen. Dabei geht es in erster Linie um Unterstützung
durch die eigene Partnerin (es handelt sich mit einer Ausnahme um pflegende Söhne). Beratungsangebote spielen für diese Gruppe nur eine sehr geringe Rolle.
Eine sehr kleine Gruppe gehört dem Typ 4 an (solitäre Pflegetätigkeit). Hier werden keinerlei
Aufgaben delegiert, sondern direkte und indirekte Pflegetätigkeiten eigenständig übernommen. Diese Personen richten ihr Leben völlig nach der Pflegetätigkeit aus.
Auffallend ist, dass von Männern unabhängig von der Typzuordnung geäußert wird, dass sie
sich in Angehörigengruppen aufgrund des hohen Frauenanteils und der "weiblichen Themenstellungen" nicht wohlfühlen.
In verschiedenen Untersuchungen wurde auch der Frage nach der (eventuell unterschiedlichen) Motivation von Männern und Frauen für die Übernahme von Pflegeaufgaben nachgegangen. Seidl (2007) geht davon aus, dass sich Männer eher zur Pflege verpflichtet fühlen,
während bei Frauen das selbstlose Handeln im Vordergrund steht. Zu dem genau entgegengesetzten Schluss kommt hingegen Franke (2006) in einer Studie zur Pflege eines/einer demenzkranken Ehepartner/in: Da Männer die Übernahme von Pflegeaufgaben eher ablehnen
können, ohne soziale Sanktionen befürchten zu müssen, beschreiben Frauen die Pflege eher
als Pflichtaufgabe, Männer hingegen pflegen nach eigenen Angaben eher "aus Liebe". Dies
gilt in Hinblick auf die Beziehungskonstellation bei Männern insbesondere für die Pflege der
Ehepartnerin. Während Frauen unabhängig von der Qualität der Beziehung aus einem Gefühl
der Verpflichtung heraus pflegen, stellt eine von Liebe geprägte Partnerschaft die Vorausset-
16
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
zung für die männliche Pflege dar. Auch die Studie von Langehennig (2012), in der 75 biografische Interviews mit (die Partnerin) pflegenden Männern geführt wurden, kommt zum selben
Ergebnis:
"Die Mehrzahl der Männer gibt zum Gesprächsbeginn sogar eine Art Grundsatzerklärung ab:
Allein die Liebe zur Ehefrau sei die feste Grundlage ihres Engagements. Wenn sie ihre Frau
nicht so lieben würden und wenn sie nicht eine so gute Ehe geführt hätten, würden sie die
Pflege nicht übernommen haben." (Langehennig 2012: 9)
Völlig anders gestaltet sich hingegen die Situation, wenn es sich bei der zu pflegenden Person
um einen Elternteil handelt. Nach Klott (2012) kommen Studien einhellig zu dem Schluss, dass
Söhne in erster Linie dann Pflegeaufgaben übernehmen, wenn keine weiblichen Familienmitglieder verfügbar sind. Zudem würden Söhne generell eher Aufgaben an formelle Dienste delegieren und sich eher sporadisch und intermittierend einbringen. In einer qualitativen Studie
mit 14 pflegenden Söhnen konnte Klott (2012) jedoch nur wenig Belege für diese Aussagen
finden. So teilten sich manche Söhne die Pflege mit der Partnerin, andere nahmen die Pflege
allein auf sich. Ebenso gingen die Aktivitäten der befragten Männer weit über sporadische
Tätigkeiten hinaus und bestanden in einigen Fällen in einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung.
Dosch (2018) ermittelte eine Palette an Motiven für die Pflegeübernahme für (Ehe-)Partner
und Söhne gleichermaßen. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
Abbildung 3: Motive von Männern für die Pflegeübernahme (Dosch 2018)
MOTIV
Reziprozität/Dankbarkeit
Liebe
Selbsterfahrung
KONKRETISIERUNG
etwas zurückgeben
langjährige positive Beziehung
Pflege als Entwicklungspotenzial
Angehöriger lässt keine fremde Hilfe
zu
aufgrund Vererbung von Besitz,
Vorsorgevollmacht, Eheversprechen
etc.
Ideal der Familie
Ethische und religiöse
Altruismus
Werte und Normen
Ethik des Helfens
christliche Überzeugungen
Verpflichtung
Finanzielle Gründe
Äußere Aspekte
formelle Betreuung nicht finanzierbar
zeitliche Kapazitäten
räumliche Nähe
erwachsene bzw. keine Kinder
alleinstehend
negative Erfahrungen mit Pflegeheimen o.ä.
gute (eigene) körperliche Verfassung
keine Geschwister, die eingebunden
werden könnten
Quelle: Dosch (2018): 281
17
PFLEGEPERSON
Söhne
Ehegatten und Söhne
Söhne
Söhne und Ehegatten
Söhne und Ehegatten
Söhne und Ehegatten
Ehegatten und Söhne
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Zuletzt sei noch auf die (möglicherweise) unterschiedlichen "Pflegestile" von Männern und
Frauen eingegangen, auf die in der Literatur wiederholt verwiesen wird. So spricht etwa Langehennig (2012) von der Beobachtung, dass die in seiner Studie befragten Männer dazu tendieren, ihr Pflegeengagement in einer Weise zu "gendern", dass es "einen maskulinen Anstrich" bekommt. Dies äußert sich insbesondere darin, dass sie die Pflegetätigkeit in einen
beruflichen Kontext rücken und mit Bildern und Begrifflichkeiten aus der Erwerbsarbeit illustrieren. Dabei betonen sie demonstrativ Kompetenzen und Interessen, die ihnen aus der Erwerbsarbeit vertraut sind und als "typisch männlich" gelten. Als Beispiele können hier Entwicklung und Einsatz technischer Hilfsmittel oder auch die akribische Planung und Dokumentation
von Abläufen angeführt werden.
Rosowski (2012) verweis darauf, dass Männer im Allgemeinen vor allem für körpernahe Pflegeaufgaben früher als Frauen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und der Gefahr der
Selbstausbeutung und Überforderung durch einen eher technisch-organisatorischen Umgang
mit der Pflegesituation eher vorbeugen. In der Folge fühlen sich Männer von der Pflege überwiegend weniger belastet als Frauen. Männer sind auch deutlich weniger als Frauen dazu
bereit, ihre Arbeitszeit aufgrund von Pflegetätigkeiten zu reduzieren oder die Erwerbstätigkeit
gar aufzugeben.
2.5.2
Demenz in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen
Wie eingangs erwähnt, prägt die Art der Beziehung, in der betreuende Angehörige zu der an
Demenz erkrankten Person stehen, die spezifischen Herausforderungen, die mit der Betreuung verknüpft sind, aber auch den Umgang mit der Betreuungssituation. So beschreibt die
Gerontologin Luitgard Franke (vgl. 2011), dass das partnerschaftliche Gleichgewicht, das auf
gegenseitige Unterstützung und Gleichberechtigung ausgerichtet ist, durch die Erkrankung
des/der Partner/in aus dem Gleichgewicht gerät. Die von Demenz betroffene Person spürt,
dass das Fundament des gemeinsamen Lebens ins Wanken gerät, was zu einer massiven
Verunsicherung führt. Gleichzeitig ist sie aufgrund der kognitiven Einschränkungen nicht mehr
zu einer reflektierten Auseinandersetzung in der Lage, was zu Konflikten, ungerechtfertigten
Vorwürden und Ähnlichem führen kann. Bisherige Vertrautheit und Intimität in der Partnerschaft sind stark von der Erkrankung beeinflusst, da die kognitiven Defizite auch mit einer
nachlassenden Fähigkeit, auf die Bedürfnisse und Emotionen des Gegenübers einzugehen,
einhergehen. So nehmen Gesten der Zuneigung und Zärtlichkeit mit der Zeit häufig ab und es
kommt oft zu einem Nachlassen des sexuellen Interesses des Erkrankten (selten zu einer
Steigerung) (vgl. Wright 1998). Auch Medikamente können hier eine Rolle spielen.
Nach Franke (2011) erlebt der/die gesunde Partner/in einen stetigen Wechsel von fremden
und vertrauten Elementen, die die Persönlichkeit des/der Kranken sowie die Beziehung kennzeichnen:
"Die Paarbeziehung verändert sich mit der Demenz also einerseits drastisch, andererseits
bleibt sie aber auch ganz vertraut. Die Beziehung ist gewissermaßen 'auf der Kippe', sie kippt
hin und her – zwischen der mit dem Fortschreiten der Demenz immer notwendiger werdenden
Pflegebeziehung auf der einen Seite und der vertrauten Ehebeziehung auf der anderen Seite."
(Franke 2011: 2)
Dennoch sind von Demenz betroffene Paarbeziehungen auch von einer gewissen Kontinuität
geprägt, die eine wichtige Ressource darstellen kann. Nach Conde-Sala et al. (2010) erleben
18
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Partner/innen die Wahrnehmung von Pflegeaufgaben über weite Strecken als Teil ihrer ehelichen bzw. partnerschaftlichen Pflichten, die ihnen im Prinzip vertraut ist. Sie haben auch in
vielen Fällen die Möglichkeit, nach und nach in ihre Aufgabe hineinzuwachsen und sich an die
sich verändernden Bedingungen allmählich anzupassen.
Im Gegensatz zu pflegenden Partner/innen ist der Alltag von Töchtern und Söhnen und ihren
Eltern zumeist nicht in ähnlicher Weise miteinander verwoben, sondern die Kinder führen in
der Regel ein von den Eltern über weite Strecken unabhängiges Leben. Die Übernahme von
Pflegeverantwortung kollidiert somit auch wesentlich häufiger mit der eigenen Lebensplanung
und Lebensgestaltung. So ist die Pflegeaufgabe in vielen Fällen nicht nur mit einer Erwerbstätigkeit in Einklang zu bringen, sondern auch mit den Ansprüchen und Bedürfnissen einer
eigenen Gründungsfamilie.
Im Zusammenhang mit der Pflege erkrankter Eltern durch ihre Kinder fällt häufig der Begriff
der "filialen Reife". Dieses Konzept beschreibt eine Entwicklungsstufe, in dem sich eine Person
aus der Kind-Perspektive löst und einen fürsorglichen Blick auf die eigenen Eltern einnehmen
kann. Filiale Reife umfasst drei Aspekte (vgl. Ecarius 2007, nach Bruder 1988):
emotionale Autonomie von den Eltern,
die Fähigkeit zu einem fürsorglich-autoritären Umgang zu kommen, vor allem mit dement eingeschränkten alten Menschen,
eine Kontrollfähigkeit unangemessener Schuldgefühle.
Filiale Reife erfordert die Erkenntnis, dass eine Rollenumkehr stattgefunden hat und es nun
die Eltern sind, die auf Unterstützung und Fürsorge angewiesen sind, wie man es selbst in der
Lebensphase der Kindheit und Jugend war.
Einige Publikationen widmen sich auch der Enkelgeneration, die heutzutage ebenfalls in nennenswertem Ausmaß von der Situation betroffen sein kann, indem ein Großelternteil an Demenz erkrankt und auf umfassende Unterstützung angewiesen ist. So beschreibt beispielsweise Celdrán (2014), dass in diesen Fällen zumeist ebenfalls ein Rollenwechsel stattfindet,
der mit einer veränderten Großeltern-Enkel-Beziehung einhergeht. Nach ihren positivsten Erinnerungen an die Großmutter oder den Großvater befragt, berichten die Kinder davon, gemeinsam Spaß gehabt zu haben und von Oma oder Opa liebevoll betreut worden zu sein.
Gleichzeitig ist Kindern der Großelternteil als "familiäres Wissensreservoir" in Erinnerung.
Diese Funktionen vermag der oder die erkrankte Angehörige nur mehr in sehr eingeschränktem Maße zu erfüllen. Die Enkelkinder erleben, dass die Initiative für gemeinsame Erlebnisse
mehr und mehr von ihnen selbst ausgehen muss, dass Oma oder Opa nun selbst einer Betreuung bedarf und sie es sind, die den Großeltern die Welt erklären müssen.
Im vierten deutschen Familienbericht (BMFSFJ 2002) wird darauf hingewiesen, dass heranwachsende Kinder und Jugendliche insbesondere für ihre Mutter, wenn sie Pflegeverantwortung für einen Eltern- oder Schwiegerelternteil trägt, eine praktische und emotionale Entlastung darstellen. Inwieweit die (Enkel-)Kinder dabei in konkrete Pflegetätigkeiten einbezogen
werden, wird unterschiedlich rezipiert. Während laut dem deutschen Familienbericht (2002)
die Kinder eher wenige praktische Aufgaben übernehmen (müssen), berichteten in einer Studie von Hamill (2012) zwei Drittel der Jugendlichen, ihre Großeltern bei täglichen Aktivitäten
19
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
wie einkaufen, Essenszubereitung, Hausarbeiten oder beim Essen zu unterstützen. In einer
anderen Untersuchung (Szinovacz 2003) wird auch das Aufpassen auf den dementen Großelternteil – als "grandma sitting" bezeichnet – als häufige Tätigkeit angeführt, für die Enkelkinder im Jugendalter herangezogen werden, damit die Hauptbetreuungspersonen zum Beispiel
Einkäufe erledigen oder wichtige Termine wahrnehmen können.
Belastet sind Kinder und Jugendliche mit einem dementen Großelternteil aber nicht unbedingt
in erster Linie durch die eigene Pflegetätigkeit, sondern auch durch Auswirkungen der Pflegesituation auf das Familienleben an sich. So werden etwa folgende mögliche Konsequenzen
angeführt, die sehr stark auch die Kinder und Jugendlichen betreffen (vgl. z.B. Barkholdt &
Lasch 2004, Philipp-Metzen 2008):
Einschränkung gemeinsamer Freizeit- und Urlaubsaktivitäten,
Einschränkung sozialer Kontakte, insbesondere Besuche von Freund/innen,
Beeinträchtigung der Nachtruhe aller Familienmitglieder durch nächtliches Umherwandern der dementen Person,
Einschränkung der Aufmerksamkeit, Zuwendung und Unterstützung für andere Familienmitglieder, da die demente Person alle Ressourcen bindet,
Verzicht auf neue Anschaffungen aufgrund der finanziellen Belastung durch die
Pflege,
Übertragung von pflegebedingtem Stress und Überforderung auf andere Familienmitglieder,
Streitigkeiten der Eltern aufgrund der pflegebedingten permanenten Belastungssituation.
Dennoch resultiert aus einem familialen Pflegesetting keinesfalls per se eine hochproblematische Lebenssituation für involvierte Kinder und Jugendliche. Celdrán et al. (2009) konnten den
Nachweis erbringen, dass das Aufwachsen mit einem an Demenz erkrankten Großelternteil
auch einen förderlichen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen Kinder und
Jugendlichen nehmen kann, indem die Erkrankung etwa eine vertiefte Selbstreflexion oder
auch eine Schulung der Empathie mit sich bringt. In diesem Sinne können durch die Auseinandersetzung mit einem dementen Großelternteil Entwicklungsprozesse angestoßen werden, wie sie generell bei der Konfrontation mit kritischen Lebensereignissen, die eine Anpassung und (zumindest partielle) Neuorientierung notwendig machen, in Erscheinung treten:
"Taken together, our results point out that having a grandparent with dementia might lead to
a deeper reflection on life, new personal resources, as empathy or sense of responsibility,
enhance family ties or develop a variety of scoping skills, all of which appear in either the
literature on posttraumatic growth or stress-related growth.” (Celdrán et al. 2009: 256)
In einer Studie von Beach (1997) konnte weiters gezeigt werden, dass sich die Beziehung der
betroffenen Jugendlichen zur Hauptpflegeperson – im Allgemeinen der Mutter – positiv entwickelt und Verständnis und Empathie für alte Menschen gewachsen waren. Auch hatte die Pflegesituation in manchen Fällen Geschwister einander näher gebracht.
20
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
3 Einleitung empirischer Teil
Die vorliegende Studie konzentriert sich auf Personen, die eine/n Familienangehörige/n pflegen, die/der an Demenz erkrankt ist. Sie soll Aufschluss darüber geben, wie pflegende Familienangehörige ihre Situation erleben, vor welchen Herausforderungen sie stehen, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Unterschiede es möglicherweise in den verschiedenen Familien und Familienkonstellationen gibt. So haben wir Frauen und Männer verschiedener Altersgruppen gefragt, die ihren Partner bzw. ihre Partnerin oder einen Eltern- bzw.
Schwiegerelternteil pflegen. In einem Fall wurde die Enkeltochter interviewt.
3.1
Methode und Soziodemografie
Die Studie erhebt das subjektive Erleben und die ausführliche "Sicht der Dinge" der pflegenden
Angehörigen in besonderer Tiefe. Sie hat deshalb ein qualitatives Methodendesign. Die Erhebung der Daten fand mittels teilstrukturierter Leitfadeninterviews statt. Es wurden Interviews mit Familienangehörigen von Demenzpatient/innen geführt, welche die/den Angehörige(n) allein oder mit anderweitiger Unterstützung pflegen. Auch wurden Personen miteinbezogen, deren an Demenz erkrankte/r Angehörige/r mittlerweile in einem Pflegeheim lebt –
denn auch in diesem Fall trägt man normalerweise weiterhin eine gewisse Verantwortung und
wird im täglichen Leben von dieser Situation begleitet.
Folgende forschungsleitende Fragestellungen standen im Zentrum:
Wie gestaltet sich die Pflege bzw. wie organisieren pflegende Angehörige die Pflege
zu Hause bzw. stationär?
Mit welchen Herausforderungen sehen sich pflegende Angehörige in ihrem alltäglichen Leben konfrontiert? (Inwiefern) haben sich diese Herausforderungen im Laufe der
Zeit verändert?
Wie nehmen pflegende Familienangehörige ihre eigene Situation und die der gepflegten Person wahr? Von welchen Emotionen ist diese Wahrnehmung begleitet, wie
wirken sich diesbezüglich Veränderungen in der Betreuungssituation aus (z.B. Übersiedelung in ein Pflegeheim)?
Unter welchen Voraussetzungen ist die Übernahme der Pflege erfolgt, welche Umstände und Überlegungen haben zu der Entscheidung geführt, Unterstützungsangebote anzunehmen oder aber auch abzulehnen und welche Tätigkeiten wurden und
werden aus welchen Gründen vorzugsweise delegiert bzw. selbst übernommen?
Welche persönlichen Gründe und familialen Konstellationen sind ausschlaggebend für Entscheidungen in Zusammenhang mit der Pflege?
Wie lassen sich Pflege und andere Lebensbereiche aus Sicht pflegender Angehöriger vereinbaren?
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld der Angehörigen?
Welche Herausforderungen und Wünsche gibt es auf struktureller Ebene, z.B. was
das Pflegesystem oder die finanzielle Situation betrifft?
Diese Fragestellungen waren die Grundlagen für den Leitfaden, der das Gespräch strukturierte, aber gleichzeitig Raum ließ für neue Themen, die den Betroffenen wichtig waren. Alle
Gespräche wurden digital aufgezeichnet und später wörtlich transkribiert. Feldnotizen ergänzen das Material.
21
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Insgesamt konnten 17 Personen interviewt werden. Eine Interviewreise ermöglichte, dass wir
Personen in verschiedenen Regionen Österreichs befragen konnten. Sie fanden größtenteils
persönlich (Face-to-face) statt, nur vereinzelt per Telefon und wurden zwischen Jänner und
Mai 2018 geführt. Sie dauerten zwischen 33 Minuten und knapp zwei Stunden, im Mittel 72
Minuten.
Die Auswertung und Analyse der wörtlich transkribierten Interviews wurde als themenbasierte
Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Entwicklung des Kategoriensystems und die Zuordnung der
Codes und Subcodes wurden unter Zuhilfenahme der Software maxqda vorgenommen. Darunter ist zu verstehen, dass alle transkribierten Interviews auf die in den forschungsleitenden
Fragestellungen enthaltenen Themen sowie weiteren dominanten Themen durchsucht, deren
manifeste und latente Inhalte miteinander verglichen und darauf aufbauend ein themenbasiertes System entwickelt wurde, das es erlaubt, die Vielfalt der Erfahrungen, Einstellungen und
deren Interpretation sinnhaft geordnet darzustellen.
An der Interview-Studie haben 17 Personen teilgenommen (fortan auch "Erzählpersonen"),
davon 12 Frauen und fünf Männer. Sie wohnen in unterschiedlichen österreichischen Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten), teils in größeren Städten, teils in (sehr)
ländlicher Gegend. Sie entstammen unterschiedlichen Bildungsmilieus und repräsentieren Alltagswirklichkeiten vom großstädtischen Single-Haushalt bis zum bäuerlichen Familienhaushalt. Ebenso gibt es eine große Altersstreuung: Die jüngste Interviewpartnerin ist 17 Jahre, der
älteste Interviewpartner 85 Jahre alt. Bei den an Demenz erkrankten Personen handelt es sich
je nach Fall um: die Mutter, den Vater, die Großmutter, den Partner bzw. die Partnerin, die
Schwiegermutter oder den Schwiegervater. Die erkrankten Familienangehörigen sind unterschiedlich eingeschränkt. Manche von ihnen bewältigen ihren Alltag noch hauptsächlich alleine, bekommen teilweise Unterstützung von mobilen Diensten, andere leben mit ihren Familienangehörigen in einem Haushalt oder mit einer 24-Stunden-Betreuung, oder sie leben mittlerweile in einem Pflegeheim.
An der Studie haben außerdem drei Personen teilgenommen, deren Familienangehörige/r bereits verstorben ist, in zwei Fällen war das erst kürzlich, im dritten Fall (wo dies schon ein paar
Jahre her war) wollten wir die Erzählperson gerne einbeziehen, weil sie als im Haushalt lebende jugendliche Tochter eines demenzkranken Vater aus einer Perspektive erzählen
konnte, auf die wir in der Studie nicht verzichten wollten, nachdem sie sich bei uns gemeldet
hatte.
22
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Abbildung 4: Überblick über die Interviewpartner/innen
INTERVIEWPARTNER/IN
Nr.
Pseudonym
WER WIRD GEPFLEGT?
Alter
Beziehung
Alter
Pflegestufe
Wohnsituation
01
Lisa
46
Schwiegermutter
95
4
Pflegeheim
02
Elisabeth
45
Mutter
77
2
Mit Sohn im Haus
03
Cornelia
17
Großmutter
83
4
Mit Sohn, Schwiegertochter, Enkelin im Haus, 24h-Pflege
04
Annemarie
61
Schwiegermutter
(94)✝
7
05
Anton
47
Vater
77
6
Mit 24h-Pflege
06
Lena
34
Vater
75
keine
Alleine
07
Gregor
57
Vater
91
3
Mit Sohn, Schwiegertochter, Enkelsohn im Haus
08
Marie
37
Vater
(87)✝
6-7
09
Gitti
50
Schwiegervater
96
4 (6)
Mit Sohn, Schwiegertochter
10
Zita
43
Mutter
80
1-28
Mit Partner, Sohn, Schwiegertochter
11
Annika
59
Mutter
84
5
Mit 24h-Pflege
12
Curt
85
Partnerin
82
1
Mit Partner, 24h-Pflege
13
Patrizia
72
Partner
91
4
Pflegeheim
14
Arnold
79
Partnerin
(79)✝
7
Mit Partner, 24h-Pflege
15
Theresa
41
Partner
49
1
Mit Partnerin, Mutter, drei Kindern
16
Felix
66
Partnerin
60
6
Pflegeheim
17
Sissi
73
Partner
83
6
Mit Partnerin, 24h-Pflege
Quelle: ÖIF 2018;
✝die
Mit Sohn und Schwiegertochter
im Haus
Mit Partnerin und anfangs Tochter
7
Person ist bereits (im angeführten Lebensjahr) verstorben.
Wenn die Analyseergebnisse vorgestellt werden, geschieht dies in anonymisierter Form: Die
Interviewzitate werden nach Laufnummer der Interviewpartner/in (z.B. Int. 04) und nach Fundstelle im Interview (z.B. 33 für "Absatz 33") zitiert. Die Zeilennummerierung nach Absätzen
wurde direkt aus der Analyse-Software maxqda übernommen. Die Quellenangabe (1. Int. 04:
33) heißt also, dass hier die Interviewpartnerin Nr. 4 zitiert wurde, Fundstelle ist der Absatz Nr.
33.
7
8
Die Pflegestufe wurde kürzlich heruntergesetzt, man verhandelt noch.
Sie ist sich nicht sicher, ob es Pflegestufe 1 oder 2 ist.
23
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
3.2
Kurzbiografien
Die nun folgenden Kurzbiografien geben einen ersten Einblick in die aktuelle Lebenssituation
der pflegenden Angehörigen. Sie zeigen die Vielfalt der Lebensumstände, in denen sich die
Interviewpartner/innen befinden und die freilich stark damit zusammenhängen, in welchem
verwandtschaftlichen Verhältnis die zu pflegende Person steht und wie weit die Krankheit fortgeschritten ist.
Um die Anonymität der Teilnehmenden zu wahren, wurden ganz konkrete biografische oder
soziodemografische Daten weggelassen.
01 Lisa
Lisa ist eine promovierte Akademikerin, berufstätig, Mitte 40, verheiratet und hat zwei Kinder
im Teenager-Alter. Sie lebt mit ihrer Familie in einem ländlichen Gebiet im Osten Österreichs.
Bis vor kurzem hat die 95-jährige Schwiegermutter bei ihnen im Haus gewohnt, erst seit ein
paar Monaten ist sie in ein Heim übersiedelt, nachdem die Situation nicht mehr tragbar war.
Seit der ersten Demenz-Diagnose Anfang der 2000er Jahre ist sie mittlerweile schwer dement,
die letzten 15 Jahre seien "extrem anstrengend" gewesen, weil die Schwiegermutter irrationale
Ängste hatte und deshalb täglich bestimmte Rituale einforderte (z.B. allabendliches mehrfaches Ausstecken aller Stromstecker, Reinigen der Küche vor gefährlichen Tieren). Lisa berichtet mitunter humorvoll über diese teilweise bizarren Situationen im Alltag, ist aber gleichzeitig "ständig genervt" gewesen. Sie fühle sich ihrem Partner seit dieser Zeit "mehr verbunden", denn man habe die Situation gemeinsam gemeistert. Beide sind berufstätig, deshalb
stellte sich die Frage der Beaufsichtigung in ihrer Abwesenheit. Sie bekamen Unterstützung
durch eine NGO, eine Freundin der Familie und eine Rumänin, die Putz- und Aufsichtsdienste
übernahmen, während Lisa (Teilzeit) gearbeitet hat. Doch aus den "nervigen" Situationen wurden "gefährliche" Situationen und schließlich sei die Schwiegermutter auch neben ihnen "vereinsamt", sagt Lisa: "Eigentlich war der Aufwand rundherum so derartig groß, dass man sich
nicht einfach nur zu ihr setzt und sich so mit ihr beschäftigt, weil dafür einfach überhaupt keine
Kapazitäten mehr da waren". Eine Verletzung, die einen Spitalsaufenthalt nach sich zog, nahmen sie schließlich zum Anlass, der Schwiegermutter zu erläutern, dass sie nun nicht mehr im
Haus leben könnte. Mit dem Heim sind sie "absolut zufrieden", der Schwiegermutter gefalle es
gut dort. Für Lisa ist die neue Situation sehr befreiend, eine "neue Ära" sei angebrochen: "Ich
kann fünf Stunden wegbleiben und nicht nur zwei. Ja, das ist (lacht) – also das ist eine Lebensqualität, die ist unglaublich. Super."
02 Elisabeth
Elisabeth ist eine Mittvierzigerin, geht einer selbstständigen Tätigkeit nach und lebt allein. Ihre
77-jährige Mutter ist vor einem Jahr sehr plötzlich an einer Demenz erkrankt. Sie lebt in einer
Bergregion weit weg von ihrer Tochter, aber in unmittelbarer Nähe zu ihren beiden Söhnen,
einer davon wohnt seit ein paar Jahren im selben Haus, seitdem er selbst nach einem Unfall
gesundheitlich eingeschränkt ist. Die beiden Brüder sind untereinander wegen einer "Erbschaftsgeschichte" zerstritten, das Familienklima leide darunter. Elisabeths Eltern sind seit vielen Jahren getrennt, es gibt keinen Kontakt zum Vater. Obwohl Elisabeth weiter von der Mutter
entfernt wohnt als ihre beiden Brüder, übernimmt sie hauptsächlich die Organisation der Pflege
(Mobile Hilfe, Beantragung der Pflegestufe, Bankgeschäfte), fährt einmal pro Monat in die
24
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Bergregion und wünscht sich insgesamt mehr Unterstützung und Eigeninitiative von ihren beiden Brüdern. Viele Dinge würden erst "auf Ansage" von ihr geschehen. Für sie selbst bedeutet
ihr großer zeitlicher Einsatz berufliche wie private Entbehrungen: Sie spricht vom Verlust von
Kunden und dass "gewisse Pläne" seit der Krankheit ihrer Mutter nicht mehr verwirklicht werden konnten, Urlaubspläne genauso wenig wie der Wunsch, einen Partner zu finden und eine
Familie zu gründen. Eine große Zuneigung gegenüber ihrer Mutter wird deutlich. Früher hatte
Elisabeth ein enges Verhältnis zu ihr, sie hätten oft telefoniert. Jetzt vermisst sie sie als Vertrauensperson und Gesprächspartnerin und ist traurig über den Verlust ("da ist eben jetzt so
ein ganzes Stück quasi weggebrochen von meiner Mama"), wobei sie betont, dass sie auf der
Gefühlsebene noch einen guten Kontakt zu ihr hat. Ihre Mutter würde genau merken, wer ehrlich zu ihr ist und es sei wichtig, dass man ihre Mutter ernst nimmt und nicht "als Alte abstempelt".
03 Cornelia
Cornelia ist Maturantin und lebt mit ihren Eltern und ihrer 83-jährigen pflegebedürftigen Oma
väterlicherseits in ländlicher Gegend. Sie und ihre Eltern bewohnen das Erdgeschoss, im ersten Stock lebt die Oma, mittlerweile mit einer 24-Stunden-Betreuung. Ihre Demenz ist offenbar
Folge einer Reihe schwerer, zum Teil lebensbedrohlicher Erkrankungen (u.a. Schlaganfall)
und begann vor etwa sechs Jahren. Während die Demenz noch nicht sehr stark ausgeprägt
ist (es ist vor allem das Kurzzeitgedächtnis betroffen), ist sie körperlich stark eingeschränkt
und mittlerweile bettlägerig. Cornelia ist mit der Oma im Haus aufgewachsen, ihre Gefühle ihr
gegenüber sind dabei ambivalent: "Die Oma war, glaube ich, nie irgendwie der beste Mensch",
sagt sie, betont aber auch, dass sie ein Schmuckstück von ihr trägt, das ihr sehr wichtig ist.
Während Cornelia und ihre Mutter die Situation eher pragmatisch sehen ("ich habe mich an
die Situation einfach gewöhnt"), leidet ihr Vater umso mehr. Cornelia versucht sich gegenüber
der Situation abzugrenzen und möchte z.B. nicht in die Planung hinsichtlich zukünftig notwendiger Pflege einbezogen werden. Seitens des Vaters bringt ihr dieses Verhalten den Vorwurf
ein, "herzlos" zu sein. Er fordert sie immer wieder auf, mit seiner Mutter Zeit zu verbringen.
Cornelia tut dies auch, sieht aber keinen großen Sinn darin, weil man sowieso nur gemeinsam
fernsieht und die Oma ihre Anwesenheit nach kurzer Zeit wieder vergessen hat. Dieses zunehmende Vergessen ist es auch, was ihr dann doch Sorgen bereitet: "Das Einzige ist, wo ich
mir manchmal Sorgen mache, dass, wenn ich zu lange weg bin, dass sie sich vielleicht nicht
mehr erinnern könnte."
04 Annemarie
Annemarie ist Anfang 60, hat drei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann auf einem
Bauernhof. Sie hat sowohl als Bäuerin als auch im medizinischen Bereich gearbeitet und ist
mittlerweile pensioniert. Im gemeinsamen Haus lebte bis vor wenigen Wochen ihre Schwiegermutter, die sie mit Unterstützung durch eine Hauskrankenpflege und weiteren informellen
Hilfen hauptverantwortlich gepflegt hat. Sie hatte zuletzt nicht mehr geredet. Die Demenz
wurde bereits im Jahr 2000 diagnostiziert, Anfang 2018 ist sie in ihrem 95. Lebensjahr verstorben. Ihr Partner war vier Jahre früher gestorben und hatte sie bis dahin im Alltag unterstützt.
Deutlich wird in dem Interview, dass die Familie – und besonders Schwiegertochter Annemarie
– sich sehr engagiert hat, um "die Oma" zu Hause zu pflegen, obwohl sie bereits die höchste
Pflegestufe hatte und ein hoher Pflegeaufwand damit verbunden war. Annemarie berichtet
sehr positiv und liebevoll von ihr, es sei "selbstverständlich" gewesen, dass man sich ihrer
25
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
angenommen habe, vor allem auch, weil die Großeltern früher die Kinderbetreuung übernommen hatten. Seit knapp 40 Jahren leben sie bereits unter einem Dach: "Es war immer so ein
gegenseitiges Geben und Nehmen. Sie haben für uns was gemacht und wir für die Eltern. Und
das hat sich halt dann immer gesteigert." Schwierig sei gewesen, dass "immer jemand da sein
musste". Negativ erlebt hat sie ebenfalls, dass es im Umfeld Stimmen gab, die sie dafür kritisierten, dass die Schwiegermutter zu Hause gepflegt wurde ("warum tust du dir das an?") –
sogar mit dem Vorwurf, das "Pflegegeld abzukassieren". Positiv erlebt hat sie, dass die
Schwiegermutter "so lieb und sanft" geworden sei in ihrer Demenz. Außerdem hat sie eine
Ausbildung im Bereich der so genannten Validation für Angehörige von Menschen mit Demenz
absolviert. Diese hat zum Ziel, Menschen mit Demenz besser zu verstehen und die Kommunikation mit ihnen zu erleichtern.
05 Anton
Anton ist Mitte 40, arbeitet als Angestellter, lebt als Single in einer Großstadt und hat einen
77-jährigen an Demenz erkrankten Vater. Bereits im Jahr 2000 waren bei seinem Vater geistige Einbußen erkennbar, die mit einem geplatzten Aneurysma und damit verbundener Gehirnblutung begannen. Sein Vater wurde frühpensioniert und hat mittlerweile Pflegestufe 6. Er
wohnt in einem eigenen Haus in einem Ort, der nur zwei Kilometer von Anton entfernt ist.
Seine Frau ist 2014 verstorben. Sie wollte mit ihm gern ins Altersheim übersiedeln, auch, weil
sie sich dort Ansprache erhoffte, die sie bei ihrem dementen Mann nicht mehr finden konnte.
Ihr Mann wollte aber nicht. Als sie starb, brauchte man eine Unterstützung für ihn, Anton organisierte eine 24h-Betreuung: Zwei Rumäninnen, die miteinander verwandt sind und abwechselnd bei ihm wohnen. Sowohl der Vater als auch Anton mögen die beiden sehr, das Verhältnis
erscheint familienähnlich, zum Beispiel, weil die beiden in den Sommerferien auch schon mal
ihre Kinder mitgebracht haben. "Lustig" habe man es zusammen gehabt, sagt Anton. Er hat
einen – wie er selbst sagt – "innigen" Kontakt zu seinem Vater, das sei schon immer so gewesen, nur würden sich jetzt die Rollen umkehren. Er besucht ihn regelmäßig, sorgt liebevoll für
ihn und unternimmt regelmäßig Ausflüge mit ihm. Letzteres war lange Zeit schwierig, weil sein
Vater wegen eines Prostata-Leidens inkontinent war und ständigen Harndrang hatte. Das sei
das "Hauptproblem" der letzten Jahre gewesen, eine "große Doppelbelastung". Kürzlich ist er
operiert worden und das Problem ist nun beseitigt. "Uns geht es wirklich gut", betont Anton,
vor allem jetzt, da die Operation vorbei ist und sein Vater nicht mehr inkontinent ist. Er freut
sich auf den Sommer und auf die Ausflüge, die sie gemeinsam miteinander unternehmen werden. Er hätte "Glück, (er) habe keine eigene Familie" und könne deswegen dem Vater viel Zeit
widmen – mehr als seine Schwester, die eigene Kinder hat. Sie übernimmt vor allem den organisatorischen Teil der Pflege, zum Beispiel die Behördenwege. Die beiden Geschwister verstehen sich gut.
06 Lena
Lena ist Mitte 30, hat ein Studium abgeschlossen und lebt in einer österreichischen Großstadt
in einer gemeinsamen Wohnung mit ihrem Freund. Momentan ist sie ohne Arbeit. Ihr Vater ist
75 Jahre alt und lebt in einer Kleinstadt in Deutschland, ihrem Herkunftsland. Er ist seit etwa
vier Jahren an Demenz erkrankt, seit einem Schlaganfall ging es ihm zunehmend schlechter.
Allerdings kann er sich noch selbst versorgen und wohnt weiterhin allein. Er und Lenas Mutter
sind seit Kindheitstagen von Lena getrennt und haben keinerlei Kontakt. Ihr Vater war "lange
Zeit" inhaftiert gewesen, sie hat ihn erst mit 16 Jahren kennen gelernt. Lenas Beziehung zu
ihrem Vater ist schwierig. Nachdem sie ihn nach dem Schlaganfall täglich versorgte, konnte
26
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
sie seine zunehmende Aggressivität nicht mehr ertragen. Da ohnehin ein Umzug mit ihrem
Freund nach Österreich anstand, hat sie den Umzug als "Ausrede" genutzt, sich von ihrem
Vater zu entfernen. Aktuell telefonieren sie nur noch, etwa "ein, zweimal im Monat" – er ruft
sie an. Sie betont, dass die Beziehung nicht erst seit der Demenz schwierig ist. Vielmehr habe
seine aggressive Art zu Beginn der Krankheit das ohnehin schwierige Verhältnis noch zusätzlich beeinträchtigt ("in Verbindung mit der Vergangenheit war die aggressive Art von ihm nicht
gut für mich"). Nichtsdestotrotz hat Lena mitunter ein schlechtes Gewissen, dass sie sich nicht
mehr um ihren Vater kümmert, zumal er zu ihr sagt, sie sei die einzige Person, die er noch
habe. Ihr Partner hingegen zeigt "Unverständnis, dass (sie sich) überhaupt noch kümmere
nach der Vorgeschichte." Ihr Vater hätte zwar "jetzt niemanden, der ihm so wirklich näher
steht", aber er sei Einsamkeit gewöhnt, das liege auch in seiner Art. Positiv empfindet sie, dass
er in der Kleinstadt "wirklich toll sozial eingebunden" sei; man gibt ihm kleine Jobs, damit er
nicht so alleine ist, auch die Nachbarschaft kümmert sich etwas um ihn. Das beruhigt sie.
07 Gregor
Gregor ist Mitte 50 und arbeitet als Angestellter im Schichtdienst. Er lebt gemeinsam mit seiner
Frau, dem erwachsenen Sohn und dem pflegebedürftigen Vater im selben Haus in ländlicher
Gegend. Gleich beide Eltern sind an Demenz erkrankt: Seine Mutter ist erst im letzten Jahr
gestorben, nun wird auch sein 91-jähriger Vater zunehmend dement. Er hat die Pflegestufe
drei. Er sei "schon ein bisschen dement", aber lebe noch im eigenen Haushalt. Es sei "halt
zum Schauen immer". Die Unterstützung des Vaters geschieht im Familienverband, so wie
vorher bei Gregors Mutter auch: Seine Frau übernimmt große Teile (sie ist im Pflegebereich
erwerbstätig), ebenso er, der Sohn und Gregors Schwester, die in unmittelbarer Nähe wohnt.
Zu ihr hat der Vater eine besondere Beziehung, sie sei seine "Lieblingstochter". Andere Hilfen
lehnt der Vater ab (mobiler Dienst, Essen auf Rädern), das belastet Gregor. Seine Mutter hatte
diese Hilfen angenommen. Gregor vermutet, dass es zwei Stufen gebe, die man als Demenzkranker durchlaufe: Hilfe ablehnen (Phase 1) und erst später dann doch Hilfe annehmen
(Phase 2). Es hat noch drei weitere Geschwister, die etwas weiter weg wohnen, aber im selben
Bundesland. Sie alle verstehen sich untereinander gut, irgendwelche Zwistigkeiten bzgl.
Pflege erwähnt er nicht. Es wird deutlich, dass die Familie zusammenhält, dass man gemeinsam pflegt und dass viel über die Situation gesprochen wird. Gregor erwähnt den Stammtisch
pflegender Angehöriger, den er gemeinsam mit seiner Frau seit ein paar Jahren besucht. Er
hat dort viel über die Krankheit gelernt, vor allem, dass er manche Dinge nicht so persönlich
nehmen soll. Früher hätte er sich jedes Mal nach 15 Minuten mit seinem Vater gestritten, das
sei aber "schon immer" so gewesen. Wenn der Vater ihm jetzt vorwirft, dass Gregor ihm die
Brieftasche gestohlen habe, geht er nicht drauf ein und nimmt es gelassen. Er weiß jetzt, dass
der Vater eben in seiner Welt lebt.
08 Marie
Marie ist Ende 30, als promovierte Akademikerin freiberuflich tätig und lebt mit ihrem Mann
und ihrer fünfjährigen Tochter in dörflicher Umgebung in der Nähe einer Großstadt. Sie erzählt
von ihrem Vater, der an Demenz litt und bereits vor einigen Jahren im Alter von 87 gestorben
ist. Er war ein erfolgreicher und angesehener Arzt. Er war in zweiter Ehe mit ihrer 15 Jahre
jüngeren Mutter verheiratet und schon knapp 60 Jahre alt, als Marie geboren wurde. Sie berichtet aus der Zeit, als sie im frühen Erwachsenenalter die beginnende Demenz ihres Vaters
miterlebte. "Das Ganze ist halt für mich nicht so leicht gewesen, weil ich halt dann noch so
jung war", sagt sie. Obwohl Marie im fortgeschrittenen Stadium der Demenz des Vaters nicht
27
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
mehr im elterlichen Haushalt lebte und die Fürsorge von ihrer Mutter übernommen wurde,
waren Marie und ihr Partner miteingebunden, etwa, wenn ihr Vater gestürzt war und die Mutter
ihm nicht mehr alleine aufhelfen konnte. Sie lebte in unmittelbarer Nähe. Marie beschreibt die
Pflegesituation als angespannt, allerdings sei das Familienleben schon früher von Konflikten
begleitet gewesen ("schön war es eben nie"). Es gab seitens des Vaters Affären und auch
Gewalt in der Familie. Er habe sich hingebungsvoll seinem Beruf gewidmet, das bewundert
sie an ihm, sich aber für seine Tochter "nie sonderlich interessiert". Deshalb sei seine fortschreitende Demenz für sie zwar "deprimierend" gewesen, aber letztlich eine sich fortführende
Steigerung seiner Abwesenheit ("es war einfach so noch ein Schritt ins ‚Ja, er ist gar nicht
mehr dann da für einen‘"). Sie habe ihrer Mutter nahegelegt, den Vater in ein Pflegeheim zu
geben, weil sie "einfach gesehen habe, dass sie (die Mutter) daran zerbricht". Ihre Mutter jedoch habe dies aufgrund eines selbst auferlegten sozialen Drucks nicht in Erwägung gezogen
("was die Leute denken"). Es gab später auch den mobilen Dienst und eine Pflegerin, die
allerdings nur den halben Monat pflegen konnte, weil Maries Mutter sagte, das sei sonst zu
teuer. Marie wundert sich darüber, schließlich seien sie "gut situiert" gewesen. Marie betont,
dass sie den Vater so nicht hätte pflegen können und spricht auch offen darüber, dass sie
selbst über einen Suizid nachdenken würde, sollte sie die Diagnose Demenz erhalten. Doch
schaut sie auch versöhnlich auf ihren Vater und ist dankbar dafür, was sie alles von ihm gelernt
hat und dass er ein hohes Alter erreicht hat ("ich glaube am Ende geht es darum, was du für
Erinnerungen hast. Und es sollte um die Erinnerungen gehen, die schön sind").
09 Gitti
Gitti ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne, die prinzipiell ausgezogen sind, aber
phasenweise noch dort übernachten. Zu viert sind sie vor ca. 20 Jahren in das Haus der
Schwiegereltern gezogen und haben seither auf sie "geschaut". Die Schwiegermutter ist vor
einigen Jahren verstorben. Jetzt pflegt Gitti hauptverantwortlich ihren Schwiegervater. Er ist
96 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl, lebt seit vielen Jahren mit einer Krebserkrankung und wurde
vor zehn Jahren mit Demenz diagnostiziert. Obwohl die Demenz eher leicht ist, gehe es stetig
"bergab" und er braucht eine Betreuung rund um die Uhr, inklusive Begleitung zur Toilette. Die
Familie lebt in einem kleinen "abgelegenen Dorf" im westlichen Österreich. Gittis Mutter und
Schwester wohnen ebenfalls dort. Gitti war nie durchgängig erwerbstätig. Sie sei in die Pflege
der Schwiegereltern "hereingerutscht", weil sie damals nicht gearbeitet hat und mit den Kindern sowieso zu Hause war. Sie habe sich "überreden" lassen, mit zu den Schwiegereltern zu
ziehen, denn so gut verstanden hat sie sich nicht mit ihnen. Der Schwiegervater sei immer
schon "sehr bestimmend" gewesen und es habe ihr gegenüber an "Herzlichkeit" gemangelt.
Dass sie die Pflege schließlich übernommen hat, erklärt sie mit ihrer Persönlichkeit: Sie sei
eben hilfsbereit und konnte es nicht ablehnen. Sie würde das heute nicht mehr so machen.
Auch ihre Partnerschaft leide unter der Situation. Sie selbst würde den Schwiegervater gern
in ein Pflegeheim geben, ihr Mann ist aber dagegen. Sie haben es kurzzeitig versucht, es hätte
dem Schwiegervater aber nicht gut getan. Er kam zurück. Erbost ist Gitti darüber, dass die
Pflegestufe des Schwiegervaters nach einem ärztlichen Hausbesuch von 6 auf 4 herabgesetzt
wurde, weil sich der Pflegeaufwand verringert habe – was ihrer Ansicht nach nicht stimmt. Die
Herabsetzung bedeutet auch eine finanzielle Verschlechterung für die Familie. Gitti würde gern
einmal kurzfristige Hilfe in Anspruch nehmen oder in Urlaub fahren. Dies kann sich die Familie
aber nicht leisten. Die größte Unterstützung, auch im Zusammenhang mit kurzfristiger Beaufsichtigung, erhält Gitti von ihrer eigenen Familie: namentlich ihrer 78-jährigen Mutter und ihrer
Schwester. Beide springen ein, wenn Gitti einmal kurzfristig das Haus verlassen muss. Ganz
28
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
offen sagt Gitti, dass sie mit der derzeitigen Situation überfordert ist ("manchmal fragt man sich
selber, wie man das eigentlich alles noch durchhält") und gesteht ein, dass sie es bereut, die
Pflege für den Schwiegervater übernommen zu haben. Als Tipp für andere formuliert sie: "
Macht das ja nie. Fangt nie an! Man rutscht da so hinein und dann kommt man nicht mehr
raus!"
10 Zita
Zita ist Anfang 40 und als Medizinerin selbstständig tätig. Sie lebt in einer Großstadt, ist verheiratet und hat drei Söhne im Kindes- und Jugendalter. Mit im Haushalt lebt außerdem die
Großmutter ihres Partners. In Zukunft soll auch ihre 80-jährige demenzkranke Mutter bei ihnen
wohnen, die sie derzeit an den Wochenenden zu sich holen. Sie ist räumlich und zeitlich desorientiert, sonst geistig noch recht fit (Pflegestufe 1 oder 29) und lebt bei einem von Zitas beiden Brüdern, gemeinsam mit ihrem Mann. Die Übersiedlung der Mutter (ohne den Vater) ist
mit einem Geschwister-Konflikt verknüpft: Zita wirft ihrem Bruder vor, sich nicht genügend um
die Mutter zu kümmern, was sowohl emotionale Zuwendung als auch Körperpflege betrifft.
Außerdem hätte ihr Bruder die "Vorsorgevollmacht, die er für beide Eltern hat, deutlich missbräuchlich verwendet", weil er sowohl ihr Elternhaus als auch ein Sparbuch seiner Mutter mit
einem sechsstelligen Euro-Betrag an seine Lebensgefährtin übertragen hat, die mit einem anderen Mann verheiratet ist. Es läuft ein Pflegschaftsverfahren, "wo aber unter der Hand eigentlich klar ist, dass rauskommen wird, dass ich die Sachwalterschaft bekommen werde. Und
dann wird meine Mutter voraussichtlich fix zu uns kommen", so meint Zita. Vor einiger Zeit
hätte ihr Bruder ihre Familie auch mit einer Schusswaffe bedroht, als sie dort waren, um die
Mutter für das Wochenende zu sich zu holen. Auf die Frage, warum die Situation so eskaliert
sei, meint sie, das sei "genetisch". In väterlicher Linie sei man jähzornig, ihr Vater hätte seit
ein paar Jahren auch eine bipolare Störung. In ihrem Elternhaus sei es zwar nie zu Gewalt
gekommen, aber es sei emotional sehr unterkühlt gewesen – "akademisch, kontrolliert, unterkühlt", sagt sie. Sie hätte schon immer eine stärkere Bindung zu ihrer Mutter gehabt als die
beiden Brüder. Ihren Vater möchte sie bei ihrem Bruder wohnen lassen, denn sie geht davon
aus, dass er "nicht entwurzelt werden will" und bei seinem Sohn wohnen bleiben möchte.
11 Annika
Annika ist Ende 50, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie arbeitet als Angestellte
in einer Teilzeitstelle. Mit ihrem Mann lebt sie in einer Großstadt, ihre an Demenz erkrankte
84-jährige Mutter lebt in ihrem Elternhaus, etwa eine Autostunde entfernt. Der Vater ist bereits
vor 25 Jahren verstorben. Vor vier Jahren wurde die Demenz diagnostiziert, sie setzte recht
schnell nach einer Operation ein und ist seither stabil (Pflegestufe 5). Die Mutter konnte nicht
mehr alleine wohnen, es wurde eine 24h-Betreuung organisiert. Eine 48-jährige Rumänin
wohnt bei ihr. Wenn diese einmal verhindert ist, kommt die Schwiegermutter der Rumänin.
Annika hat einen Bruder. Sie beide besuchen die Mutter abwechselnd an den Wochenenden
(mit Übernachtung). Das sei schon anstrengend, und vor allem ihrem Partner sind die Wochenendbesuche oft zu viel, er "meckert", wenn sie früh losfahren und die Einkäufe für die
Mutter erledigen müssen. Obwohl Annika durchaus schon an Trennung gedacht hat, ist ihr der
Ehemann eine wichtige Unterstützung, vor allem in praktischer Hinsicht.
9
Zita weiß es nicht genau.
29
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Nach anfänglicher Skepsis ("du kannst sie jetzt nach Hause schicken") akzeptiert die Mutter
jetzt die Pflegerin. Doch Annika ist nicht ganz glücklich mit der Situation. Ein Thema ist das
"schlechte Gewissen", das sie beschleicht, wenn sie an ihre Mutter denkt, die vielleicht von
der Pflegerin nicht ganz so gut betreut wird (weil letztere viel Zeit am Handy verbringt). Ein
Pflegeheim ist jedoch keine Option, da ist sie sich mit ihrem Bruder einig. Mit ihm sei sie sich
in den letzten Jahren "nähergekommen", eben weil sie die helfenden Tätigkeiten miteinander
koordinieren. Trotzdem gebe es "öfter mal Streit", etwa, weil der Bruder manchmal etwas zu
viel Alkohol trinkt, und zwar auch an den Wochenenden, die er bei seiner Mutter verbringt.
Zwischen ihr und ihrer Mutter hätte sich die Beziehung zum Positiven gewandelt: Nachdem es
früher eine "sehr sehr starke Spannung" gab, weil ihre Mutter "kontrollierend" war und Ansprüche an ihre Tochter stellte, was die Erfüllung der traditionellen weiblichen Rolle anging, sei ihre
Mutter jetzt "lockerer" und man könnte mehr miteinander lachen. Trotzdem, da ist sich Annika
sicher, würde ein dauerhaftes Zusammenwohnen "gar nicht so gut funktionieren", dafür sei die
Mutter-Tochter-Beziehung immer noch zu emotional.
12 Curt
Curt ist Mitte 80, promovierter Akademiker, der bis zu seiner Pensionierung in leitender Position in der freien Wirtschaft gearbeitet hat. Er lebt in einem kleinen Häuschen vor den Toren
einer Großstadt. Seine Frau wurde vor drei Jahren mit einer "beginnenden Alzheimer-Krankheit" diagnostiziert. Er selbst habe "gar nichts gemerkt", ist aber dem Rat eines befreundeten
Arztes gefolgt, der zu einer Untersuchung riet. Curt ist seit mehr als 50 Jahren mit seiner Frau
verheiratet. Sie haben drei erwachsene Kinder, die in unmittelbarer Umgebung wohnen und
oft zu Besuch kommen. Seine Frau hat die Pflegestufe 1. Zwar ist sie körperlich mobil, aber
geistig kaum da und redet nur bruchstückhaft und zusammenhangslos. Auffallend ist die positive Lebenseinstellung von Curt ("C’est la vie! Ich bin deshalb nicht in Verzweiflung versunken")
und seine Bemühungen, das Leben in der Partnerschaft genauso weiterzuführen wie bisher.
Früher sind die beiden viel gereist, haben Sport getrieben und regelmäßig kulturelle Veranstaltungen besucht. Auch jetzt nimmt er seine Frau mit ins Konzert, zu Heurigen-Abenden mit
Freunden und reist sogar mit ihr, inklusive kurzen Flugreisen. Nur häufige Hotel-Wechsel
könne sie nicht mehr gut ertragen. Seit einem halben Jahr hat Curt eine Entlastungshilfe engagiert, die ein paar Stunden pro Woche da ist, damit einerseits er etwas "freigespielt" ist und
damit andererseits "ihr nicht langweilig wird". Als er dann vor zwei Monaten für eine Operation
ins Krankenhaus musste, hat seine Tochter eine 24-Stunden-Betreuung organisiert. Curt ist
nicht ganz glücklich mit der Situation, es sei "gewöhnungsbedürftig", dass immer jemand im
Haus anwesend sei, aber er sagt auch: "Was soll ich machen? Es ist besser so". Die Pflege
kostet Curt viel Geld – das sei aber kein Problem, er hätte sein ganzes Leben viel Geld angespart, jetzt könnten sie es eben gut gebrauchen.
13 Patrizia
Patrizia ist freischaffende Künstlerin, ist Anfang 70 und lebt im westlichen Österreich. Mit ihrem
Mann ist sie seit 54 Jahren verheiratet, er ist deutlich älter als sie und nun Anfang 90. Gemeinsam haben sie einen internationalen Lebensstil geführt, verbrachten mehrere Monate des Jahres im Ausland. Sie haben zwei erwachsene Kinder. Vor zwei Jahren wurde bei ihm eine Demenzerkrankung festgestellt, die mit aggressiven Schüben begann. Er wurde auch handgreiflich ihr gegenüber. Dachte sie zunächst noch, dass sie diese Übergriffe mit einer Änderung
ihres Verhaltens eindämmen könne, musste sie schließlich erkennen, dass das nicht möglich
war, auch weil sie es körperlich nicht mehr schaffte; er fiel oft hin und sie konnte ihn nicht
30
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
aufheben. Ein dreiviertel Jahr hatten sie gemeinsam bei ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter gewohnt, die sie zu sich geholt hatten. Auf Anraten ihrer Kinder hat sie ihren Mann nun vor
wenigen Wochen in ein Heim gegeben, in dasselbe, in dem auch ihre Mutter untergebracht
ist, die bereits 100 Jahre alt ist. Dieser Schritt ist ihr sehr schwergefallen ("Das war für mich
also irgendwie schrecklich, weil fünfzig Jahre wischt man ja nicht so einfach weg"). Tatsächlich
hat Patrizia schon vor der Demenzerkrankung viel Verantwortung für ihren Mann übernommen, der bereits vor 20 Jahren einen Schlaganfall gehabt hatte und dadurch kleinere kognitive
Einbußen hatte. Seitdem hat sie ihn versucht zu schützen, z.B. wenn er auf sozialen
Zusammenkünften Wortfindungsstörungen hatte. Von mehreren Seiten (Familie, Freunden,
Therapeutin) wird sie ermutigt, jetzt einmal "auf sich" zu schauen, nachdem sie durch die angespannte Situation in der Ausübung ihrer kreativen selbstständigen Tätigkeit eingeschränkt
war und auch gesundheitliche Probleme hatte, die sie auf ihre Erschöpfung zurückführt. Sie
hatte mit ihrem Mann auf einer abgelegenen Almhütte gelebt, die sie jetzt verkaufen möchte.
Momentan lebt sie weiterhin im Haus ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter. Die finanzielle
Situation ist angespannt, sie wird deshalb von ihren Kindern finanziell unterstützt. Ihr ist das
zwar unangenehm, ihre Kinder helfen ihr jedoch gern. Gerade beginnt sie, sich an die Situation
zu gewöhnen und lässt sich langsam auf den Rat der Therapeutin ein, dass sie ihren Mann
nicht täglich, sondern nur einmal wöchentlich besuchen sollte.
14 Arnold
Arnold ist knapp 80 Jahre alt und pensionierter Lehrer. Er wohnt in einem Einfamilienhaus in
einem kleineren Ort im westlichen Österreich nahe einer größeren Stadt. Seine Frau – ebenfalls eine pensionierte Lehrerin – war an frontotemporaler Demenz erkrankt und ist vor etwa
einem Jahr im Alter von 79 Jahren verstorben. 54 Jahre waren sie miteinander verheiratet. Er
hat zwei erwachsene Kinder, die weiter weg wohnen, aber regelmäßig vorbeikommen. Die
Krankheit seiner Frau begann, als sie 70 Jahre alt war. Sie konnte ihre linke Körperhälfte nicht
mehr wahrnehmen. Dies zeigte sich darin, dass sie sich links nicht mehr ankleidete (verließ
das Haus ohne linken Schuh) und nicht merkte, wenn sie links etwas in der Hand hielt (sie
suchte die Kartoffel zum Kochen, die sie in der linken Hand hatte). Die letzten fünf Jahre wohnten zwei Frauen aus Polen (ohne Pflegeausbildung) als 24h-Betreuung mit im Haus, die er
ohne die Hilfe einer Agentur engagiert hat. Im Ort gibt es einen Kreis von Polinnen, die privat
weitervermittelt werden. Es waren zwei Cousinen, und sie seien "wirklich super" gewesen. Das
Verhältnis war eng ("es hat beinah den Charakter einer Familie angenommen") und schloss
gegenseitige Gefälligkeiten ein: Die zwei Cousinen haben nicht nur seine Frau gepflegt, sondern auch den kompletten Haushalt und Garten übernommen. Arnold wiederum hat sie auf
Behördenwegen begleitet, mehr als den vereinbarten Preis bezahlt und kümmerte sich auch
um ihre Freizeitgestaltung ("Dann haben wir dafür gesorgt, mit anderen Familien, dass die
untereinander Kontakt hatten. Und wenn halt ihre Freizeit war, dann haben wir sie zusammengebracht, mit dem Auto dahin geführt"). Auch heute, nach dem Tod seiner Frau, hat er noch
Kontakt zu ihnen. In ihren letzten drei Jahren hat seine Frau nicht mehr gesprochen und war
bettlägerig (Pflegestufe 7). Arnold betont, wie wichtig es für sie war, dass er immer für sie da
war, denn nur er wusste, was ihr fehlte, auch in medizinischer Hinsicht ("wenn es ein medizinisches Problem gab, konnte nur ich Auskunft geben"). Er glaubt, dass sie bei Unterbringung
in einem Pflegeheim früher verstorben wäre. Arnold hat die Pflege seiner Frau gern angenommen, er hätte sie "nie als Belastung empfunden" und sie war "ein geduldiger Patient", sagt er
liebevoll. Geredet hat er mit ihr nach wie vor, auch wenn er sich nicht sicher war, ob sie ihn
31
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
noch erkannte. Er zitiert einen Satz, den er sich zur "Richtschnur" gemacht hatte: "Es wird der
Geist dement, aber es wird die Seele nicht dement".
15 Theresa
Theresa ist Anfang 40, arbeitet im sozialen Bereich und lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern
(Teenager-Alter) und ihrer Schwiegermutter in einer größeren Stadt im Westen Österreichs.
Ihr Partner ist acht Jahre älter als sie, sie hat ihn im Teenageralter kennen gelernt. Als er 40
Jahre alt war, ist er im Zuge eines Schlaganfalls an Demenz erkrankt. Er lag sechs Wochen
im Koma. Nach dem Aufwachen, glaubte man erst an vorübergehende Gedächtnisstörungen,
die sich bessern würden. Er hatte (und hat) große Orientierungsprobleme, kann deswegen
das Haus nicht verlassen und nennt seine Frau mitunter beim falschen Namen. Theresa erkannte aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds, dass es sich um eine Demenz handeln
müsste. Man glaubte ihr zunächst nicht. Aktuell hat er die Pflegestufe 1. Für sie hat sich sehr
viel verändert: War sie zunächst hauptsächlich Hausfrau und Mutter und ihr Partner ein "Karrieretyp", der in einem weit entfernten Bundesland in leitender Position gearbeitet hat und selten zu Hause war ("also wir haben nur eine Wochenendbeziehung gehabt"), sind die Rollen
nun umgekehrt: Nun ist sie diejenige, die die Familie ernährt, die Finanzen erledigt und auch
das Autofahren übernommen hat. Ihr Partner kümmert sich, so gut er kann, um den Haushalt.
Er ist arbeitsunfähig, obwohl man versucht hatte, eine neue Stelle für ihn zu schaffen. Sie
bewertet die neue Situation positiv ("früher ist man immer irgendetwas nachgelaufen, und eigentlich haben wir es jetzt viel schöner"), sie hätten mehr Zeit füreinander, der Umgangston
sei "herzlicher" geworden und die Kinder fänden die Eltern "lässiger" als früher, als ihnen der
Bildungsweg ihrer Kinder noch wichtiger war. Gleichzeitig ist ihr Mann kein ganz ebenbürtiger
Partner mehr, auch nicht in der Rolle des erziehenden Vaters. Er vergisst Dinge, die man ihm
erzählt hat oder kann nicht einschätzen, bei welchen Tätigkeiten sein kleiner Sohn elterliche
Unterstützung braucht. Trotzdem Theresa in ihrer Narration die positiven Aspekte ihrer Familien- und Lebenssituation betont, gibt es doch auch schwierige Tage. Sie sagt, das Familienklima sei nicht immer gut, ihr Partner habe auch "schlechte Tage" und die Kinder würden sich
dann zurückziehen. Auch würde es ihr und ihren Kindern guttun, wenn sie einmal pro Jahr zu
dritt in den Urlaub fahren würden, während ihr Mann in der Reha ist.
16 Felix
Felix ist Mitte 60 und ist, nachdem er in verschiedenen Bereichen gearbeitet hat, schon pensioniert, aber noch geringfügig beschäftigt. Mit seiner Frau ist er seit 39 Jahren zusammen.
Sie haben zwei erwachsene Töchter. Seine Frau ist unwesentlich jünger als er und war in
leitender Position im kaufmännischen Bereich tätig. Als sie 50 Jahre alt war, wurde ihr wegen
"Umstrukturierung" gekündigt, er meint, es könne aber sein, dass ihre Krankheit damals schon
sichtbar war und ihr deshalb gekündigt wurde. Als sie schließlich motorisch immer unsicherer
wurde und nicht mehr ohne Kochbuch kochen konnte, ging Felix mit ihr zum Arzt. Es wurde
eine frontotemporale Demenz diagnostiziert. Als schwierig empfand er zu Beginn vor allem "zu
deuten, was sie wirklich will". Auch wenn seine Ehe nicht immer ganz einfach war, wie er
andeutet ("wir haben viele Kämpfe gehabt, als die Kinder noch klein waren"), nahm er seine
Verantwortung als Ehemann an ("Das ist halt Partnerschaft, dass man zu dem steht, was man
eigentlich versprochen hat"). Im weiteren Verlauf sei seine Frau außerdem "umgänglicher geworden", weniger "resch" und "stur", als er sie in gesunden Tagen erlebt hat. Vier Jahre hat
Felix seine Frau im gemeinsamen Zusammenleben unterstützt und betreut, vor einem Jahr ist
32
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
sie nun in ein Pflegeheim gekommen. Der Auslöser war für ihn ihre Zurückweisung ihm gegenüber, die er nicht mehr ertragen wollte ("Jetzt lehnt sie mich eigentlich ab und ich will das
nicht noch verstärkt mehr miterleben"). Seine Frau in ein Heim zu geben, fiel ihm sehr schwer
("so wie wenn man ein Tier aussetzt"). Seine beiden Töchter haben diese Entscheidung unterstützt, aber die Geschwister seiner Frau haben ihm diesen Schritt übelgenommen, der Kontakt ist daraufhin abgebrochen. Sie hat mittlerweile die Pflegestufe 6, ob sie ihn noch erkennt,
weiß er nicht. In einem "Radl" mit sieben Personen wechselt man sich mit Besuchen bei ihr
ab, meist um die Mittagszeit, um ihr beim Essen zu helfen. Felix hadert stark mit der Krankheit
seiner Frau, fragt sich am Ende des Interviews, ob es vielleicht doch noch Hoffnung geben
könnte, dass sich die Situation seiner Frau wieder verbessern könnte – obwohl er an anderer
Stelle betont hatte, dass davon nicht auszugehen sei. Kraft geben ihm seine Freunde und
seine beiden Töchter, mit denen er sich offen über seine Situation austauschen kann.
17 Sissi
Sissi lebt mit ihrem demenzkranken Mann in einem kleinen Haus in einem Vorort einer Großstadt. Sie ist Anfang 70, ihr Mann zehn Jahre älter. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Kinder,
die mit ihren Familien in unmittelbarer Nähe wohnen. Sissi war im medizinischen Bereich tätig,
ihr Mann in der freien Wirtschaft in leitender Position, er sei viel herumgekommen und war
"fast nie zu Hause". Bei ihm wurde vor etwa zehn Jahren eine Demenzerkrankung diagnostiziert, die Krankheit ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er nicht mehr spricht – nur ab
und zu in seiner Muttersprache flucht. Er muss auch nachts versorgt werden, u.a. weil er inkontinent ist. Er sitzt außerdem im Rollstuhl und hat die Pflegestufe 6. Als Sissi vor ein paar
Wochen wegen einer Operation stationär aufgenommen wurde, haben ihre Kinder eine 24hBetreuung organisiert. Ein Pfleger und eine Pflegerin wechseln sich alle 14 Tage ab und leben
mit den beiden zusammen. Sissi findet die Konstellation "schrecklich. Man ist nicht mehr allein." Auch stört sie, dass sie ihrem Mann nicht mehr helfen darf, die 24h-Betreuung möchte
alles alleine übernehmen. Hilft Sissi doch, beschwert sich die junge Rumänin bei Sissis
Schwiegertochter über sie. Gleichzeitig ist ihr Mann "in letzter Zeit sehr aggressiv", kürzlich
hat er der jungen rumänischen Pflegerin eine Ohrfeige gegeben. Sissi hatte gehofft, wieder
auf die 24h-Betreuung verzichten zu können, jedoch mangelt es ihr an körperlicher Kraft, mit
ihrem gehbehinderten Mann allein zurechtzukommen. Auch gesteht sie sich mittlerweile ein,
dass ihre gesundheitlichen Probleme, die im Krankenhausaufenthalt mündeten, wohl damit zu
tun hatten, dass sie sich zu lange keine Unterstützung für die Pflege ihres Mannes geholt hatte
("wenn ich früher auf mich gehört hätte (…), wäre das alles nicht so schlimm ausgegangen").
Sissi ist nicht zufrieden mit der jetzigen Situation, erfährt aber viel Wohlwollen und praktische
Unterstützungsangebote von Freunden, der Nachbarschaft und auch von ihren Kindern. Letztere kommen jetzt noch öfter vorbei, als sie es früher ohnehin schon getan hätten. Beide Söhne
und die Schwiegertöchter schauen täglich vorbei. Sie wünscht sich, dass sie einmal ein Wochenende in einer Therme entspannen kann und ahnt, dass ihre Kinder ihr diesen Wunsch
zum Muttertag erfüllen wollen.
33
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4 Ergebnisse
Der folgende Teil stellt die Situation der pflegenden Angehörigen aus deren subjektiver Perspektive dar. Dazu wurden die Interviews mit den 17 Erzählpersonen interpretiert und analysiert. In zehn Unterkapiteln werden emotionale, strukturelle und familiensystemische Aspekte
in den Blick genommen und mit (anonymisierten) Zitaten illustriert.
4.1
Unterschiedliche Pflegearrangements und Rolle der
Interviewpartner/innen im Betreuungsgefüge
Die oben dargestellten Kurzbiografien haben bereits einen ersten Einblick in die Vielfalt der
Betreuungsarrangements gegeben, die bei Menschen mit einer Demenzerkrankung zum Einsatz kommen. In einigen Fällen findet die Betreuung im Familienverband statt, häufig unterstützt durch mobile Dienste, in anderen wird auf eine 24h-Betreuung zurückgegriffen, die in
unterschiedlichem Ausmaß durch familiäre Pflege ergänzt wird. Während Personen im Anfangsstadium der Demenz ihren Alltag noch weitgehend alleine bewältigen können, sind andere auf eine Rundum-Versorgung angewiesen, die die Ressourcen und Möglichkeiten der
Pflege im eigenen Haushalt schnell übersteigen kann und eine Übersiedelung in ein Pflegeheim möglicherweise als die bessere Lösung erscheinen lässt.
Die untere Abbildung gibt einen Überblick über die zum Zeitpunkt der Interviewführung bestehenden Pflegearrangements. Daraus ist ersichtlich, dass in acht Fällen die interviewte Person
mit der an Demenz erkrankten Person in einem Haus(halt) lebt, während dies in neun Fällen
nicht der Fall ist. Eine der befragten Frauen lebt zwar aktuell nicht mit ihrer betreuungsbedürftigen Mutter zusammen, plant jedoch, diese so rasch wie möglich bei sich aufzunehmen.
In vier Fällen findet die Betreuung – zum Teil unter Einbeziehung mobiler Dienste und/oder
informeller Hilfen – ausschließlich in der Familie statt, vier Familien werden bei der Pflege
zuhause durch eine 24h-Betreuung unterstützt. Nur eine der acht Interviewpartner/innen, die
mit der dementen Person zusammenleben, übernimmt in der Betreuung keine zentrale Aufgabe.
Während zwei der befragten Personen zwar nicht im selben Haus oder Haushalt, aber in unmittelbarer Nähe ihres erkrankten Angehörigen wohnen, müssen vier eine weitere Anreise in
Kauf nehmen, da sie in einem anderen Bundesland leben. Drei an Demenz erkrankte Personen werden in einem Pflegeheim betreut.
34
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Abbildung 5: Überblick über Betreuungsarrangements (inkl. Interviewnummern)
ZUSAMMENLEBEND
Hauptverantwortlich (familiäre
Hauptverantwortlich (mit
Betreuung)
24h-Betreuung)
Annemarie (04)
Curt (12)
Gregor (07)
Arnold (14)
Gitti (09)
Sissi (17)
NICHT ZUSAMMENLEBEND
Nicht hauptverantwortlich
In der Nähe
wohnend
In größerer Entfernung wohnend
Heimbetreuung
Cornelia (3)
Anton (05)
Elisabeth (02)
Lisa (01)
Marie (08)
Lena (06)
Patrizia (13)
Zita (10)10
Felix (16)
Annika (11)
Theresa (15)
Quelle: ÖIF 2018
4.1.1
Familiale Pflege: Hauptverantwortlich
Vier Personen – Annemarie, Gregor, Gitti sowie Theresa – pflegen ihre erkrankten Angehörigen hauptverantwortlich im Familienverband. Während bei Theresa der Partner von Demenz
betroffen ist, ist es bei den übrigen ein Eltern- oder Schwiegerelternteil. Das Ausmaß der Unterstützung, das die Betroffenen bei ihrer Pflegetätigkeit erfahren, ist dabei recht unterschiedlich: Annemarie, die ihre Schwiegermutter pflegt, sowie Gregor, bei dem der Vater erkrankt ist,
können auf ein gut funktionierendes familiales Netzwerk zurückgreifen, während dies bei Gitti
und Theresa nicht der Fall ist.
Gregor beschreibt die Pflege im Familienverband im Sinne eines eingespielten Teams
("wenn irgendwas zu machen war, hat jeder was gemacht"). Dabei ist es vor allem seine Frau,
die gemeinsam Verantwortung für das Wohlergehen des (Schwieger-)vaters übernimmt, aber
auch der im selben Haushalt lebende Sohn schaut, "dass alles in Ordnung ist", ebenso wie
dessen Freundin, die laut Gregor als Krankenschwester ebenfalls mit der Pflegethematik vertraut ist. Praktische Unterstützung erhält die Familie darüber hinaus durch eine in der Nähe
lebende Schwester. Externe Hilfe durch mobile Dienste o.ä., die für die inzwischen verstorbene, ebenfalls an Demenz erkrankte Mutter in Anspruch genommen wurde, lehnt Gregors
Vater allerdings ab. Auch die Mutter wurde von Gregor und seiner Familie bis zu ihrem Tod in
der Familie gepflegt. Insofern können Gregor und seine Familie bereits auf einen reichhaltigen
Erfahrungsschatz in Hinblick auf die Organisation der innerfamilialen Pflege zurückgreifen, wie
die folgende Interviewpassage belegt:
Gregor: "Ja, also die Frau hat mehr das Medizinische gemacht, von Tabletten einschachteln
bis das Koordinieren mit dem Arzt, Arzttermine und das alles. Und bei mir war es so, dass ich
halt, ich war daheim, ich habe daheim alles gemacht. Wenn sie was gebraucht hat, Sauerstoff,
oder wenn sie mit dem Rollstuhl einmal hinaus ist oder wenn sie hat müssen aufs Klo gehen,
da war ich, weil ich viel daheim bin in Schicht- und Wechseldienst. Und ich bin tagsüber viel
daheim. Da hab ich das übernommen. Und die Schwester hat mehr oder weniger, wenn von
uns keiner da war, da ist halt sie eingesprungen. Aber im Großen und Ganzen, also den größten Teil hat die Frau übernommen. Also die Frau und ich miteinander. Es hat keine so strenge
Aufgabenverteilung gegeben. Wenn irgendwas zu machen war, hat jeder was gemacht." (Int.
07: 26)
Vor diesem Hintergrund ist der Vater für Gregor – trotz Pflegestufe 3 – bisher "noch kein Pflegefall", da er viele Dinge noch alleine bewältigen kann.
10
Hauptverantwortliche Betreuung im Haushalt der Interviewperson geplant.
35
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Gregor: "Er ist noch kein Pflegefall, aber es ist halt immer zum Schauen und immer, ja, halt
einfach ein Auge drauf werfen immer, was er tut und was er macht und so. (…) Und wir machen zwar Sachen für ihn, so wie Einkaufen oder Sachen, die notwendig sind von der Pflege
her, Anziehen oder so Sachen, was er halt nicht mehr kann. Aber im Großen und Ganzen
lassen wir ihn alleine leben, ja. Was er schafft, schafft er und den Rest machen halt wir." (Int.
07: 8, 12)
Gregor uns seine Familie machen den Eindruck eines eingespielten Teams, in dem jeder seine
Aufgaben und seine Verantwortung kennt. Es wird in Gregors Aussagen auch deutlich, dass
die Demenzerkrankung kein Neuland mehr darstellt und die damit verbundenen Herausforderungen zu einem großen Teil bereits durch die Erkrankung der Mutter vorweggenommen wurden. So ist sich Gregor bewusst, dass Demenz ein dynamisches Geschehen ist. Er hadert
zwar mit dem Umstand, dass der Vater externe Hilfe derzeit rigoros ablehnt, sieht dies aber
als Stufe in einem Entwicklungsprozess ("die Oma, also meine Mutter, war am Anfang genauso auch").
Auch Annemaries Zugang zu der Erkrankung ihrer Schwiegermutter ist von einer Selbstverständlichkeit und einer gewissen Gelassenheit geprägt. Sie hat die demente alte Frau, die
bereits Pflegestufe 7 zugesprochen bekommen hatte, bis zu ihrem Tod wenige Wochen vor
dem Interview hauptverantwortlich gepflegt. Als ausgebildete Krankenschwester, die bis zu
ihrer Pensionierung vor fünf Jahren im Pflegedienst gearbeitet hat, war sie in der Lage, auch
die notwendige fachliche und medizinische Betreuung zu gewährleisten.
Es wird deutlich, dass sich Annemarie auf verschiedenen Ebenen mit der Rolle der Helfenden/Pflegenden identifiziert, wie sie auch selbst anmerkt: "Ein bisserl hab ich schon das Helfersyndrom auch in mir gehabt, nicht?" Deutlich wird dies nicht nur in ihrer Entscheidung, die
Pflege der Schwiegermutter bis zuletzt zu leisten, sondern auch in ihrer Berufswahl und darin,
dass sie eine Validationsausbildung gemacht hat und sich in einer Selbsthilfegruppe engagiert.
Obwohl sie augenscheinlich die Hauptlast der Betreuung getragen hat, sind aus ihren Aussagen keine Hinweise auf Erschöpfung oder Überforderung abzulesen. Ein starkes Netzwerk
aus informellen und formellen Quellen könnte hierzu einen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet haben. So hat sie "eigentlich zuhause immer wen haben können", der sie im Alltag
unterstützt hat und bei Bedarf eingesprungen ist:
Annemarie: "Ja, es ist so: Es war ja, wir haben immer die Hauskrankenpflege ins Haus geholt,
dann halt öfter. Und meine Tochter, die hat sehr viel gemacht mit der Oma, sogar ganz viel,
weil – Meine Tochter, und dann haben wir noch zwei private Frauen gehabt, die noch extra
hergekommen sind, wenn wir sie angerufen haben. Wir haben eigentlich zuhause, ich habe
immer wen haben können, den ich anrufen habe können. Der uns noch geholfen hat, wenn
wir haben wegfahren müssen und so, und der die Arbeit gemacht hat. Und mein Mann, der
hat von der Betreuung her, dass er die Oma gewickelt hätte oder die Inkontinenzversorgung,
das hat er nicht können. Aber er hat immer geschaut, dass alles passt bei der Oma. Oder
auch, er hat angerufen, wenn Not am Mann war. Und so war das halt." (Int. 04: 44)
Ergänzend zu den kontinuierlichen Entlastungsmöglichkeiten wurde darüber hinaus über mehrere Jahre hinweg für ein Monat im Jahr die Möglichkeit der Kurzzeitpflege genutzt, um etwa
einen längeren Urlaub mit der Familie zu ermöglichen.
36
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Wie Annemarie trägt auch Gitti im Rahmen einer Pflege im Familienverband die Hauptverantwortung für die Pflege eines Schwiegerelternteils (hier: des bereits 96-jährigen Schwiegervaters). Sie fühlt sich jedoch mit der Pflege alleingelassen. Obgleich auch bei Gregor und
Annemarie die Pflegesituation gleichsam "automatisch" aus der gemeinsamen Wohnsituation
erwachsen ist und mit einer unhinterfragten Selbstverständlichkeit das Leben der Familie über
weite Strecken bestimmt, bringt Gitti, die vor dem Schwiegervater bereits lange Jahre die
Schwiegermutter betreut hat, sehr deutlich zum Ausdruck, dass sie sich nicht aus freien Stücken für die Übernahme der Pflege entschieden hat. Vielmehr ist sie, wie sie sagt, "da hineingerutscht, da sie ja ohnehin "bei den Kindern daheim" war und somit "Zeit hatte".
Int.: "Und wie sieht das jetzt aus bei Ihnen? Also wer unterstützt ihn, welche Unterstützung
bekommt er?"
Gitti: "Puh. Ja, es ist so: Großteils eigentlich ich. Also deswegen, mehr oder weniger, es war
von Anfang an, da rutscht man so hinein. Man ist bei den Kindern daheim, daneben macht
man das alles mit. Mehr oder weniger bin immer ich da." (Int. 09: 31f.)
Seitens ihres Mannes erhält Gitti nur wenig Unterstützung, fordert diese jedoch auch nicht ein,
da er durch seine Berufstätigkeit "halt so viel Stress" hat.
Gitti: "(lacht) Aufgabenteilung, mhm. Ja, schwierig. Das wird halt so geteilt: Der, was daheim
ist, hat ja Zeit, und der kann das ja machen. Durch das, dass ich nicht arbeiten gehen kann,
weil ich das habe, mache das großteils ich. Ist so. Ich meine, freilich, und schon mein Mann,
wenn er daheim ist, dann auch, ja. Aber da ist halt wieder, weil ich ja so,- Ja. Er hat halt so
viel Stress, und da muss das mehr abgebaut werden, und da schau halt noch einmal ich mehr,
damit er ein bisschen mehr Freizeit hat (lacht) Ja." (Int. 09: 87)
Anschaulich beschreibt sie ihren Alltag, der durch die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit
geprägt ist, damit der auf den Rollstuhl angewiesene Schwiegervater sich nicht selbst in Gefahr begibt:
Gitti: "Also mehr oder weniger muss immer wer daneben sein, damit er nicht wegrennt oder
umfällt oder so oder irgendwo hinfährt, wo er eigentlich nicht kann. Oder er bildet sich ein, er
kann selber aufs Klo fahren, geht aber nicht. Und das ist halt schon, dass man wirklich so
aufpassen muss, wie was passiert, dass immer wer entweder daneben ist oder mit Babyphon.
Also wir haben im Wohnzimmer ein Bildschirm-Babyphon hingeschafft (lacht), immer ein Bildschirm-Babyphon. Und sonst, wenn ich im Oberstock bin, nachher höre ich schon, wenn er
von der Küche mit dem Rollstuhl rausfährt, höre ich das schon. Also da ist es schon so, dass
man das sofort weiß, und dann lauf ich schon wieder runter, wenn du was brauchst, und dann
geht man schon wieder."
Int.: Sind Sie immer auf dem Sprung?!
Gitti: Genau. Also das ist einfach durchgehend, ja." (Int. 09: 49ff.)
Entlastung erfährt Gitti durch das Hilfswerk, das dreimal in der Woche zum Duschen kommt
und an einem dieser Tage zusätzlich für mehrere Stunden die Betreuung übernimmt, damit
Gitti zum Beispiel Arzttermine wahrnehmen kann. Unterstützung leisten zudem fallweise die
eigene Mutter und Schwester, jedoch ist "…alles ein bisserl kompliziert":
Int.: "Wie ist das, wenn Sie jetzt mal, weiß ich nicht, einkaufen oder einen Termin haben?"
Gitti: "Eben, da ist dann das Hilfswerk da. Und wenn es ihm relativ gut geht, es ist, dadurch
es ja mein Heimatort auch ist, meine Mutti, die ist zwar auch schon 78. Super. Aber die ist
noch so fit, und sie kann bei ihm zwar sonst nichts machen, aber ein Essen geben oder einfach, dass jemand bei ihm sitzt, wenn ich jetzt wirklich dringend kurzfristig was habe, nachher
kommt die mir ins Haus. Dann sitzt sie halt bei ihm, bis ich wieder komme. Nur zum Beispiel
darf es halt nicht zu lang sein. Aber wenn er dann aufs Klo müsste, da muss nachher schon
wieder wer anders da sein. Da ist meine Schwester auch fünf Kilometer weit weg im Notfall,
wo meine Mutti auf ihn schaut, und sie braucht dringend wen, fährt die da her. Es ist alles ein
37
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
bisserl kompliziert, aber das ist dann die einzige Möglichkeit, wenn ich wirklich irgendwas
kurzfristig brauche." (Int. 09: 53f.)
Von den langjährigen Belastungen und Einschränkungen zermürbt, hat Gitti auch den Versuch
unternommen, ihren Mann dazu zu überreden, seinen Vater in einem Pflegeheim unterzubringen. Ein entsprechender Versuch scheitert jedoch, nicht zuletzt auf Druck der Familie. Die
zugesagte Unterstützung der Geschwister von Gittis Mann, wenn der Vater wieder zu Hause
betreut wird, entpuppt sich im Endeffekt als leeres Versprechen und wieder ist es Gitti, die mit
der für sie extrem unbefriedigenden Situation alleine bleibt:
Gitti: "Ich hätte ja zum Beispiel meinen Schwiegervater ganz gern in ein Heim gegeben, weil
ich gesagt habe, ich will einfach,- Also eben, die Kinder waren noch mehr daheim. Man kann
nie einmal am Nachmittag einmal Radfahren oder irgendwas. (…) Dann haben wir es getestet,
und im Heim ist es meinem Schwiegervater gar nicht gut gegangen. Da ist mein Mann jeden
Tag, Nachmittag, einen ganzen Nachmittag bei ihm im Heim gesessen. War halt auch nicht
viel besser. Und ja, nachher im Endeffekt haben wir ihn wieder zu Hause gehabt. Ja. Da haben
uns die Geschwister von meinem Mann versprochen, sie werden uns mehr unterstützen, wenn
wir ihn doch wieder heim tun nach drei Wochen Heim. Ja, und er hat ja noch sechs Geschwister. Ja, aber es hat sich herausgestellt, dass da trotzdem sich keiner Zeit nimmt dafür und
dass es ihnen teilweise zu viel ist. Im Grunde ist es trotzdem wieder auf mir hängen geblieben." (Int. 09: 40)
Auch die Möglichkeit der Kurzzeitpflege, die in den letzten Jahren von der Familie mehrmals
in Anspruch genommen wurde und eine wichtige Entlastungmöglichkeit für Gitti darstellte,
scheint in der aktuellen Situation in weite Ferne gerückt zu sein, da der letzte Aufenthalt des
Schwiegervaters mit erheblichen Problemen verbunden war. Der Versuch, ohne diese Option
für drei Tage zu verreisen, wurde für Gitti zum Fiasko, nicht zuletzt deshalb, weil es ihr nicht
gelungen ist, die (ungewollte) Verantwortung abzugeben:
Int.: "Wie ist das mit Urlaub? Fahren Sie manchmal auf Urlaub?"
Gitti: "Eben, wenn wir ihn ins Heim gegeben haben. Für die Übergangspflege, die man ja vom
Land kriegt, die kriegt man vier Wochen. Und das haben wir jetzt schon drei Jahre hintereinander genommen, ja. Also das schon, nur wissen wir nicht, weiß ich nicht, ob wir das heuer
auch wieder werden machen, weil letztes Jahr war das ziemlich ein Problem. Weil sie eben,
wir haben da so Tabletten, die geben wir wirklich nur im äußersten Notfall. Die haben sie ihm
nicht gegeben, und da hat er wirklich zwei Tage randaliert. Also, er hat alles zerrissen, was er
in die Hände gekriegt hat, und jetzt, ich habe mich noch gar nicht getraut anrufen, ob sie ihn
überhaupt noch nehmen würden. Und ich weiß auch nicht, also wir sind drei Tage Therme
gefahren, und da hat mein Mann auch gesagt, er will ihn nicht mehr in ein Heim geben, und
er will das daheim probieren. Da haben wir, eben meine Kinder haben immer nachgeschaut,
also dass die in der Nacht da waren, weil man ja in der Nacht auch ihn kann nicht allein lassen.
Und dann bei Tag eben das Hilfswerk, meine Mutti und meine Schwester. Aber ich muss
sagen, so fahre ich nirgends mehr wo hin, weil da war ich eben wie auf Nadeln und habe
überall angerufen, ob wohl alles passt." (lacht ein bisschen) (Int. 09: 126f.)
Letztendlich kommt Gitti zu dem sehr klaren Schluss:
Gitti: "Ich sage immer, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich das nie gemacht." (Int. 04: 42)
Gänzlich anders stellt sich die Situation bei Theresa da. Sie pflegt ebenfalls im Familienverband ist in Hinblick auf die Betreuung aber deshalb weitgehend auf sich alleine gestellt, weil
die weiteren Familienangehörigen noch Kinder sind. In ihrem Fall ist es ihr Mann, der bereits im Alter von 40 Jahren infolge eines Schlaganfalls vor neun Jahren eine Demenzerkrankung entwickelt hat. Die drei Kinder des Paares waren zu diesem Zeitpunkt zwischen zwei und
zwölf Jahre alt. Aufgrund der Gedächtnisstörungen und Orientierungsprobleme ist Theresas
38
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Mann nicht mehr in der Lage, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, obgleich zu Beginn etliche
Bemühungen der Wiedereingliederung unternommen worden sind. Wie in ihrer Kurzbiografie
dargestellt, hat Theresa nicht nur die Verantwortung für die Betreuung ihres Mannes übernommen, sondern gleichzeitig auch jene Aufgaben, die früher er ausgefüllt hat. So ist nun sie diejenige, die die Familie ernährt. Zudem ist es für den Erkrankten auch schwierig, seiner Vaterrolle gerecht zu werden, weshalb Theresa auch weitgehend als alleinige Ansprechperson für
ihre Kinder fungiert.
Von der Familie ihres Mannes erhält Theresa keinerlei Unterstützung, im Gegenteil: Die
Schwiegermutter, die selbst ihren Mann bis zu dessen Tod gepflegt hat, kann mit der Erkrankung ihres Sohnes nur schwer umgehen, benötigt jedoch selbst Unterstützung und wird von
Theresa im eigenen Haushalt mitbetreut.
Trotz der schwierigen Familiensituation unternimmt Theresa große Anstrengungen, ihre Situation positiv zu sehen. Dies zeigt sich etwa darin, dass sie die Erkrankung ihres Mannes zum
Anlass genommen hat, eine Ausbildung zur Demenzberaterin zu absolvieren. Auch streicht
sie im Interview immer wieder die positiven Aspekte hervor, die sich aus der veränderten Familiensituation ergeben haben, zum Beispiel, dass sie nun als Familie mehr Zeit miteinander
verbringen, nachdem der Vater nicht mehr berufstätig ist. Die enorme zeitliche Belastung
durch die vielfältige Verantwortung relativiert sie und weist beispielsweise die Aussage der
Schwiegermutter, sie habe "immer so einen Stress" vehement von sich:
Theresa: "Das hasse ich überhaupt, wenn jemand zu mir sagt, ich habe einen Stress. Ich habe
keinen Stress. Ich sage immer, ich bin eingeteilt. Aber ich bin irrsinnig gut organisiert." (Int.
15: 152)
Ihre eigene Familie, die Theresa zumindest insofern unterstützt, als sie Verständnis für ihre
Situation zeigt, nimmt sie sich dabei zum Vorbild:
Int.: "Haben Sie noch Eltern?
Theresa: Ja.
Int.: Was ist mit denen, wie passen die da so rein, wenn wir so vom System sprechen?
Theresa: Also ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wir sind selber sieben Kinder. Und
bei uns ist das eigentlich, meine Eltern waren eigentlich die, die am meisten Verständnis dafür
gehabt haben für meinen Mann. Also die haben mich am meisten unterstützt. (…) Und meine
Familie war eigentlich immer die, die immer da war. Wir waren das einfach gewohnt. Familie,
da gibt es halt immer Höhen und Tiefen, und mein Papa hat dann Parkinson gekriegt und ist
halt auch jetzt ein bisserl,- Parkinsondemenz hat ein bisserl angefangen jetzt. Und da sehe
ich eigentlich dann wieder, dass das gleich abläuft, weil meine Mama ist irgendwie auch total
stark, die sagt nie, ‚Es ist mir zu viel‘, es passt immer alles. Also wir sind alle so sehr ähnlich."
(Int. 15: 64ff.)
Eine kleine Auszeit gönnt sich Theresa, wenn ihr Mann mehrere Wochen auf Reha ist. Aber
auch diese Zeit nutzt sie nicht primär zur Entspannung, sondern vielmehr in produktiver Weise,
indem sie Umbau- und Renovierungsarbeiten vornimmt:
Int.: "Haben Sie irgendeine Unterstützung gehabt oder momentan? Also so,- Weiß ich nicht,
welcher Art, dass Sie mal so Kurzzeitpflege haben oder ich weiß auch nicht, was auch immer?"
Theresa: Nein. Nein, das nicht, aber wir haben das Glück gehabt, dass er eigentlich jedes
Jahr hat auf Reha gehen können und da immer die vier bis sechs Wochen meistens weg war.
Also das war schon, dass ich mir dann immer Urlaub genommen habe einfach auch weil,(seufzt) Ja. Das haben wir eigentlich beibehalten, jedes Jahr diese Reha, wo man dann einfach für die Kinder dann die Zeit hat, selber ein bisserl runterschalten, und dann umbauen.
39
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Immer, wenn er weg ist, dann wird komplett alles neu gemacht. Also ausgemalt, weiß nicht,
gestrichen. Das brauche ich einfach dann so ein bisserl." (Int. 15: 48f.)
4.1.2
Familiale Pflege: Hauptverantwortlich gemeinsam mit 24h-Betreuung
Drei Interviewpartner/innen, nämlich Curt (Int. 12), Arnold (Int. 14) und Sissi (Int. 17) leben mit
ihrem/ihrer Partner/in und einer 24h-Kraft unter einem Dach.
Während Curts Frau noch relativ gut "beisammen" ist (Pflegestufe 1), besteht bzw. bestand
(Arnolds Frau ist bereits verstorben) bei den beiden anderen Personen ein sehr hoher Pflegebedarf (Pflegestufe 6 bzw. 7).
Curt hat seine Frau bis vor kurzem alleine betreut. Die 24h-Betreuung wurde anlässlich einer
Operation Curts, die mit einem 10-tägigen Krankenhausaufenthalt verbunden war, von der
Tochter des Paares organisiert. Es handelt sich um zwei Rumäninnen, die sich monatlich mit
der Betreuung abwechseln. Bisher hat erst ein Wechsel stattgefunden. Curt steht dieser Betreuungslösung etwas ambivalent gegenüber. Er ist zwar grundsätzlich mit der Betreuung zufrieden ("es klappt wie am Schnürl"), er selbst hätte nach seiner Aussage diese Form der Hilfe
wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen und ist auch nicht sicher, ob es sich um eine
dauerhafte Lösung handeln wird:
Curt: "Diese 24-Stunden-Hilfe ist auf meiner Tochter ihrem Boden gewachsen, nicht auf meinem. Ich hätte es wahrscheinlich nie gemacht, aber gut.
Int.: Die 24-Stunden-Hilfe?
Curt: Ja. Aber ich habe eine Operation hinter mir, war zehn Tage im Spital, und da ist mir
aufgefallen, dass es doch besser wäre. (lacht)
Int.: Wenn jemand kommt, ja.
Curt: Ja. Also derzeit jedenfalls." (Int. 12: 8ff.)
Es besteht eine enge und herzliche Beziehung zu den drei erwachsenen Kindern sowie den
sieben Enkeln im Alter von acht bis 17 Jahre, die alle in der Nähe leben und die Eltern (bzw.
Großeltern) regelmäßig (offenbar nahezu täglich) besuchen und die Eltern auch praktisch unterstützen. Neben der Organisation der 24h-Betreuung waren sie beispielsweise bei der Anschaffung und Installation einer Klimaanlage behilflich.
Von Curt selbst angeworben wurde bereits vor einiger Zeit eine Entlastunghilfe, die stundenweise die Betreuung übernimmt, mit dem klaren Motiv, sich selbst "auch freizuspielen":
Curt: "Ich kann mich ja nicht dauernd um sie kümmern. Dass ihr nicht langweilig ist, nicht?
Also mit ihr hat sie was zu tun, nicht? Da ist,- Da werden zuerst die Hausübungen von der
Frau (Name Ergotherapeutin) gemacht, da gibt es Hausübungen, die werden dann gemacht.
Dann geht sie spazieren, dann schauen sie sich eine "Woman" (Zeitschrift) an oder gehen in
den Garten oder gehen in (Wohnort) ins Caféhaus. Oder tun immer was. Und das,- Ich kann
ja nicht, möchte ja auch nicht die ganze Zeit,- Ich hab schon was gesucht, wo ich auch mich
freispielen kann." (Int. 12: 177)
Auf der Suche nach stundenweiser Entlastung wurde kurzzeitig auch der Besuch einer in der
Nähe befindlichen Tagesbetreuungseinrichtung in Erwägung gezogen. Die hohe Pflegebedürftigkeit der dort betreuten Personen ("weil da sind Leute, die müssen gefüttert werden") hinterließ jedoch bei Curt einen, wie er sagt, deprimierenden Eindruck, weshalb er von dieser Variante rasch Abstand nahm.
40
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Ähnlich wie Theresa versucht auch Curt, sich eine positive Lebenseinstellung zu bewahren.
Er ist bemüht, so gut wie möglich eine Normalität aufrechtzuerhalten und unternimmt nach wie
vor viele Aktivitäten (z.B. Konzertbesuche) gemeinsam mit seiner Frau. In diesem Sinne begreift er sich ungeachtet ihrer Demenzerkrankung in erster Linie nach wie vor als Partner und
Gefährte seiner Frau.
Curt: "Mein Gott, ich hab ein normales Leben weiter. Es ist nicht so, dass meine Frau zuhause
sitzt und Trübsal bläst. Wir waren erst vorgestern im Liederabend von (Name Sängerin), wir
haben die Woche ein paar Tage davor bei dem Konzert von dem (Name) Symphonie Orchester. Ich war, bevor ich operiert worden bin, mit ihr im Don Giovanni. Wir gehen ins Theater, ich
gehe auch zum Heurigen mit ihr." (Int. 12: 80)
Auch bei Sissi wurde die 24h-Betreuung anlässlich eines kürzlich erfolgten Krankenhausaufenthalts erforderlich. Diese wurde – ähnlich wie bei Curt und seiner Frau – von den Kindern
des Paares kurzfristig organisiert. Zudem leidet sie aktuell noch an den Folgen der Operation
und den damit verbundenen körperlichen Einschränkungen und kann pflegerische Tätigkeiten,
die Kraft erfordern, derzeit nicht ausführen.
Sissi: "Ich habe immer gehofft, dass, wenn es mir wieder besser geht, dass ich es alleine
schaffe, aber er ist manchmal so schwach beim Gehen, dass wir mit dem Rollstuhl fahren
müssen, und das kann ich nicht. Also ich kann ihn nicht alleine reinheben. Und vom Rollstuhl
ins Bett. Also das kann ich nicht machen." (Int. 17: 41)
Die Betreuung es demenzkranken Ehemannes gestaltet in mehrerlei Hinsicht als schwierig.
Neben den körperlichen Einschränkungen einschließlich der Inkontinenz, die eine intensive
Pflege erforderlich machen, stellen vor allem seine aggressiven Impulse eine große Herausforderung dar.
Sissi: "Er ist eher ruhig, nur in letzter Zeit wird er sehr aggressiv. Gestern hat er der (Name
Betreuerin) eine (macht Handbewegung).
Int.: Geschmiert?
Sissi: Ja." (Int. 17: 21f.)
Die beiden Söhne des Paares sowie die Schwiegertöchter stehen offenkundig in sehr engem
und nahezu täglichem Kontakt zu Sissi.
Int.: "Wie oft sind die hier?
Sissi: Na gut, der (Name älterer Sohn) wohnt momentan überhaupt bei uns. (…) Und sonst
kommen die Kinder, also die (Schwiegertochter) fast, wenn sie frei hat, jeden Tag, die (andere
Schwiegertochter) eigentlich auch, also die Schwiegertöchter. Und die Söhne, gut der (ältere
Sohn) natürlich jetzt jeden Abend, außer jetzt ist er gerade weg wieder, geschäftlich. Und der
(jüngere Sohn) schaut meistens auch einen Sprung vorbei, also wenn er vom Büro,- Der hat
da auch in der Nähe das Büro, also wo er arbeitet und kommt auch oft am Abend einen Sprung
vorbei und schaut auch, ist alles okay. Also anrufen fast jeden Tag." (Int. 17: 186ff.)
Die meiste Zeit des Tages verbringt Sissi allerdings alleine mit ihrem Mann und der 24h-Kraft.
Die 24h-Betreuung erfolgt im vierzehntägigen Wechsel durch eine Rumänin sowie einen jungen Slowaken. Während Sissi mit dem männlichen Pfleger gut zurechtkommt, gestaltet sich
das Zusammenleben mit der rumänischen Betreuerin mitunter weniger harmonisch. Darüber
hinaus stellt die ungewohnte ständige Präsenz der "fremden Leute im Haus" für sie eine große
Herausforderung dar. Im Interview wird deutlich, dass sie ihre Rolle in dem neuen Betreuungsgefüge noch nicht gefunden hat und die 24h-Betreuung nicht in ihrer Entlastungsfunktion für
sich nutzen kann. So gelingt es ihr nur sehr schwer, Verantwortung abzugeben. Die Pflegekraft
einfach "zwei, drei Tage allein" zu lassen, ist für sie im Augenblick noch schwer vorstellbar.
41
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Int.: "Nutzen Sie die Zeit, die Sie ja dadurch haben oder hätten für sich irgendwie?
Sissi: Wenig. Außer, dass ich also einkaufen gehe ab und zu, mit einer meiner Schwiegertöchter in die Shopping (City) fahre oder,- Zwei Stunden, mehr auch nicht. Nur habe ich jetzt,
also hab ich ein paar Sachen jetzt (holt Luft), mich angemeldet für Konzerte. Weil ich war
früher sehr oft in Konzert und Oper und hab mir gedacht, so, und das mach ich jetzt Also, ich
meine, es kostet ja viel Geld, und dass ich dann auch dasitze und (stockt) Also jetzt will ich
schon schauen, dass ich ein bisserl auch wenig,- Und mein Traum ist es (lacht ein bisschen),
dass irgendwann einmal, dass das so weit geht, dass ich sie zwei, drei Tage allein lasse und
einmal in eine Therme fahre. So ein Wochenende. Also meine Kinder haben gesagt, irgendwann also, wahrscheinlich ist das eh ein Muttertagsgeschenk, kann ich nicht sagen (beide
lachen) Und, na, werden wir sehen." (Int. 17: 80f.)
Während Curt und Sissi erst seit kurzem mit einer 24h-Betreuung im gemeinsamen Haushalt
leben und die ungewohnte ständige Anwesenheit einer fremden Person bisher als eine gewisse Belastung erleben, berichtet Arnold – seine Frau ist vor einem Jahr verstorben – von
einem durchwegs harmonischem Miteinander über einen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren
hinweg:
Arnold: "Und anfangs hatte ich dann eine Hilfe, die stundenweise kam, (…)also, bis es dann
notwendig war, eine 24-Stunden-Hilfe zu nehmen. Und das mit der 24-Stunden-Hilfe ist gut
gelaufen, das waren Frauen aus Polen. Und das war ein Wechsel von sechs bis sieben Wochen immer, die zwei. Und die beiden letzten waren dann fünf Jahre im Haus. Das waren zwei
sehr nette Frauen, und ich hab auch dafür Sorge getragen, dass sie sich wohlgefühlt haben
hier." (Int. 14: 23)
Eine wesentliche Rolle spielt dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit der Umstand, dass die Entscheidung für diese Betreuungsform von Arnold bewusst getroffen wurde und nicht aufgrund
einer akuten Notsituation kurzfristig organisiert werden musste. Aber auch Arnold war nicht
vor gewissen Anlaufschwierigkeiten gefeit:
Arnold: "Vorher hatte ich ein bisschen einen Wechsel, war aber nicht,- Eine fühlte sich überfordert, die hat das der (Name) abgegeben, und bei anderen waren es familiäre Verhältnisse
zuhause, die die Pflege aufgegeben haben." (Int. 14: 40)
Arnold berichtet von einer spürbaren Entlastung durch die damit verbundene Aufgabenteilung.
Arnold: "Aber grundsätzlich muss ich sagen, war das wirklich super. Die hat nämlich nicht nur
die Pflege meiner Frau übernommen, die hat mir das komplette Haus geführt. Sie haben gekocht, geputzt, gewaschen, gebügelt. Ich hatte den Garten, und das Haus war der Bereich
dieser Pflegerinnen." (Int. 14: 40)
Arnold war es besonders wichtig, ein möglichst angenehmes Arbeitsumfeld für die Pflegerinnen zu schaffen und diese nach besten Kräften ebenso zu unterstützen. So hat er etwa dafür
gesorgt, dass sie mit anderen polnischen Familien Kontakt hatten und sie auch z.B. bei der
Abwicklung finanzieller Angelegenheiten unterstützt.
Arnold: "Eine hat ja noch schulpflichtige Kinder, da war das dann auch mit dem Finanzamt,
mit dem Kindergeld und so weiter. Das hab ich alles für diese Frau erledigt. Die war sehr
zufrieden mit mir." (Int. 14: 42)
Die Wertschätzung, die er den Betreuerinnen auf diese Weise entgegengebracht hat, sieht er
als grundlegend für die hohe Pflegequalität an, die seitens der beiden Polinnen geleistet
wurde:
Arnold: "Sie ist ja dann im Krankenhaus verstorben, hatten die Schwestern auch gesagt, es
gab keine einzige Körperstelle, die gerötet gewesen wäre. Und ich führe das auch darauf
zurück, dass sich die Pflegerin bei mir wohlgefühlt hat und dass sie auch ein bisschen ein
Ahnung hatte, worauf es ankommt." (Int. 14: 38)
42
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Trotz der in der Praxis geteilten Verantwortung für das Wohl seiner Frau sieht sich Arnold
dennoch klar in der Position des Alleinverantwortlichen, der allein in optimaler Weise Sorge für
seine Frau tragen konnte, wie das nachfolgende Zitat belegt:
Arnold: "Ich habe also Hilfe nur gebraucht von ärztlicher Seite her, alles andere hab ich gemacht. Und das war natürlich, ich musste also immer anwesend sein. Weil, wenn es ein medizinisches Problem gab, konnte nur ich Auskunft geben. Ich glaube nicht, dass meine Frau,
wenn sie in einem Heim gewesen wäre, ihre Krankheit so lange gehabt hätte, dass sie so
lange gelebt hätte." (Int. 14: 44)
Diese zentrale Rolle, die Arnold in der Betreuung trotz der Inanspruchnahme einer "Rund-umdie-Uhr-Unterstützung" gespielt hat, wurde aufgrund seiner Argumentation auch von offizieller
Seite anerkannt, als Arnold um einen Urlaub für pflegende Angehörigen angesucht hat:
Arnold: "Das liegt gar nicht so lange zurück, drei, vier Jahre, gab es einen Möglichkeit, einen
Pflegeurlaub für pflegende Angehörige. (…) Und das ist eine Aktion (…) vom Sozialreferat,
dass also Leute, die sich darum bewerben, unter der Voraussetzung, dass sie pflegen, in
Anspruch nehmen können. Bei mir gab es das Problem, dass nicht ich allein meine Frau gepflegt hatte. Wenn eine 24-Stunden-Pflege da war, dann waren die Familienangehörigen davon ausgeschlossen, das in Anspruch zu nehmen. Und dann habe ich also der zuständigen
Projektleiterin versucht, das zu erklären, die ganze Situation. Dass ohne mich eine Pflege
überhaupt nicht stattfinden kann. Und dass bei dieser Art der Erkrankung, auch wenn eine 24Stunden-Pflege im Haus ist, immer noch so viel übrig bleibt für den Familienangehörigen wie
in einer niedrigeren Pflegestufe, meinetwegen, wenn der nur alleine wäre. Das hat der Frau
Dr. (Name) dann eingeleuchtet. Weil ich ihr erzählt habe, ‚Schauen Sie, ich war gerade am
Telefon, ich war jetzt zur Kontaktname bei der Ärztin von meiner Frau, das hat eineinhalb
Stunden in Anspruch genommen. Die Wartezeit und dann die eigene Konsultation und anschließend in die Apotheke. Und wenn ich dreimal in der Woche für meine Frau so eine Infusion anlege. Das ist ja etwas, was man bewerten kann. Da bleibt ja, und, und, und, noch so
viel übrig‘. Da hat sie gesagt, sie wird also meine Argumentation verwenden, um das möglich
zu machen. Und ich hab das dann gekriegt." (Int. 14: 192)
Insgesamt zweimal hat Arnold Kurzzeitpflege für seine Frau in Anspruch genommen, darüber
hinaus fallweise medizinische Dienste des Roten Kreuzes. Von weiteren informellen Hilfen
etwa aus dem Familienkreis berichtet Arnold nicht, äußert jedoch auch nicht, diese vermisst
zu haben. Die zwei erwachsenen Kinder wohnen in weiterer Entfernung und waren in die Betreuung nicht eingebunden.
4.1.3
Familiale Pflege: Nicht hauptverantwortlich
Diese Konstellation liegt nur in einem einzigen Fall vor und betrifft ein 17-jähriges Mädchen,
dessen Großmutter von Demenz betroffen ist.
Während die bisher vorgestellten Interviewpartner/innen, die mit der an der Demenz erkrankten Person zusammenleben (oder lebten), gleichzeitig allein oder gemeinsam mit anderen
Personen die Hauptverantwortung für die Betreuung tragen (trugen), hat Cornelia als Enkelkind eine andere Rolle inne. Die eigentlichen Betreuungsaufgaben werden von einer im 24hKraft sowie den Eltern des Mädchens erbracht.
Int.: "Da wollte ich eh noch fragen. Also deine Rolle in dem Ganzen, - also du hast jetzt da
nicht irgendwie nicht, dass du konkret irgendwas mithilfst? Also du brauchst da keine konkreten Sachen machen?
Cornelia: Nein. Manchmal, nur, wenn meine Eltern am Abend nicht da sind, helfe ich der Betreuerin, sie im Bett hochzu, - weil sie im Laufe des Tages halt runterrutscht. Weil, sie hat so
ein Bett, wo man die Lehne aufstellen kann. Im Laufe des Tages rutscht sie natürlich hinunter,
43
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
und da müssen wir sie Abend immer ein Stückchen aufheben. Und da helfe ich dann halt.
Aber sonst machen das meine Eltern." (Int. 03: 48f.)
Cornelia stattet der Großmutter zwar regelmäßig Besuche ab, diese verlaufen aber wenig
kommunikativ und beschränken sich zumeist auf gemeinsames Fernsehen. Cornelias Vater –
die von Demenz betroffene Person ist seine Mutter – drängt seine Tochter, sich mehr für die
kranke Großmutter zu engagieren. Die schulisch sehr eingespannte junge Frau (Maturajahr)
möchte ihre spärliche Freizeit aber nicht in diesem Ausmaß mit der Großmutter teilen.
Cornelia: "Es wirkt sich nur in dem Sinn aus, dass er halt immer will, dass wir öfter raufgehen.
Und ich halt prinzipiell sowieso schon nicht so viel Zeit habe und will jetzt auch nicht unbedingt
immer meine freie Zeit immer damit verbringen, auch, wenn das jetzt urgemein klingt. Aber
ich will jetzt trotzdem nicht meine freie Zeit damit verbringen, jeden Tag stundenlang bei ihr
zu sitzen, wenn sie nicht wirklich irgendwie (sucht nach Worten) – was davon mitbekommt."
(Int. 03: 63)
4.1.4
Nicht familiale Pflege: Wohnt in der Nähe
Zwei der Interviewpartner/innen leben bzw. lebten nicht im selben Haushalt, jedoch in der
Nähe des Erkrankten. Ebenso wie das Zusammenleben mit einem bzw. einer an Demenz erkrankten Angehörigen nicht zwangsläufig mit einer maximalen Involviertheit einhergehen
muss, ist die gemeinsame Wohnsituation nicht unbedingt eine Voraussetzung für dieselbe, wie
die beiden Fälle belegen.
Der alleinstehende Anton kümmert sich neben seiner Vollzeit-Erwerbstätigkeit in jeder
freien Minute liebevoll um seinen von Demenz betroffenen Vater, der in seiner Wohnung
im vierwöchigen Wechsel von zwei weiblichen 24h-Kräften aus Rumänien betreut wird. Unterstützung war nach dem Tod der Mutter notwendig geworden, diese konnte zu Beginn noch
durch mobile Dienste abgedeckt werden. Aufgrund der fortschreitenden Demenz und damit
verbundener Selbstgefährdung wurde jedoch eine permanente Betreuung notwendig. Diese
konnte der Sohn aufgrund seiner Erwerbstätigkeit nicht selbst leisten. Da der Vater eine Übersiedelung in ein Pflegeheim allerdings strikt ablehnte und auch generell der Ansicht war, keine
Hilfe zu benötigen, fiel die Wahl auf eine 24h-Betreuung:
Anton: "‚Du, Papa, nächste Woche, da hab schon wen bestellt, zieht jemand bei dir ein.‘ ‚Nein,
das brauch ich nicht, nein das möchte ich nicht.‘ Sag ich, ‚Papa, wirst sehen, wirst sehen,
Papa.‘ Ja. Wie er (?) dann gekommen ist, war er in Wirklichkeit eh Feuer und Flamme, weil
dann war es wirklich so, dass er wieder eine Ansprache hatte, dass jemand da ist, der mit ihm
gemeinsam was macht, der ihm jetzt praktisch auch die Einsamkeit nimmt. Ich meine, untertags wäre es nicht gegangen, da hätte ich nicht bei ihm sein können." (Int. 05: 31)
Während aufgrund der Demenzerkrankung eine Rollenumkehr im Vater-Sohn-Gefüge stattgefunden hat und es nun der Sohn ist, der Verantwortung für seinen Vater trägt, hat sich die
Beziehung an sich nicht verändert und ist nach wie vor von einer großen Nähe geprägt.
Neben der 24h-Betreuung hat Anton auch seine Schwester an seiner Seite, die zwar wenig in
den Betreuungsalltag eingebunden ist, jedoch wertvolle Unterstützung z.B. im Umgang mit
Behörden und bei anderen organisatorischen Angelegenheiten leistet. Anton hat Verständnis
dafür, dass sie zeitlich einen deutlich geringeren Anteil an der Betreuungsarbeit übernimmt,
da sie, eine alleinerziehende Mutter, ohnehin von ihrem Sohn, der "auch nicht immer so tut,
wie sie will", genug gefordert sei. Zu zwei noch lebenden Brüdern des Vaters, die ebenfalls
44
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
noch zur Familie gehören, besteht kaum ein Kontakt. Im folgenden Zitat gibt er Einblick in die
Aufgabenverteilung:
Anton: "Ja, also ich bin näher dran. Sagen wir so: Die Behördenfälle, die Behördenwege (…)
Bereiche, wo es um so Belange geht, wo die Krankenkasse wichtig ist, jetzt zum Beispiel der
Rollstuhl, das macht meine Schwester. Die ist da bei behördlichen Belangen sehr gut. (…)
Und ich bin der Teil, der eben an Ort und Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Das bin halt ich
eher. Der auch dann die schweren (…) Besorgungen macht. Weil ich gesagt habe, die (Name
Rumänin), sie geht schon auch manchmal ein bisserl einkaufen mit dem Papa, auch damit er
ein bisserl rauskommt. Aber die schweren Sachen – weil, sie muss sich um den Papa kümmern. Und das ist zu Fuß, und so hab ich gesagt, du die schweren Sachen, die Liste, die mach
ich, die tu ich abarbeiten. Die schweren Einkaufssachen oder auch die Windeln und die Windelslips oder Einlagen, das besorge ich, das mach alles ich. Und die Medikamente. Und sie
macht eher so die leichten Sachen, die am Weg liegen." (Int. 05: 77)
Es bereitet Anton augenscheinlich Freunde, Zeit mit seinem Vater zu verbringen, mit ihm z.B.
Karten zu spielen oder Ausflüge zu unternehmen. Während die Demenzerkrankung selbst dieses Gemeinsame kaum in negativer Weise zu prägen scheint, war es eine Prostataerkrankung
des Vaters, die eine sehr große Belastung für beide Seiten darstellte. So erwies sich der ständige Harndrang des Vaters als große Einschränkung für jegliche Freizeitaktivitäten. Die unsachgemäße Entfernung eines gesetzten Katheders durch den Betroffenen selbst, die mit einem "Blutbad" verbunden war, war schließlich Anlass für eine Prostataoperation, die jedoch
nur mit Schwierigkeiten umgesetzt werden konnte, da der demenzkranke Vater die erforderliche Zustimmung nicht geben konnte.
Sowohl die 24h-Betreuung als auch die Schwester erwiesen sich in dieser Situation als wichtige Stütze. Anton weiß die Kooperation und gegenseitige Unterstützung bei der Betreuungsaufgabe sehr zu schätzen.
Anton: "Ja, Aufgabenteilung, ja da ist der Kooperationspunkt ein sehr wichtiger. Wenn man
weiß, man kann sich auf den anderen verlassen, auch wenn weder der alles kann, noch umgekehrt. Ich schon gar nicht alles kann. Aber wenn man es sich ausmacht, dass wir uns drauf
verlassen können, dass das dann auch geschieht. Oder, dass man sich zumindest bemüht.
Ja, Aufgabenteilung, das ist Entlastung. Notwendige Entlastung, ja. Wie gesagt, wenn ich allein wäre, puh. Ich hätte schon manchmal nicht mehr gewusst, was ich machen soll." (Int.
05:73)
Mit dem Wegfall dieser Problematik ist nun auch wieder eine deutlich höhere Lebensqualität
für beide Seiten verbunden:
Anton: "Man tät gern manches erleben auch wieder. (Lebhaft:) Es geht jetzt vielleicht eh wieder. Mein Vater hat immer, wenn ich komme, so Ideen, was er alles machen will. Jetzt noch
Riesenrad fahren und Boot fahren. Und beim Riesenrad hab ich gesagt, ‚du, Papa, aber da
kannst du nicht aufs Klo gehen im Riesenrad.‘ Ach so.‘ Sag ich, ‚nein im Riesen-‚ Da hat er
noch so oft aufs Klo gehen müssen. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Das heißt,
wenn es Frühling wird." (Int. 05: 85)
Marie hat zunächst als Jugendliche noch mit ihrer Mutter und dem an Demenz erkrankten Vater zusammengelebt, ist dann aber ausgezogen. Sie hat also als junge Erwachsene
die fortschreitende Demenzerkrankung ihres Vaters bis zu dessen Tod miterlebt. Im Mittelpunkt ihrer Erzählungen steht vor allem die schwierige Situation der Mutter, die den Vater unter
großen Entbehrung bis zuletzt hauptverantwortlich gepflegt hat:
Marie: "Für sie war es extrem schwer, das heißt, auch für mich, weil sie natürlich ihren Frust
bei mir abgeladen hat. Also sie hat sich um ihn gekümmert, und es war furchtbar für sie. Es
war irrsinnig anstrengend. Er hat ja auch nicht kooperiert oder so. Also sie musste natürlich
die Windeln wechseln und so. Das war dann gottseidank so, dass wir dann übers Hilfswerk
45
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
eine mobile Pflege hatten, die halt so ein bisschen zur Hand gegangen ist. Das war dann
schon ein bisschen eine Erleichterung. Aber man muss sich halt vorstellen, er musste dann
auch am Ende gefüttert werden, und das ist halt, man hat halt dann wirklich,- Sie hatte halt
wirklich eine Last quasi zu tragen." (Int. 08: 26)
Die schwierige Situation der Mutter hat Marie sehr belastet und sie mit großer Sorge um ihre
Mutter erfüllt:
Int.: "Hättest du damals dir vorstellen können, dass er in ein Pflegeheim geht?
Marie: (überlegt) Ja. Also ich habe schon meiner Mama oft gesagt, weil ich einfach gesehen
habe, dass sie daran zerbricht. Also ich habe mir sehr viel Sorgen gemacht um meine Mutter,
weil sie war ja auch nicht mehr die Jüngste. Einfach, weil sie halt ihr Leben komplett eigentlich
fast aufgegeben hatte." (Int. 08: 38f.)
Obgleich die Mutter offenkundig unter der Situation litt und die Tochter sie drängte, externe
Hilfe anzunehmen, war die Mutter nicht bereit, Verantwortung abzugeben. Lediglich mobile
Dienste wurden in Anspruch genommen. Die Aufnahme in ein Pflegeheim sowie eine 24hBetreuung lehnte sie jedoch trotz der – nach Einschätzung der Tochter – sehr guten finanziellen Lage als "unfinanzierbar" ab. Auch das "Was würden die Leute sagen" stellte laut Marie
eine unüberwindliche Hürde für die Mutter dar.
In dem Verhalten der Mutter ihrer Tochter gegenüber kam das Ausmaß ihres Leidensdrucks
ebenso wie eine regelrecht selbstschädigende Aufopferungsbereitschaft deutlich zum Ausdruck. Dies spiegelt ein Vorfall in drastischer Weise wider:
Marie: "Und sie hatte dann einen Glaukom-Anfall. Sie hat uns aber erst,- also am Abend hatte
sie den Glaukom-Anfall, und sie hatte uns erst dann in der Früh darüber berichtet. Dann sind
wir ganz schnell mit ihr ins Spital, weil da kannst du ja erblinden. Und der Arzt hat dann gesagt,
ja, warum sie nicht früher gekommen ist. Sie hat enorm Glück gehabt. Also, wenn das länger
noch angedauert hätte, wäre sie jetzt blind. Ja, und dann habe ich halt einmal mit ihr gesprochen und habe gesagt, ‚Ja wieso hast du das riskiert?‘ Hat sie gemeint, ‚Na, wenn ich blind
bin, dann kann der Papa ins Pflegeheim, weil dann verstehen die Leute, dass ich ihm nicht
mehr helfen kann.‘ Also muss man sich vorstellen, wie sehr sie das eigentlich belastet hat. Sie
hätte in Kauf genommen, blind zu werden, damit ihr diese Last genommen wird. So in etwa
kann man sich dann vorstellen, was es bedeutet, einen demenzkranken Menschen zu pflegen,
bis er stirbt." (Int. 08: 30)
Die zunehmende Überforderung der Mutter bedingte allerdings zunehmend eine ständige Rufbereitschaft der Tochter, da die Mutter dem Vater im Falle eines Sturzes nicht mehr alleine
aufhelfen konnte. Auf diese Weise wurde auch Maries Alltag zum Teil erheblich beeinträchtigt:
Marie: "Ich hatte dann Geburtstag, und da hatte ich halt eine Party, da waren meine besten
Freunde da. Und dann hieß es irgendwann, ‚Papa ist niedergefallen, bitte kommen.‘ Und ja,
ich meine, ich will nicht egoistisch sein, aber natürlich, die Stimmung war dann weg, die sind
dann nach Hause. Wir haben uns halt dann gekümmert um meine Mama und um den Papa
und so. Also es war schon immer dieser Einschnitt auch so. Du bist immer auf Abruf bereit,
wenn was passiert. Wenn ich irgendwo war, ich musste nur Handy läuten lassen, weil, wenn
irgendwas passiert, dann musste ich da sein." (Int. 08: 30)
4.1.5
Nicht familiale Pflege: Wohnt in größerer Entfernung
Vier Personen mit einem/einer demenzkranken Angehörigen leben in größerer Entfernung zu
diesem/dieser. Es handelt sich dabei um Elisabeth (Int. 02), Lena (Int. 06), Zita (Int. 10) und
46
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Annika (Int. 11). Wie die folgenden Ausführungen deutlich machen sollen, ist es nicht die Entfernung, die ausschlaggebend für Nähe und Distanz, das Gefühl der Verantwortlichkeit oder
Abgrenzung ist.
Die Mutter von Elisabeth lebt in einem anderem, weiter entfernten Bundesland. Obwohl zwei
Brüder in unmittelbarer Nähe leben, einer davon sogar im selben Haus wie die Mutter, sieht
Elisabeth sich klar als die hauptverantwortliche Person im Betreuungsgefüge, vor allem
was organisatorische Fragen betrifft. Sie telefoniert nahezu täglich mit der Mutter und gibt
an, allein für die Organisation der Pflege (z.B. Pflegegeldbezug, Hauskrankenpflege) zuständig zu sein. Außerdem fährt sie einmal im Monat zu ihr. In einer Reihe von Äußerungen
macht sie ihrem Ärger über die Brüder Luft, die ihrer Ansicht nach ihrer Verantwortung nicht
nachkommen, sich zu wenig um die Mutter kümmern und sich darauf verlassen, dass die
Schwester alles regelt:
Int.: "Sagen Ihre Brüder sowas wie ‚ich möchte jetzt nicht mehr, warum können wir nicht…‘
weiß ich nicht. Thema Heim oder Thema andere Hilfe. Gibt es da so Äußerungen?
Elisabeth: Nein, das nicht. Nein, nur ‚ich möchte jetzt nicht mehr‘ oder ‚ich kann nicht‘. ‚Ich hab
auch ein Leben‘. Abgrenzung total.
Int.: Und was wäre die Alternative? Gibt es da eine Alternative, die die Brüder haben?
Elisabeth: Nein. Das muss dann alles ich machen.
Int.: Ach so.
Elisabeth: Ja. Sie zeigen nur auf, was alles nicht funktioniert sozusagen und was sie alles
nicht können. (kurze Pause) Und ich handle dann."
(Int. 02: 157ff.)
Einmal täglich erhält Elisabeths Mutter Besuch von der Hauskrankenpflege, die sich u.a. um
die Tablettengabe kümmert. Dreimal pro Woche wird warmes Essen von einem nahen Gasthaus geliefert. Die Demenz ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass eine Rund-um-die-UhrBetreuung erforderlich ist, sie ist etwa auch noch in der Lage, ihre Haustiere zu versorgen. Es
fällt ihr allerdings zunehmend schwerer, eine Tagesstruktur aufrecht zu erhalten.
Elisabeth: "Und sonst versuchen wir sie zu motivieren selbständig sich etwas aufzuwärmen
zumindest. Also wir haben ihr auch fertiges Essen organisiert, das in so Rex-Gläsern drinnen
ist, oder Weck-Gläsern sagt man dazu. Bio, und halt halbwegs gute Qualität, was sie sich nur
aufwärmen muss. Und das muss man ihr halt alles lernen. Tagesablauf, Rhythmus. Also sie
hat kein Zeitgefühl mehr. Sie frühstückt dann oft erst um drei am Nachmittag und so. Oder hat
schon ihre Abläufe, was ihre Tiere ihr quasi auch geben. Sie versorgt den Hund, die Vögel,
die Katzen. Also die Katzen, die draußen leben in der Holzhütte, der Hund, der ein ganz wichtiger Part geworden ist für sie. Genau. Und so halt." (Int. 02: 48).
Wie sich der Betreuungsalltag für die Brüder (insbesondere den im selben Haus lebenden)
gestaltet und in welcher Form und in welchem Ausmaß sich diese nun konkret einbringen,
bleibt jedoch weitgehend im Dunkeln. Deutlich wird auf jeden Fall, dass die erbrachten Betreuungsleistungen wechselseitig nicht wirklich wahrgenommen und/oder wertgeschätzt werden.
Lena wohnt auch weit von ihrem Vater entfernt, im Gegensatz aber zu Elisabeth, ist dieser
räumliche Abstand gewollt, und sie engagiert sich bewusst nicht in der Betreuung und hat
eine distanzierte Beziehung zu ihrem Vater. Lena hat ihren Vater erst mit 16 Jahren kennen
gelernt, es hat nie eine enge Vater-Kind-Beziehung bestanden. Im Zuge der beginnenden Demenzerkrankung des Vaters kam es allerdings kurzfristig zu einer Annäherung zwischen den
beiden.
47
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Lena: "Ich hab ihn auch erst mit 16 kennen gelernt, also hatte da immer ein eher distanziertes
Verhältnis zu ihm. Wir sind allerdings dann nochmals mehr zusammen gewachsen 2014,
dadurch, dass ich recht viel bei ihm war und ihn da sehr unterstützt habe." (Int. 06: 45)
Lena lebte damals in der Nähe ihres Vaters und half ihrer Großmutter, den ebenfalls an Demenz erkrankten Großvater zu pflegen.
Int.: "Wie war denn die Situation damals? Habt ihr zusammen gewohnt?
Lena: Nein, wir haben nicht zusammen gewohnt. Ich hab in der Nähe gewohnt, also schon
zehn Minuten bloß weg. Das heißt, ich war immer schnell dort und konnte auch nach der
Arbeit oder einfach an freien Tagen immer mal vorbei gehen, was ich relativ oft gemacht
habe." (Int. 06: 22f.)
Gleichzeitig war und ist der Vater vor Ort sehr gut in ein soziales Netz eingebunden und erhält
insofern sehr viel Unterstützung seitens der Nachbarn und der Gemeinde, als ihm beispielsweise Aufgaben übertragen werden, die, wie Lena meint, "eigentlich nicht benötigt werden",
die er aber trotz seiner Demenz noch erfüllen kann. Andere Formen der Betreuung lehnt er
allerdings strikt ab, da er sich selbst nicht als krank empfindet.
Int.: "Du hast jetzt gesagt, es gibt ein paar Personen so in (Ortsname), die ihn unterstützen.
Wer ist das und was machen die so für ihn?
Lena: Das ist also einmal eine Bekannte von ihm, die er durch den Hund,- die gehen jeden
Tag zusammen spazieren. Er wird finanziell viel unterstützt dort, also er ist da wirklich toll
sozial eingebunden, sag ich mal. Viele Leute, die ihn,- also, was ich eine ganz tolle Sache
finde, er putzt zum Beispiel dort im Rathaus. Und eigentlich kann er das nicht mehr, aber er
leert dann halt die Mülleimer und so, und wird so praktisch in eine Aufgabe noch eingebunden.
Finde ich persönlich zum Beispiel sehr schön. Oder auch bei Theateraufführungen dort macht
er die Abendkasse oder hilft ein bisschen bei der Requisite. Also alles Aufgaben, die eigentlich
nicht benötigt werden, aber wo die Menschen schon gucken, dass sie ihn einbinden und ihm
so ein bisschen das Gefühl geben, nicht ganz unwichtig zu sein." (Int. 06: 62f)
Lena war und ist jedoch nach wie vor offenbar die einzige familiäre Bezugsperson für ihren
Vater und verspürt daher trotz der fehlenden Bindung eine gewisse Verpflichtung, sich um den
Vater zu kümmern, die sie jedoch wegzuschieben versucht, da auch er sich nie um sie bemüht
hat. Nicht nur von ihrem Vater selbst, sondern auch von anderen Personen erlebt sie sich nach
wie vor diesbezüglich unter Druck gesetzt:
Lena: "Ja, also er hatte jetzt auch einen Schlaganfall vor zwei Monaten, und dann hat sein
Arzt und Bekannter mich angerufen und mir ein ziemlich schlechtes Gewissen gemacht, dass
er mich brauchen würde, und er wär so ein guter Mensch. Also da ist schon natürlich Druck
da. Weil er auch, also mein Vater auch mich so hinstellt, als wäre ich die Einzige, die er noch
hat. Gut, das bin ich vielleicht, aber,- (lacht kurz) – als hätte er ganz, ganz viel schon für mich
gemacht. Also er ist jemand, der sich auch immer gerne in Mitleid gesuhlt hat, muss man dazu
sagen. Und das hat er am Anfang auch ein bisschen ausgenutzt, (…) das kommt natürlich
dazu. Aber so der Druck, der ist da, sicher." (Int. 06: 55)
Obgleich Lena und ihr Vater zu Beginn, wie sie sagt, durch Lenas Unterstützung "nochmals
mehr zusammen gewachsen" sind, ließ das Verhalten des Vaters keine wirkliche Verbesserung der Beziehung zu. Insbesondere seine aggressiven Ausbrüche führten immer wieder zu
Konflikten.
Lena: "Es war einfach, er ist dann sehr aggressiv gegen mich geworden, hat mich auch persönlich sehr angegriffen oftmals, was natürlich alles eine Folge der Demenz ist. Ich habe ihn
dann auch zu einer Therapeutin begleitet. Also teilweise waren dann Sachen, dass wir zusammen einkaufen waren, und er war wütend über sich, weil er irgendwas nicht mehr wusste.
Dann hat er mich mit dem Einkaufswagen angefahren. Oder, also lauter solche Dinge." (Int.
06: 31)
48
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Den ohnehin geplanten Umzug Lenas in eine weit entfernte Stadt in einem anderen Bundesland ergriff Lena als willkommene Gelegenheit, "das dann so ein bisschen auslaufen (zu) lassen". Lena schwankt zwischen Mitleid und Verständnis einerseits und klarer Distanzierung
andererseits, kommt aber zu dem klaren Schluss, dass eine Verbesserung der Beziehung
aufgrund der Demenz und der grundlegenden Charakterstruktur des Vaters nicht möglich ist:
Lena: "Ich hab ihm das,- also ich hatte viel Streit mit ihm, dass ich das, also dass er sich ein
bisschen zurückhalten muss und nicht immer so aggressiv sein soll. Und ich hab einfach gemerkt, dass das nichts bringt, also dass das von ihm aus charakterlich wie auch mit der Demenz jetzt zu nichts führt und dass ich da nicht weiterkomme. Und dann hab ich letztendlich
das einfach,- ich wäre eh umgezogen, und hab das dann so ein bisschen auslaufen lassen.
Wo ich auch denke, ja, ihn da unnötig zu verletzen wäre auch nicht gut gewesen." (Int.06: 51)
Nach dem Umzug ist der persönliche Kontakt bis auf wenige Telefonate alle paar Wochen (es
ist immer der Vater, der sich meldet), abgebrochen.
Zitas Situation wiederum ist sehr ähnlich der von Elisabeth: Sie kümmert sich um die weiter
entfernt lebende Mutter, obwohl diese anderweitig von ihrem Bruder versorgt wird und
hat zudem das Vorhaben, die Mutter dauerhaft zu sich zu holen. Zitas Mutter lebt zum
Befragungszeitpunkt zusammen mit ihrem Mann in einem anderen Ort in einem angrenzenden
Bundesland und wird von ihrem Sohn (Zitas Bruder) und dessen Lebensgefährtin aus Zitas
Sicht mehr schlecht als recht betreut. Die familiären Beziehungen zwischen den Mitgliedern
von Zitas Herkunftsfamilie sind durch massive Konflikte geprägt, insbesondere zu ihrem Bruder, der die Vorsorgevollmacht für beide Elternteile besitzt und diese nach Zitas Aussagen
missbraucht hat, besteht ein gespanntes Verhältnis.
Die Mutter leidet seit etwa sieben Jahren an Alzheimer-Demenz. Zita ist mit der Situation sehr
unzufrieden und möchte ihre Mutter unbedingt zu sich holen. Sie macht sich große Sorgen um
ihre Mutter, die nach ihrem Verständnis an ihrem jetzigen Wohnort nicht gut aufgehoben ist.
Zita: "Sie sprechen ihr, weil die kognitiven Fähigkeiten weitgehend verloren gegangen sind,
auch die Gefühlsebene ab und ignorieren die einfach. Es redet keiner mit ihr, sie artikuliert
von sich aus keine Wünsche, man muss ihr mehrere Optionen anbieten, und dann kann sie
wohl wählen, was sie davon haben möchte. Aber sie würde zum Beispiel von sich aus nicht
mehr sagen, sie möchte so gern die Enkelkinder sehen. Aber wenn man sie fragt, ‚Magst du
mal die Enkelkinder besuchen?‘ ‚Ja, gern.‘ Und das ignoriert mein Bruder sehr. Also sie ist
auch zum Teil wirklich verwahrlost gewesen. Als ich sie jetzt nach mehreren Monaten, wo ich
sie nicht abholen konnte, dann abholen konnte, waren die Zehennägel zwei Zentimeter lang
und zum Teil eingewachsen, aufgerollt. Solche Dinge, also wirklich hässliche Sachen, wo sie
meinen Vater sehr gut pflegen und meine Mutter aber völlig vernachlässigen. Und die sich
selber nicht mehr artikulieren kann. Das ist die Situation gerade." (Int. 10: 19)
Obgleich Zita und ihre Familie vor einiger Zeit auch die Großmutter von Zitas Mann bei sich
aufgenommen haben und pflegen und Zita neben ihren drei Kindern im Alter von 15, 8 und 4
Jahren auch erwerbstätig ist, würde es eine große Erleichterung für sie bedeuten, ihre Mutter
zu sich nehmen zu können, da sie sie dann "gut versorgt" wüsste.
Zita: "Also, hm (überlegt), erleichternd ist sicher ganz einfach nur für mich, weil ich weiß, dann
ist sie gut versorgt. Und ich traue mir einfach zu, ein Gefühl dafür zu haben, wie es ihr geht.
Und das klingt jetzt vielleicht total arg, aber das traue ich meinem Bruder und auch meinem
Vater und dessen Freundin, also der Freundin meines Bruders, schon gar nicht zu. Dann weiß
ich sie gut versorgt, das ist mir wichtig. Also auf einer emotionalen Ebene, körperlich sowieso,
auf einer Gefühlsebene." (Int. 10: 39).
Zwischen Zita und ihrer Mutter besteht ein enger und herzlicher Kontakt. Seit "unser Ältester
49
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
auf die Welt gekommen ist", d.h. seit fast 15 Jahren kommt die Mutter jede Woche auf Besuch,
zu Beginn, um Zita bei der Kinderbetreuung zu unterstützen. Obgleich Zita ihre Mutter aufgrund der Demenzerkrankung mittlerweile nicht mehr mit den Kindern alleine lassen möchte
(sie vergisst beispielsweise, ihnen ein Essen zuzubereiten), erlebt Zita sie noch immer als
Entlastung, was die Kinder betrifft.
Zita: "Dass sie uns eigentlich Arbeit abnimmt, weil die Kinder mit ihr spielen, das versteht sie
nicht, weil ‚das ist ja keine Arbeit! Das ist doch nicht anstrengend! Das sind doch Kinder, ich
tue tu doch nichts, ich sitz doch nur da!‘ ‚Nein, Mama, du rennst mit dem (Name eines Kindes)
durch den Garten, sie reden beide gleichzeitig mit dir‘. Also so, das meine ich. Das ist einfach,
das ist Leben für sie. Das ist nicht anstrengend. Mir sind meine Kinder schon manchmal wirklich anstrengend. Aber meiner Mutter nehme ich das auch wirklich glaubhaft ab, dass das,Mit dem fühlt sie sich wohl." (Int. 10: 37)
Nachdem die Mutter bei einem Besuch nicht am vereinbarten Ort erschienen ist, holt Zita sie
nun am Freitag von ihrem Wohnort ab und verbringt das Wochenende mit ihr, allerdings unter
massiver Gegenwehr des Bruders:
Zita: "Das heißt, ich fahre am Freitag nach (Ortsname) in der Früh, hole sie ab, dann sind wir
am Freitagvormittag mehr oder weniger alleine oder machen gemeinsam kleine Besorgungen.
Dann kommen zu Mittag die Kinder von Schule und Kindergarten nach Hause, und dann ist
sie das restliche Wochenende bei uns, und am Sonntag am Abend bringe ich sie wieder nach
Hause. (…)
Int.: Hat sich Ihr Bruder versucht dagegen zu wehren, dass Sie Ihre Mutter zu sich holen?
Zita: Ja. Ja, massiv. Massiv. Also das ist völlig lächerlich, aber ich musste dort mit dem Anwalt
gemeinsam das Haus betreten, damit ich sie überhaupt abholen konnte. Jetzt hat sich das
mehr oder weniger etabliert. Also wir hatten jetzt erst dreimal die Situation, dass klar ist, dass
der Sachwalter angeordnet hat, dass ich sie am Freitag immer abholen darf. Das hat die letzten Male funktioniert. Aber beim ersten Mal war das ein schlechter Film." (Int. 10: 15; 20-21)
Zita hat ein Pflegschaftsverfahren angestrengt und ist zuversichtlich, die Übernahme der Sachwalterschaft für ihre Mutter gerichtlich durchsetzen zu können. Ob dies nun auch gleichzeitig
bedeutet, dass sie die Mutter zu sich nehmen kann, ist allerdings noch mit der Unsicherheit
behaftet, ob die Mutter bereit ist, ihren Mann (Zitas Vater), den Zita als cholerisch und wenig
einfühlsam beschreibt, zurückzulassen.
Zita: "Und vielleicht, das werde ich erst sehen, selbst wenn ich die Sachwalterschaft habe,
vielleicht wird es so, dass es ein ähnlicher Besuchskontakt bleibt, weil sie eben merkt, sie
kann auch noch nicht von meinem Vater weg, solange der noch lebt. Also es ist von ihr aus
ganz klar ausgesprochen, wenn es den nicht gibt, kommt sie sofort zu uns, wenn sie darf."
(Int. 10: 37)
Das letzte Fallbeispiel für Pflege aus Distanz ist das von Annika. Sie ist erwerbstätig und besucht zweimal im Monat für ein Wochenende mit ihrem Mann ihre demenzkranke Mutter, die
in Annikas Elternhaus in einem anderen Bundesland etwa eine Autostunde entfernt lebt. Sie
wechselt sich dabei in der Betreuung wöchentlich mit ihrem Bruder ab. Wie wichtig sie aber
für ihre Mutter in ihrer jetzigen Verfassung ist, kann sie nicht beurteilen. "Natürlich sind
wir wichtig". Aber: "Ob wir jetzt an erster Stelle, kann ich jetzt nicht sagen."
Für die tägliche Betreuung steht eine 24h-Kraft aus Rumänien zur Verfügung, die, anders als
sonst üblich, nicht im zweiwöchigen oder monatlichen Takt wechselt. Lediglich, wenn die Betreuerin Urlaub nehmen möchte, wird sie von ihrer Schwiegermutter vertreten. Annika steht
der Betreuerin etwas ambivalent gegenüber, da sie nicht sicher ist, ob die Mutter bei ihr auch
wirklich gut betreut ist, da sie ihr manchmal nicht genug Aufmerksamkeit widmet.
50
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Für Annika stellen die regelmäßigen Besuche durchaus eine Belastung dar, da viele Arbeiten
zu erledigen sind, die von der 24h-Kraft nicht wahrgenommen werden.
Annika: "Aber trotzdem ist es, ja, für mich, also manchmal ist mir das schon auch zu viel. Aber
mein Mann geht eh auch mit. Aber trotzdem ist es auch zeitaufwendig. Weil dann brauchen
wir am Samstag fast den ganzen Vormittag, weil wir das dann doch in (Bundesland) einkaufen,
um nicht von (Bundesland) alles mitzuschleppen. (…) Ja. Und jetzt im Garten, ich meine, der
Garten ist schon relativ groß, da teilen wir uns halt auch die Arbeit." (Int. 11: 67)
Die Betreuung der Mutter belastet auch Annikas Ehe, es gibt "schon oft sehr große Meinungsverschiedenheiten", dennoch stellt er eine wichtige Unterstützung für Annika dar und verweigert letztendlich nur sehr selten die regelmäßigen Besuche.
4.1.6
Nicht familiale Pflege: Heimbetreuung
Die Schwiegermutter von Lisa (Int. 01) sowie die Ehepartner von Patrizia (Int. 13) und Felix
(Int. 16) werden in einem Pflegeheim betreut. In allen drei Fällen ist eine hauptverantwortliche
familiale Betreuung vorausgegangen, "bis es nicht mehr gegangen ist".
Die Schwiegermutter von Lisa ist erst vor ein paar Monaten in ein Pflegeheim übersiedelt. Als
die Entscheidung dazu fiel, war die demenzkranke Frau noch mobil, bedurfte aber einer ständigen Beaufsichtigung, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen oder "Schaden anzurichten",
indem sie etwa wahllos unreifes Gemüse erntete oder die Tiefkühltruhe aussteckte. Zudem
stürzte sie häufig, was auch immer wieder mit Krankenhausaufenthalten verbunden war.
Unterstützung erhielt die Familie durch einen mobilen Dienst, der unter der Woche regelmäßig
in der Früh für eine Stunde in Anspruch genommen wurde und insbesondere die Körperpflege
übernahm, sowie durch zwei Frauen, die jeweils stundenweise einsprangen, wenn Lisa und
ihr Mann gleichzeitig abwesend waren.
Als die Situation für die Familie nicht mehr bewältigbar erschien, wurde um einen Platz in
einem nahen Pflegeheim angesucht. Rund zwei Monate nach Antragsstellung brach sich die
alte Frau bei einem Sturz den Knöchel. Nach der Versorgung im Krankenhaus wurde sie wieder nach Hause geschickt. Lisa und ihr Mann waren mit der Situation völlig überfordert, da die
demente Frau immer wieder versuchte, das Bett entgegen der ärztlichen Anweisung zu verlassen.
Lisa: "Ja. Dann haben wir drei Nächte hintereinander so gut wie überhaupt nicht geschlafen,
weil, sie hat einen Liegegips gehabt und hat nicht aufstehen dürfen. Na super. Jetzt hat sie
aber in der Nacht ständig randaliert, sie muss aufstehen, aufs Klo gehen. Super, ja. Ja, wir
haben dann die Türe ausgehängt und vors Bett gestellt, damit sie nicht raus kann, ja? (lacht
etwas) Also ganz freiheitsberaubende Maßnahme. Ganz radikal. (…)– also Notlösung quasi.
Also diese drei Tage oder Nächte waren wirklich eine Katastrophe. Ich habe dann ein Babyphon ausgeborgt mit so einer Videokamera. Und da hat man dann ständig gesehen, wie sie
da dagegen tritt. Und wir waren ständig unten, oben, das war eine Katastrophe." (Int. 01:107)
Als eben in dieser Notsituation ein Heimplatz frei wird, ist die Erleichterung groß:
Lisa: "(…) habe ich dann angerufen bei der Bezirkshauptmannschaft, ob sie wissen, wie lange
das noch dauern wird mit einem Heimplatz. Weil jetzt akut eben das Problem ist mit dem
gebrochenen Knöchel. Und dann sagt mir die: Ja, vor fünf Minuten hat sie gerade eine Meldung reingekriegt, dass in (Ortsname) ein Platz frei ist, ja? Und in dem Moment bin ich Tränen
ausgebrochen, ja? Aber wirklich total. Also so richtig – das war echt pfff, also Wahnsinn!" (Int.
01: 223)
51
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Der Übergang ins Heim gelang besser als erwartet, womit eine zentrale Befürchtung der Familie, wie die demenzkranke Frau mit dem Umzug zurechtkommt, zerstreut wurde Die Knöchelverletzung erwies sich dabei insofern als hilfreich, als diese als Begründung herangezogen
werden konnte.
Lisa: "Wobei das mit dem gebrochenen Knöchel, so blöd es klingt, in dem Sinn gut war, weil
dadurch der Übergang ins Pflegeheim einfach war. Weil, so hat man es ihr als KrankenhausReha quasi ein bisschen verkaufen können, also dass sie dort jetzt hin muss, weil sie sich den
Fuß gebrochen hat. Und so ist das sehr fließend gegangen. Weil, mit dem hat sie sich dann
zufrieden gegeben einfach." (Int. 01: 139)
Lisa und ihre Familie fahren zweimal in der Woche zum Pflegeheim, welches rund 30 km vom
Wohnort der Familie entfernt ist. Da das aus der täglichen Rund-um-die-Uhr-Belastung resultierende "ständige Genervtsein" nun wegfällt, erlebt Lisa auch die Beziehung zu der kranken
Frau als wesentlich entspannter und ist in der Lage, sich ihr in dieser begrenzten Zeit wirklich
zuzuwenden:
Int.: "Und wie oft seht ihr sie?
Lisa: Also zumindest irgendeiner von uns, - also zweimal in der Woche fährt jemand von uns.
(…)
Int.: Und wie lange seid ihr dann da?
Lisa: Ja, eine gute Stunde auf jeden Fall. Und das ist aber toll, das ist einfach ganz anders als
vorher. Weil, in der Stunde kann man sich wirklich mit ihr beschäftigen. Und es ist total entspannt – für beide Seiten! Für alle." (Int. 01: 142ff)
Nach anfänglichen Schwierigkeiten ("Nehmt’s mich mit heim?‘) hat sich die Schwiegermutter
offenbar gut im Heim eingelebt und erfährt dort aus Lisas Sicht auch eine ideale Betreuung.
Lisa: "Also die ersten Wochen waren ein bisschen schwierig, weil sie immer, sobald wir gekommen sind, gesagt hat: 'Nehmt's mich mit heim?' Und natürlich war das am Anfang schwierig, also vor allem für meinen Mann. Und weil wir auch nicht gewusst haben, ob das so bleibt.
Und das hat sich dann aber nach einigen Wochen wirklich gelegt. Also sie freut sich total,
wenn man kommt. Und wenn man dann sagt, ja, man geht, dann, ja, passt." (Int. 01: 141)
Auch Patrizia hat ihren Mann mittlerweile in ein Pflegeheim gegeben. Er litt "seit mindestens
zwei Jahren" an Demenz. Sie hat jedoch bereits vor 20 Jahren – damals erlitt ihr Mann einen
Schlaganfall – Verantwortung für in übernommen und ihr Leben nach seinen Bedürfnissen
ausgerichtet.
Patrizia: "Ja, die Partnerschaft, die war völlig anders, schon seit 20 Jahren, aus dem einfachen
Grunde, weil ich versucht habe, ihm alles abzunehmen. Weil ich immer gedacht hab, dies und
jenes kann er nicht, also mach ich das. Er hat nach wie vor Holz aus der Holzhütte geholt zum
Heizen. Wir haben da so einen großen Kachelofen. Und hat auch Schnee geschoben, obwohl
er das nicht sollte. Aber ansonsten waren die Aktivitäten eingeschränkt, weil ich hab ihn auch
nicht gelassen." (Int. 13: 113)
In den letzten Jahren entwickelte Patrizias Mann zunehmend aggressive Verhaltensweisen
und wurde auch handgreiflich seiner Frau gegenüber, ohne sie jedoch zu verletzten ("ich war
immer schneller"). Ein von der Schwiegertochter initiierter Aufenthalt in der Alterspsychiatrie
und eine damit verbundene Medikamenteneinstellung verbesserte die Situation soweit, dass
sich Patrizia entgegen der Ratschläge ihrer Familie und des Hausarztes entschloss, ihren
Mann wieder zu sich nach Hause zu holen und selbst zu betreuen.
Patrizia: "Und dann sagte meine Schwiegertochter, ‚Jetzt sag mal, was du eigentlich möchtest!‘ Und da hab ich gesagt, ‚Die ganzen letzten vierzehn Tage war er immer sehr lieb und
52
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
nett und aufgeschlossen. Und ich kann mir nicht vorstellen, ihn in ein Heim zu geben! Ich
denke, ich tu ihm Unrecht. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance, wir probieren es einfach!‘
So, haben wir dann gemacht. Es war wirklich eine schöne Zeit." (Int. 13: 14)
Die zunehmende körperliche Gebrechlichkeit ihres Mannes, die dazu führte, dass er mehrmals
stürzt und nach einem Krankenhausaufenthalt gehunfähig ist, machte letztendlich aber die
Aufrechterhaltung der häuslichen Pflege unmöglich. Patrizia berichtet, dass ihr sehr wohl bewusst war, dass letztendlich kein Weg an dieser Entscheidung vorbei führen würde:
Patrizia: "Und außerdem war ich dieses ganze dreiviertel Jahr, das wir noch zusammen hatten, war ich mir immer mehr und mehr bewusst, dass es nicht dauern wird. Dass es irgendwann anders sein muss. Dass er irgendwann wirklich ins Heim geht." (Int. 13: 161)
Ihre Familie, insbesondere Sohn und Schwiegertochter, aber auch die weit entfernt lebende
Tochter sowie eine Schwägerin waren und sind eine wesentliche Unterstützung für Patrizia.
Immer wieder wurde sie von ihren Angehörigen, aber auch von ihren Freunden ermuntert,
"auch auf sich selbst zu schauen" und sich zu einer Heimunterbringung ihres Mannes zu entschließen. Nicht nur der Zuspruch ihrer Familie, sondern auch der Vortrag eines bekannten
Lebensberaters bestärken sie in der Überzeugung, sich nicht für ihre Entscheidung schuldig
fühlen zu müssen. Patrizia ist nun gerade dabei, sich mit Hilfe ihrer Kinder in der neuen Situation zurechtzufinden und "wieder ein richtiges Leben zu beginnen":
Patrizia: "Und, ja, nun ist er also da in dem Heim, und ich fange gerade an, mich daran zu
gewöhnen (…). Ich gehe nach wie vor zur Therapeutin, die mir letzten Donnerstag gesagt hat,
‚Jetzt gehst du aber da nicht jeden Tag hin, sondern tust das, was du tun möchtest und gehst
vielleicht einmal die Woche hin!‘ Ist mir gar nicht so leicht gefallen! Ich üb das jetzt gerade
(lacht) Aber ich komme jetzt endlich auch wieder zum Arbeiten und kann mich um (Arbeitsbereich) kümmern. Ja. Und ich fange an, wieder ein richtiges Leben zu beginnen. Und meine
Kinder helfen mir sehr dabei." (Int. 13: 16).
Felix‘ Frau, die an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, lebt seit etwa einem Jahr in einem
Pflegeheim in unmittelbarer Nähe zum früheren Wohnort. Davor wurde sie etwa vier Jahre von
ihrem Mann betreut. Als Grund für die Übersiedelung ins Pflegeheim gibt Felix an, der Zeitpunkt sei gekommen, als seine Frau ihn abzulehnen begann. Anders als bei Lisa oder Patrizia
wird hier nicht in so offenkundiger Weise eine zunehmende Belastung und Überforderung
sichtbar, die diesen Schritt letztendlich unausweichlich erscheinen ließen. Während die beiden
Töchter des Paares die Entscheidung des Vaters für das Pflegeheim voll und ganz unterstützt
haben, stieß sie bei der Familie der Frau auf große Ablehnung.
Felix‘ Frau erhält nicht nur von Felix, sondern insbesondere von den Töchtern sowie von
Freunden regelmäßig Besuch. Felix beschreibt, wie die Besuche im Allgemeinen ablaufen. Da
die täglichen Mahlzeiten eine besonders aufwändige Angelegenheit für das Personal darstellen, kommt dem Eingeben des Essens eine wichtige Funktion zu. Darüber hinaus werden Spaziergänge mit der demenzkranken Frau unternommen, um wieder eine gewisse Mobilität zu
gewährleisten, da der Pflegealltag im Heim auch dafür wenig Zeit lässt.
Felix stellte, als seine Frau noch zuhause lebte, offenkundig die Hauptbezugsperson dar, im
aktuellen Betreuungsgefüge bleibt seine Rolle jedoch ein bisschen unklar. Er selbst spricht
von einem "Radl" von sieben Personen, durch das ein nahezu täglicher Besuchsdienst gewährleistet werden kann. Inwieweit er fixer Bestandteil dieses "Radls" ist, geht aus seinen
Aussagen nicht klar hervor. Er "springt halt ein, wenn die anderen keine Zeit haben".
53
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Int.: "Und wie oft sehen Sie sie?
Felix: Ja, wir haben da jetzt ein so ein Radl eingerichtet mit Freunden und mit meinen Töchtern
und ich halt, da gehen wir halt, jeden Tag ist halt fast jemand drin. Meine Tochter geht heute
wieder rein. Und halt also hauptsächlich bei der Essenseingabe. Entweder,- mittags und
abends haben wir sie, meistens ist wer drinnen von uns.
Int.: Aber das ist ja viel. Dann hat sie ja jeden Tag Besuch fast.
Felix: Sie hat, also zurzeit hat sie sicher fast jeden Tag Besuch von uns.
Int.: Und wie groß ist das Radl, also wie oft sehen Sie sie?
Felix: Ja, ich meine, ich spring halt dann ein, wenn die anderen keine Zeit haben. Wenn irgendwo was ausfällt, bin halt ich dabei. Ja, das Radl ist so, dass wir,- Wieviel Personen sind
wir (rechnet nach), eine Freundin, zwei, drei, vier, fünf, sechs und einer, sieben kann man
sagen." (Int. 16: 36ff.)
Während die beiden Töchter in der Zeit, als die Mutter zuhause betreut wurde, in den Erzählungen von Felix kaum in Erscheinung treten und der Eindruck entsteht, dass Felix die Betreuungsarbeit nahezu ausschließlich alleine geleistet hat, nehmen sie jetzt, da die Mutter im Pflegeheim ist, einen umso zentraleren Stellenwert ein.
4.2
Inanspruchnahme einer 24h-Betreuung
Eine 24h-Betreuung wurde, wie im vorigen Abschnitt dargestellt, einerseits für alleinlebende
Angehörige organisiert (Anton, Annika), andererseits für den Partner bzw. die Partnerin, mit
dem/der man im gleichen Haushalt lebt (Curt, Arnold, Sissi). Nur in einem Fall (Cornelia) war
die 24h-Betreuung in einen größeren Familienverband eingebunden.
Im Folgenden werden nun die Gründe und Auslöser, die zur Inanspruchnahme einer 24h-Betreuung geführt haben, näher beleuchtet. Daran anschließend wird ein Einblick in die Erfahrungen der Angehörigen mit dieser Form der Unterstützung gewährt.
4.2.1
Gründe und Auslöser
Im vorangegangenen Abschnitt wurden bereits Auslöser und Gründe angesprochen, die dazu
geführt haben, dass eine 24h-Pflege in Anspruch genommen wurde. In diesem Kapitel erfolgt
eine Zusammenfassung der damit in Zusammenhang stehenden Argumente.
4.2.1.1 Allein lebende Person kann nicht mehr alleine gelassen werden
Bei fortschreitender Demenz kommt es bekanntlich zu einer zunehmenden Einschränkung der
kognitiven Funktionen einschließlich des Urteilsvermögens. Dieser Umstand bedingt eine zunehmende Notwendigkeit, die Aktivitäten der erkrankten Person zu ihrer eigenen Sicherheit
ständig im Blick zu haben und laufend zu kontrollieren. Dies ist bei allein lebenden Personen,
auch wenn sie von mobilen Diensten betreut und von ihren Angehörigen regelmäßig besucht
werden, nicht gewährleistet. Dies kann zu Situationen führen, die mit einem erheblichen Schaden für den oder die Betroffene/n verbunden sein können. Anton beschreibt verschiedene Vorfälle, die als typisch für Personen mit einer dementiellen Erkrankung gelten können. So konnte
er bei einem Besuch bei seinem Vater gerade noch eine Überschwemmung verhindern, da
dieser nach dem Kochen vergessen hatte, den Wasserhahn abzudrehen. Weiters berichtet
Anton von der Angewohnheit des alten Mannes, unkontrolliert Essen einzukaufen und zuhause zu horten:
Anton: "Es war nicht mehr zu verantworten. Also wenn ich zum Beispiel erzähle: Sein Tick
war, dass er immer etwas zum Essen kauft. Er tut immer alle Hebel in Bewegung setzen, dass
54
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
er sich die Mittagsportion kauft vom Fleischhauer vom ortsansässigen, vom (Name), das Mittagsmenü. Dann geht er aber noch zu einem anderen, zum Schnitzel-Schnellimbiss, und holt
sich dort Berner Würstel mit Pommes frites. Und kauft aber dann noch beim Fleisch- und bei
anderen Geschäften, kauft ein, kauft ein, kauft ein. Und hortet das. (…) Also, wir haben einmal
die Karte weggenommen und gesagt, nein Papa, du, wir kaufen, wir gehen gemeinsam einkaufen. Du brauchst jetzt nicht jeden Tag was zum Essen kaufen. ‚Nein, und warum nicht?‘
Und dann ist er ohne Bankkarte zur Bank gegangen, hat aber immer noch Geld bekommen,
weil die von der Bank haben gesagt, sie kennen ihn. Und wenn es sein Konto ist, dann müssen
sie es ihm geben, mit oder ohne Bankkarte. Na gut, dann hat aber die Bank in (Name Ortsteil)
eh zugesperrt, und ich hab dem Papa gesagt, ‚Du, probieren wir es einmal, weißt du was,
wenn jemand da einzieht bei dir. Was hältst du davon?" (Int. 05: 29)
4.2.1.2 Alleinige Betreuung ist nicht mehr zu bewältigen
Mit fortschreitendem Krankheitsverlauf und steigendem Pflegebedarf, oder aber, wenn die betreuende Person selbst gesundheitlich eingeschränkt ist, kann die Betreuung zuhause mitunter ohne umfassende professionelle Unterstützung nicht mehr geleistet werden.
Im Falle von Curt und Sissi machten eigene Erkrankungen schnelles Handeln erforderlich,
um die Betreuung des/der dementen Partner/in sicherzustellen. Beide geben übereinstimmend
an, dass sie die Betreuung sonst weiterhin mit Unterstützung mobiler Dienste alleine hätten
leisten können. Beide hätten diese Variante von sich aus nicht gewählt, sind sich jedoch bewusst, dass es – zumindest in der aktuellen Situation – keine geeignete Alternative gibt.
Int.: "Seit wann haben Sie denn die 24-Stunden-Hilfe? Ist es eine 24-Stunden-Hilfe?
Sissi: Ja, wie ich im Krankenhaus war, haben die Kinder das also ganz schnell organisieren
müssen.
Int.: Also ganz neu.
Sissi: Ja, ja. Haben dann,- Na, weil ich gesagt habe, ich schaff das alleine, also es dann in
der Nacht zwei-, dreimal aufstehen. Manchmal dass ich,- Ja, dann hat er sich angemacht und
dann hab ich ihn überreden können, eine Hose zu nehmen, Unterhose zu nehmen, hab eine
Einlage reingegeben eine große. Dann ist das wieder gegangen eine Zeit. Und ich hab das
eigentlich schon alles geschafft. Und hätte es wahrscheinlich auch länger, wenn es mich nicht
erwischt hätte." (Int. 17: 28ff.)
Mitunter wird die professionelle Unterstützung durch eine 24h-Kraft aber auch dann erforderlich, wenn die Betreuung aufgrund des Ausmaßes der Pflegebedürftigkeit nicht mehr von
der Familie alleine abgedeckt werden kann. Dies ist umso gravierender, wenn der Partner oder
die Partnerin die Alleinverantwortung für die Betreuung trägt, wie es bei Arnold der Fall war.
Mit zunehmendem Pflegeaufwand waren Haushaltsführung und Betreuung nicht mehr alleine
zu bewältigen:
Arnold: "Und anfangs hatte ich dann eine Hilfe, die stundenweise kam (…),also, bis es dann
notwendig war, eine 24-Stunden-Hilfe zu nehmen. (…) Es ist dann leichter jemanden zu pflegen, wenn es zwei Personen gibt. Dann fällt ja viel weg, viel anderes, nicht. Das Einkaufen,
Medikamentenversorgung, Kontakt mit dem Arzt." (Int. 14: 23)
4.2.1.3 Andere Betreuungsalternativen werden abgelehnt
Wenn die Notwendigkeit einer kontinuierlichen professionellen Betreuung der von Demenz
betroffenen Person gegeben ist – aus welchen Gründen auch immer – stehen Angehörige
zumeist vor der Entscheidung, ob eher eine 24h-Pflege in Frage kommt oder doch die Übersiedlung in ein Pflegeheim die beste Lösung darstellt. Nicht selten fällt die Entscheidung für
die 24h-Betreuung dann aus dem Grund, weil das Pflegeheim von den Angehörigen und/oder
der zu pflegenden Person abgelehnt wird. Da die Gründe gegen eine Heimunterbringung an
55
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
anderer Stelle ausführlich behandelt werden, wird hier allerdings nicht genauer darauf eingegangen.
4.2.2
Positive Erfahrungen und Aspekte
Im Wesentlichen werden von den befragten Personen drei Aspekte hervorgehoben, die im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer 24h-Betreuung als positiv erlebt werden. Neben der spürbaren Entlastung, die so eine Hilfe mit sich bringt, wird die Professionalität der
Betreuungspersonen geschätzt. In manchen Fällen entwickelt sich zwischen der Pflegekraft
und der Familie der demenzkranken Person eine herzliche und enge Beziehung. Arnold beispielsweise merkt im Interview an, dass es "beinahe schon den Charakter einer Familie angenommen hat". Im Folgenden werden diese Aspekte mit einigen Beispielzitaten aus den Interviews illustriert.
Entlastung: "Dann fällt ja viel weg"
Arnold: "Und das mit der 24-Stunden-Hilfe ist gut gelaufen, das waren Frauen aus Polen. (…)
Das waren zwei sehr nette Frauen, und ich hab auch dafür Sorge getragen, dass sie sich
wohlgefühlt haben hier. Es ist dann leichter jemanden zu pflegen, wenn es zwei Personen
gibt. Dann fällt ja viel weg, viel anderes, nicht. Das Einkaufen, Medikamentenversorgung, Kontakt mit dem Arzt." (Int. 14: 23)
Professionalität: "Es klappt wie am Schnürl"
Curt: "Es klappt eigentlich alles recht gut. Es läuft eigentlich schon sehr viel wie am Schnürl
ab, das muss ich schon sagen. Die können alle was. Die erste, die war ja,- Erstens sprechen
sie beide deutsch gut, die Erste war lange, die war sechs Jahre lang in Salzburg bei einem
Geistlichen. Und die kennt sich in Österreich aus, die weiß überall Bescheid. Sie kennen sie
ja nicht, die (Name 24-Stunden-Kraft). Und sie auch, die ist auch schon lange im Geschäft."
(Int. 12: 144)
Eine enge Beziehung: "…und das war sozusagen seine Familie."
Anton: "Alles, was man da macht, das ist dann eben die 24-Stunden-Betreuung dabei, ist
eingebunden in die Familie. Es ist jetzt nicht so, dass es entweder so oder Familie ist, sondern
es geht ja alles eh gemeinsam. Man kann auch Ausflüge machen manchmal. (…) Beim Bootfahren zum Beispiel haben wir eh eine Gaudi gehabt. Da waren die Kinder nämlich auch gerade da, und das ist wiederum gut für meinen Papa (…)
Int.: Ist ja fast so ein bisschen wie Familie, oder?
Anton: Eben. Eben, ja. Er ist dann eben der Opa gewesen, und das war sozusagen seine
Familie. Hat ihm auch irrsinnig Freude gemacht. Und für meinen Vater eine Erweiterung des
Betätigungskreises, und er lernt wieder Leute kennen, sie wieder. Und da haben wir dann
eben auch Ausflüge gemacht. Das war eigentlich lustig." (Int. 05: 136ff.)
4.2.3
Negative Erfahrungen und Aspekte
Auch einige negative Erfahrungen im Rahmen der 24h-Betreuung zuhause durch eine externe
Betreuungsperson wurden berichtet. So dauert es mitunter, bis die ideale Kraft gefunden ist,
wie es etwa bei Anton oder Arnold ("eine fühlte sich überfordert") der Fall war, die letztendlich
aber beide diese Anfangshürde gemeistert haben.
56
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
In manchen Fällen kommt es auch zu einer – zumindest anfänglichen – Ablehnung der Betreuungskraft durch die zu betreuende Person, was zum Teil auch auf die mangelnde Krankheitseinsicht zurückzuführen ist. In seltenen Fällen kann sich die Ablehnung durch den Kranken, wie bei Sissis Mann, sogar in Handgreiflichkeiten entladen.
Ein weiterer negativer Aspekt wird von Annika, deren Mutter in einem anderen Bundesland
von einer 24h-Kraft betreut wird, eingebracht. Annika macht sich Sorgen, ob ihre Mutter von
der Betreuerin auch die Aufmerksamkeit erhält, die sie benötigt. Da sie die meiste Zeit selbst
nicht vor Ort ist, kann sie dies nur schwer kontrollieren. Ein Dorn im Auge ist Annika die ständige Beschäftigung der Betreuerin mit ihrem Smartphone. Auch hier sollen zur Illustration einige Beispielzitate einen direkten Einblick geben.
Die Richtige/n finden: "Ach nein, um Gottes Willen, jetzt hab ich einen zweiten Pflegefall!"
Anton: "Dann hab ich eine 24-Stunden-Pflege kommen lassen, die erste. Die war aus einem
sehr entlegenen Dorf in Rumänien. Ich habe bei, das war eine Online-Firma, die das vermittelt
hat, da habe ich angekreuzt ‚mit Deutschkenntnissen‘. Weil da hat es gegeben ‚Anfängerkenntnisse‘ und dann ‚mit fortgeschrittenen Kenntnissen‘ und dann ‚native speaker" praktisch.
Und ich hab angekreuzt ‚fortgeschrittene‘. Und dann ist eine gekommen, die kaum Deutsch
können hat. Das erste, was ich gesagt habe, wie sie gekommen ist, ‚gehen wir anmelden zur
Gemeinde, weil heute hat sie offen.‘ ‚Häh?‘ ‚Anmelden, anmelden‘ hab ich gesagt. ‚Also mit
Papieren, anmelden.‘ ‚Häh? Nix verstehen.‘ Hab ich mir gedacht, ‚Ach nein, um Gottes Willen,
jetzt hab ich einen zweiten Pflegefall!‘ So war es dann. Aber nach der kamen dann zwei andere durch private Vermittlung. Also das ist immer noch die Mundpropaganda, das Beste.
Durch private Vermittlung zwei andere. Und das funktioniert jetzt super zum Glück. Sonst wäre
es nicht gegangen mehr." (Int. 05: 29)
Mangelnde Akzeptanz: "Sie soll nach Hause gehen!"
Int.: "Wie war die 24-Stunden-Hilfe für sie? Wie kann sie die,- oder ist das für sie? Kann sie
die annehmen?"
Annika: "Naja, die ersten Monate nicht. Also das war schon schwierig. Wenn ich gekommen
bin am Freitag, dann hat sie immer gesagt, ‚Naja, die kannst du jetzt eh nach Hause schicken,
weil die brauchen wir jetzt nicht. Was macht sie da? Ich kann ja alleine auch meine Medikamente nehmen.‘ (…). Und das war, jedes Wochenende hat sie dann natürlich über die Frau
auch geschimpft, ‚Und die macht eh nichts, und warum ist sie da? Und sie soll nach Hause
gehen!‘ Aber sie hat sich dann daran gewöhnt, ja. Mittlerweile, ja, passt das." (Int. 11: 22f)
Handgreiflichkeiten: "Er hat ihr eine geschmiert."
Sissi: "Nein, nein. Er ist eher ruhig, nur in letzter Zeit wird er sehr aggressiv. Gestern hat er
der (Name Betreuerin) eine (macht Handbewegung?)
Int.: "geschmiert."
Sissi: "Ja." (Int. 17: 21ff.)
Apropos Betreuungsqualität: "…ob sie sich dann mit ihr auch beschäftigt"
Annika: "Nur ob sie sich dann mit ihr auch beschäftigt oder halt,- Das weiß ich nicht. Das
beschäftigt mich schon, und ich habe schon oft auch zu ihr gesagt, weil sie tut sehr gern,- "
(deutet mit den Fingern Tippen auf dem Smartphone an)
Int.: "Handy?"
Annika: "Ja. Und das ist halt schon ein bisserl,- Aber jetzt am Wochenende, also wenn wir
kommen, dann ist das Handy jetzt nicht mehr am Tisch."
Int.: "Haben Sie ihr das gesagt?"
57
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Annika: "Ja. Weil es mich einfach stört. Ich meine, ich kann nicht den ganzen Tag nur am
Handy schauen, ob jetzt wer geschrieben,- Sie tut ja dauernd auch, hat sie geschrieben und
so. Ich habe es ihr ja öfters gesagt. Und jetzt ist seit, glaub ich einem halben Jahr oder so hat
sie es wirklich begriffen, dass,- Ja. Nur, wie gesagt, wir sind ja fünf Tage nicht da, nicht. (Int.
11: 75ff.)
Einer gesonderten Betrachtung bedarf die Situation von Sissi, die erst seit kurzer Zeit mit einer
24h-Kraft, die ihren dementen Ehepartner pflegt, unter einem Dach lebt. Sissi hat bisher überwiegend negative Erfahrungen gemacht, die sich in verschiedener Weise manifestieren. Die
eigentlich intendierte Entlastungsfunktion kommt nicht zum Tragen, da sich Sissi und die Betreuungsperson wechselseitig als Störfaktor wahrnehmen. Sissi empfindet den Umstand, nicht
mehr alleine zu sein, als "schrecklich" und fühlt sich durch die erzwungene Anpassung an die
Vorstellungen und Regeln der Pflegerin unter Druck gesetzt und an den Rand gedrängt, ohne
die Möglichkeit zu haben, sich zur Wehr zu setzen. Mit der Pflegeaufgabe ("Ich darf ja nicht
helfen") wird ihr auch ihre Rolle als Ehefrau gleichsam abgesprochen. So wird ihr der gewohnte Gute-Nacht-Kuss vom Pflegepersonal untersagt, damit er "eben auch einschläft, ohne
von mir verabschiedet zu werden". Sissi nimmt diese Maßnahmen der "Entwöhnung" in ihrer
gegenwärtigen Situation hin. Zum einen besteht die Angst, dass sonst "keine bleibt", zum anderen scheint auch die Agentur die Ansichten der 24h-Kräfte zu unterstützen. Ein weiterer
Problembereich betrifft die täglichen Mahlzeiten. Weder die Art der Zubereitung, noch die Esskultur der Betreuerin entspricht Sissis Vorstellungen und Gewohnheiten.
Die folgenden Zitate dokumentieren die schwierige Pflegesituation:
24 Stunden mit einer fremden Person: "Man ist nicht mehr allein"
Int.: "Und jetzt? Also wie ist das jetzt für Sie mit der Hilfe?
Sissi: Schrecklich.
Int.: Schrecklich?
Sissi: Ja, man ist nicht allein mehr." (Int. 17: 32ff.)
Anpassen an einen fremdem Rhythmus: "Sonst bleibt uns keine"
Sissi: "Und die (Name Pflegerin) ist eben bis um dreiviertel zehn oder was, dann geht sie
hinüber und richtet alles her, und um zehn muss er schlafen gehen. Und da hab ich auch
schon etliche Male eben gesagt, ‚Er ist gewöhnt, er ist ein Spät-Schlafengeher gewesen. Er
ist nie vor elf, halb zwölf schlafen gegangen‘. Und ja, das kannst du nicht machen.
Int.: Das geht dann nicht wegen der Arbeitszeit wahrscheinlich.
Sissi: Na, ich weiß es nicht. Mir sagt zwar von der Agentur, die Frau (Name) sagt mir immer,
sagt sie ‚Naja, die müssen sich nach Ihnen richten!‘ Aber gut, das will ich auch nicht natürlich.
Sonst bleibt uns keine. Naja." (Int. 17: 77ff.)
Erzwungener Rollenwechsel: "Das wird jetzt nicht mehr toleriert"
Sissi: "Nur also mit Klo gehen und am Abend schlafen gehen ist eine Katastrophe. Tageweise
geht es, da lässt er sich ins Bett bringen, weil man muss ihn ja waschen vorher und umziehen.
Und die wollen ja alle nicht, dass ich,- Ich darf ja nicht helfen.
Int.: Ach so, das machen dann komplett die.
Sissi: Geht manchmal nicht. Manchmal schreit sie dann und geht nicht. Er ist ihr schon zweimal umgefallen, na gut, dann braucht sie mich auch. Ich durfte nichts heben, jetzt geht es
wieder natürlich. Aber (flüstert) sie beschwert sich dann bei meiner Schwiegertochter und
sagt, ja, sie weiß nicht, ob sie da bleibt, weil also mit mir kann sie nicht. Sag ich, ‚Warum bitte?‘
Ich tue ihr nichts, ich leg ihr nichts in den Weg. Nur wenn ich frage, ‚Kann ich dir helfen?‘ Also
sitzt das schon irgendwo. Ist ein bisserl schwierig das Ganze. Aber es ist halt so, wie gesagt,
58
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
ich lasse sie jetzt und sage eben, ‚Wenn du mich brauchst, rufst du mich‘ und aus. Ich bleibe
glatt sitzen und lese, wenn sie sich abstrampelt. Also ich kann das nicht so, weil dass sie dann
im Hinter-Ding sagt, also ich lasse sie nichts alleine machen, das mag ich nicht." (Int. 17: 37ff.)
Eine Frage der Esskultur: "Da vergeht’s mir"
Int.: "Das heißt, Sie kochen.
Sissi: Teilweise, ja.
Int.: Und sie auch teilweise, oder?
Sissi: Also nein, ja, für sich. Weil sie isst wieder andere Sachen. Sie isst Polenta und sie isst
alles mit viel Milch, und in die Milch kommen Nudeln rein, in die Milch kommt Reis rein. Gut,
Milchreis kennen wir auch. Und dann mit sehr viel Kakao drauf. Also das ist halt nicht unsere
Art, und (flüsternd) das will ich auch nicht, dass er das, weil sonst wird er zu dick." (Int. 17:
158ff.)
Int.: "Essen Sie dann eigentlich gemeinsam zu dritt, oder wie geht das?
Sissi: Sie geht meistens da herein.
Int.: Und Sie beide in der Küche
Sissi: Ja, ja, in der Küche. (…) Aber sie geht ja hinein, aber das macht mir eigentlich auch
nichts, weil (imitiert ein Schmatzen beim Essen)
Int.: Da isst sie nicht so,Sissi: (sehr leise flüsternd) Da vergeht’s mir." (Int. 17: 162ff.)
4.3
Inanspruchnahme der Heimbetreuung
Professionelle Betreuung in einem Pflegeheim wird in drei Fällen in Anspruch genommen.
Analog zu oben wird auf die Gründe und Auslöser und im Anschluss daran auf die praktischen
Erfahrungen mit dieser Betreuungsform eingegangen.
4.3.1
Gründe und Auslöser
4.3.1.1 Alleinige Betreuung nicht mehr zu bewältigen/verantworten
Wie bereits weiter oben angeführt, ist der Übersiedelung ins Pflegeheim bei allen betroffenen
Personen eine intensive Betreuung in der Familie vorausgegangen. Sowohl Lisa als auch Patrizia berichten übereinstimmend, dass die Grenzen der Belastbarkeit im Grunde schon lange
weit überschritten waren, ehe die Entscheidung für das Heim fiel. Patrizia hat ihren Mann seit
seinem Schlaganfall vor 20 Jahren im Alltag massiv unterstützt und dafür große Einschränkungen für ihr eigenes Leben in Kauf genommen. Aufgrund der mit der Krankheit in Verbindung stehenden aggressiven Ausbrüche waren etwa auch die Sozialkontakte stark beeinträchtigt.
Als er zunehmend pflegebedürftig wird und immer häufiger stürzt und nach einem Krankenhausaufenthalt auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist die Betreuung durch sie alleine schon
durch die körperliche Überforderung nicht mehr aufrechtzuerhalten:
Patrizia: "Und da haben sie ihn ungefähr eine Woche im Krankenhaus behalten, und als er
dann zurückkam, konnte er nicht mehr gehen. Er konnte stehen, ich musste ihn aus seinem
Bett hochziehen in so einen Stuhl, den mir irgendjemand gebracht hatte, mit so kleinen Rädern. Dann hab ich ihn ins Bad gefahren und auf und nieder und so weiter. Und ich muss
Ihnen sagen, nach einer Woche waren meine Kräfte hinüber. Und ich hatte mich vorher schon
erkundigt nach dem (Name Heim), (…) Und dann hab ich ihn erstmal für 28 Tage, soviel Urlaub hätte mir zugestanden, auf Kurzzeitpflege dort hingebracht, und das geht jetzt in die
Langzeitpflege über. Weil ich konnte es nicht mehr bewältigen." (Int. 13: 14)
59
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Auch bei Lisa und ihrer Familie waren die Grenzen der Belastbarkeit zum Zeitpunkt der Übersiedelung ins Heim eigentlich schon überschritten. Auch hier fällt die sehr lange Zeitdauer auf,
über die hinweg die Angehörigen mit den kognitiven und verhaltensbezogenen Konsequenzen
der Demenzerkrankung des/der Betroffenen zurechtkommen mussten. So musste etwa über
viele Jahre hinweg täglich ein rigides Abendritual, das u.a. das Kontrollieren aller Steckdosen
umfasste, eingehalten oder die Küchenbank mehrmals täglich daraufhin überprüft werden, ob
sich ein Tier darin eingenistet hat.
Obgleich die Familie insbesondere durch diese Verhaltensauffälligkeiten verbunden mit dem
"ständigen Angebundensein" eine permanente Überforderung erlebte, sind es im Endeffekt
zwei andere zentrale Gründe, die von Lisa als ausschlaggebend für die Übersiedelung ins
Pflegeheim angeführt werden. Ein wesentlicher Punkt war, dass es sich vor allem aufgrund
der hohen Sturzgefahr als zunehmend schwierig herausstellte, die Sicherheit der alten Frau
zu gewährleisten:
Lisa: "…dass wir immer mehr das Gefühl gehabt haben, das ist eine tickende Zeitbombe, dass
einmal etwas passiert. Also dass sie die Stiegen runterfällt oder dass sie sich verletzt." (Int.01:
139)
Kurz vor der eigentlichen Übersiedelung tritt tatsächlich das Befürchtete ein: Die alte Frau
stürzt und bricht sich dabei den Knöchel. Obgleich die Sache vergleichsweise glimpflich ausgeht, ist sie seit diesem Zeitpunkt auf einen Rollstuhl angewiesen.
Als zweiter Aspekt wird von Lisa angeführt, dass die Schwiegermutter aufgrund der Überforderung der Angehörigen inmitten der Familie zu vereinsamen drohte:
Lisa: "Und der zweite Punkt war, dass wir gemerkt haben, sie vereinsamt da quasi neben uns.
Weil eigentlich war der Aufwand rundherum so derartig groß, dass man sich nicht einfach nur
zu ihr setzt und sich so mit ihr beschäftigt, weil dafür einfach überhaupt keine Kapazitäten
mehr da waren. Also zeitlich nicht und nervlich auch nicht." (Int. 1: 135)
Ähnlich wie bei Patrizia waren es auch hier zuerst Außenstehende, die erkannten, dass die
Grenzen der häuslichen Betreuung erreicht waren. Während in Patrizias Fall insbesondere die
erwachsenen Kinder sie dazu drängten, ihren Partner in einem Pflegeheim betreuen zu lassen,
kam in Lisas Fall ein wichtiger Impuls von Seiten des unterstützenden mobilen Dienstes.
Lisa: "Und eigentlich war es dann so: Also vom Hilfswerk kommt einmal im Monat so eine, die
das quasi beobachtet und schaut, ob alles passt. Und die hat dann gesagt: 'Was tun wir? Das
geht so nicht mehr.' Also die hat das dann auch gesagt, dass es eigentlich so nicht mehr geht."
(Int. 01: 135)
60
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.3.1.2 Ablehnung der betreuenden Person
Auch Felix hat seine Frau über mehrere Jahre hinweg liebevoll gepflegt. Für ihn fällt die Entscheidung für ein Pflegeheim, als sie ihn zunehmend ablehnt. Diese Ablehnung zeichnete sich
schon längere Zeit vor dieser Entscheidung ab. So berichtet er von Situationen, in denen sie
fremden Personen offenbar mehr Vertrauen entgegenbrachte als ihm.
Felix: "Und da hat sie halt immer angefangen dann bei diesen Sachen, dass sie dann schon
zeitweise gesagt hat, ‚Geh weg, lass mich in Ruhe!‘ und so getan hat, als ob sie mich nicht
kennen würde. So auf die Art. So ein bisserl eine Aversion. Und wenn ein Fremder hingegangen ist, ist sie mitgegangen. (…) Und ich hab gesagt, ich werde es halt so lange machen,
derweil ich merke, dass sie mich auch akzeptiert und derweil das noch funktioniert. Und im
letzten Jahr, wie das nachher aufgekommen ist, hat sich das ein bisserl verschlechtert. (…)
Für mich war dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ‚Jetzt lehnt
sie mich eigentlich ab, und ich will das nicht noch verstärkt mehr miterleben‘." (Int. 16: 24)
Im Fall von Patrizia und ihrem Mann kam es ebenfalls in gewisser Weise zu einer krankheitsbedingten Aversion gegen die Betreuungsperson, die sich in aggressivem Verhalten bis hin zu
Handgreiflichkeiten des Erkrankten gegenüber seiner Frau äußerte. Dies hatte zwar (noch)
nicht die dauerhafte Aufnahme in ein Pflegeheim zur Folge, jedoch die Einweisung in eine
alterspsychiatrische Einrichtung, da Patrizia eine weitere Betreuung zu Hause ablehnte.
Patrizia: "Er war auch handgreiflich, aber ich war immer schneller. Er konnte mir nichts tun,
aber ich bin sehr wütend geworden, wenn er so war und hab gedacht, ‚Oh mein Gott, das
kann ja auch nicht das Richtige sein!‘ Also ich wurde richtig böse. Und dann, als er in dieser
Alterspsychiatrie war, die haben ihn dort behalten, weil ich gesagt habe, ich kümmere mich
nicht mehr. Dann wurde er eingestellt mit Tabletten." (Int. 13: 10)
4.3.1.3 Finanzielle und organisatorische Gründe
Auf diesen Aspekt wird in im Abschnitt betreffend die Gründe gegen Inanspruchnahme formeller Angebote genauer eingegangen.
4.3.2
Positive Erfahrungen und Aspekte
Bei den positiven Aspekten, die in Zusammenhang mit der Betreuung in einem Pflegeheim
berichtet werden, ist einerseits der Entlastungsaspekt, andererseits die gute Betreuungsqualität anzuführen.
Die Übersiedelung in ein Pflegeheim ist in vielen Fällen gleichzusetzen mit der Entbindung von
einer nahezu unbewältigbar gewordenen Aufgabe, sie bietet also eine große Entlastung.
Wie groß die damit verbundene Erleichterung ist, zeigt sich etwa in Lisas Reaktion, die bei der
Information, dass ein Platz im Pflegeheim frei geworden ist, in Tränen ausbricht und in einer
Interviewsequenz von einer völlig neuen Lebensqualität spricht:
Lisa: "Also wir schauen schon, dass wir so zweimal in der Woche dort sind. Aber wir können
uns das einteilen selber. Wir können sagen: 'Okay, heute passt es, und um die Uhrzeit passt
es. Und ich gehe vorher ins Fitnesscenter und dann fahre ich hin.' Ich kann fünf Stunden
wegbleiben und nicht nur zwei. Ja, das ist (lacht) – also das ist eine Lebensqualität, die ist
unglaublich. Super." (Int. 01: 223)
Auch bei Patrizia ist der Entlastungsfaktor markant. Dies äußert sich unmittelbar in scheinbar
paradoxer Weise, nämlich indem sie kurz nach der Heimaufnahme ihres Mannes an einer
schweren Grippe erkrankt, die sie für mehrere Wochen außer Gefecht setzt. Ihr ist bewusst,
dass sie die Belastung nicht viel länger durchgehalten hätte:
61
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Patrizia: "Ja. Wenn es so ein Heim nicht gebe, dann wäre ich wie jemand, der gefangen ist.
Ich könnte das Haus nicht verlassen, ich könnte nichts tun, außer mich um ihn kümmern. Das
hab ich ja auch eine ganze Weile. Das ging aber erst los, als er aus dem Krankenhaus kam
und so schwach war. Und ich muss ehrlich sagen, viel länger hätte ich es nicht machen können. Und ich bin sehr froh, dass es diese Einrichtung gibt. Das muss man ganz nüchtern
sehen. Denn ohne das wäre mein Leben vorbei." (Int. 13: 149)
Zu den positiven Erfahrungen zählt für zwei Interviewpartner/innen, dass ihre Angehörigen
im Pflegeheim gut betreut werden. Denn die Entscheidung für ein Pflegeheim wird in den
seltensten Fällen leichtfertig getroffen und ist zumeist mit der Sorge verknüpft, ob der bzw. die
erkrankte Angehörige dort auch eine liebevolle und bedürfnisgerechte Pflege und Betreuung
erhält.
Sowohl Lisa als auch Patrizia berichten erleichtert von einer hohen Betreuungsqualität, die
sich etwa in der Durchführung von Aktivitäten zeigt. Beide betonen, dass ihre Angehörigen
von aufmerksamen und kompetenten Betreuungsperson begleitet werden und sich in der
neuen Gemeinschaft wohlfühlen.
Int.: "Wie ist es jetzt?"
Lisa: "Ja, jetzt sind wir, - ja, wir sind absolut zufrieden dort! Also sie ist jetzt in ein anderes
Heim gekommen, als wir ursprünglich geplant, was aber wesentlich besser ist. Es ist sehr
klein, das sind so um die 50 Bewohner und Bewohnerinnen, eh hauptsächlich Frauen. Es ist
ganz neu gebaut, und die kümmern sich wirklich super. Also die haben eben ein Programm
und man merkt auch, sie fühlt sich dort wohl." (Int. 1: 140f.)
Patrizia: "Und, was ich aber erstaunlich fand, wir haben in dem Heim eine Dame, die die ganzen Festivitäten ausrichtet, und die auch die Aktivitäten mit einer großen Gruppe, mit allen,
die noch geistig einigermaßen klar sind, veranstaltet. (…) Und die macht das großartig! Die
hat also so ein wunderbares Gespür mit alten Menschen, und sie hat es neulich geschafft,
dass er an dieser Bastelgruppe teilgenommen hat. (…)
Int.: Und was glauben Sie, wie es ihm da geht? Ist das okay für ihn?
Patrizia: Also ich kann Ihnen ein Foto zeigen, da war er total bei der Sache. Total aufmerksam." (Int. 13: 57ff.)
4.3.3
Negative Erfahrungen und Aspekte
Negative Erfahrungen im Zusammenhang mit der Heimbetreuung stellen bei jenen drei Angehörigen, die sich für die Betreuung in einem Pflegeheim entschieden haben, die Ausnahme
dar. Im Wesentlichen werden drei Aspekte angeführt, wovon jedoch nur einer die Betreuungsqualität betrifft.
Von jenen drei Personen, deren Angehörige in einem Pflegeheim untergebracht sind, berichtet
nur Felix von Erfahrungen, die auf eine nicht optimale Betreuungsqualität schließen lassen.
Aufgrund von Zeitmangel in der Betreuung kämen gewisse Aktivitäten, die für die Gesundheit der betroffenen Person zuträglich wären, zu kurz. So müssen die Angehörigen die Mobilisierung übernehmen, indem sie mit der Kranken im Garten spazieren gehen, da dem Betreuungspersonal nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.
Felix: "Wir probieren sie halt wieder mobilisieren ein bisserl, weil die drinnen haben ja keine
Zeit zum Gehen oder so irgendwas. Das ist grad nur, weißt eh, die Pflege, und dann ist es
eigentlich mehr oder weniger schon wieder vorbei mit dem Ganzen, was wir,- Sie haben wohl
einen schönen Garten, haben sie gezeigt, na, da wird jemand runtergehen und mit ihr ein
bisserl spazieren, das geht sich gar nicht aus in den Heimen. Die kommen von einer Pflege
zur anderen und dann ist für sie die Arbeit gelaufen. Und dazwischen haben sie ein bisserl
62
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Pause einmal, weil sie brauchen zwei Stunden, bis sie da ihre Leute alle durch sind, und
nachher ist es eh schon wieder Essen."(Int. 16: 41)
Ein zweiter negativer Aspekt, der allerdings übereinstimmend berichtet wird, betrifft nicht die
Betreuung im Heim selbst, sondern vielmehr die schwierige Entscheidung, den oder die Angehörige/n in einer entsprechenden Einrichtung unterbringen zu lassen. Diese ist bis zu einem
gewissen Grad immer auch mit Schuldgefühlen verbunden. So konnte sich Patrizia die Übersiedelung ihres Mannes in ein Heim zuerst gar nicht vorstellen und entschied sich zuerst, es
doch noch zuhause zu versuchen. Lisa berichtet, dass es insbesondere ihrem Mann sehr
schwergefallen ist, seine Mutter in ein Heim zu geben, obwohl er wusste, dass es keine Alternative dazu gab. Felix wiederum findet recht drastische Worte für die Gefühle, die er empfand,
als er seine Frau im Pflegeheim ablieferte: "So wie wenn man ein Tier aussetzt":
Felix: "Aber das Schlimme war eigentlich dann das Abgeben im Heim. Also das war – pah! So
wie wenn man ein Tier aussetzt oder was (…). Also das war für mich eigentlich dann das
Schlimmste in dem Sinn damals, aber wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann musst du
das einfach durchziehen, weil du kannst nicht hin und her." (Int. 16: 24)
Ebenfalls im negativen Kontext berichtet wurde von Eingewöhnungsproblemen. Denn nicht
immer verläuft der Übergang von der familialen Pflege in die Heimbetreuung reibungslos und
ohne Widerspruch der betreuten Person. So kam Lisas Schwiegermutter zu Beginn mit der
neuen Situation nicht gut zurecht und verlangte bei jedem Besuch, wieder nach Hause gebracht zu werden. Dies stellt für die Angehörigen, die ohnehin bis zu einem gewissen Grad mit
Schuldgefühlen zu kämpfen haben, eine Herausforderung dar.
Negative Erfahrungen in Zusammenhang mit der Unterbringung in einem Pflegeheim werden
auch von anderen Interviewpartner/innen berichtet. Diese stehen dann zumeist in Zusammenhang mit den Gründen, warum von der Entscheidung für ein Heim Abstand genommen wurde.
Zum Teil handelt es sich dabei um eigene Erfahrungen, wenn zum Beispiel Kurzzeitpflege in
Anspruch genommen wurde. Auf diese Aspekte wird nun im folgenden Abschnitt eingegangen.
4.4
Gründe gegen alternative Arrangements
In diesem Kapitel wird auf die Frage eingegangen, welche Gründe gegen die Entscheidung
für eine andere Betreuungsform als die gewählte sprechen bzw. gesprochen haben.
4.4.1
Gründe gegen (rein) familiale Pflege
Die Ursachen, warum die familiale Pflege nicht fortgesetzt wurde oder wird bzw. andere Alternativen gesucht wurden, stehen in engem Zusammenhang mit den persönlichen Grenzen der
Angehörigen, auf die in einem eigenen Kapitel gesondert eingegangen wird. Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass neben organisatorischen Gründen wie etwa einer weiten Wohndistanz (Elisabeth) oder einer Erwerbstätigkeit (Anton) die Beziehung zur an Demenz erkrankten Person eine wichtige Rolle spielt. Dies trifft etwa auf Lena und Annika zu. Als
drittes Kriterium wären fehlende (oder "verbrauchte") persönliche Ressourcen wie Zeit, Nerven, aber auch die eigene Gesundheit zu nennen. Dies spielt im Fall von Lisa sowie von Patrizia eine Rolle, deren Belastungsgrenzen erreicht waren, ist aber auch beispielsweise bei Curt
oder Sissi ausschlaggebend, die aufgrund einer eigenen Erkrankung die Unterstützung einer
24h-Kraft in Anspruch nehmen.
63
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.4.2
Gründe gegen Inanspruchnahme formeller Angebote
Formelle Unterstützungsmöglichkeiten beschränken sich nicht lediglich auf so umfassende
Angebote wie eine 24-Stunden-Betreuung oder eine (dauerhafte) Heimunterbringung, sondern
umfassen auch mobile Dienste oder die Möglichkeit der Kurzzeitpflege. Unabhängig von der
Art der Unterstützung lassen sich drei zentrale Gründe ausmachen, die einer Inanspruchnahme entgegenstehen, nämlich (1) finanzielle und organisatorische Gründe, (2) Ablehnung
durch den Betreuten und (3) Misstrauen der Angehörigen gegenüber der Betreuungsform.
4.4.2.1 Finanzielle und organisatorische Gründe
Da finanzielle und organisatorische Aspekte in einem eigenen Kapitel abgehandelt werden,
wird an dieser Stelle nicht in die ganze Bandbreite der damit verknüpften Problematiken erläutert.
Als Beispiel für finanzielle und organisatorische Gründe, die gegen eine 24h-Betreuung und
daher für die Aufnahme in ein Pflegeheim gesprochen haben, kann der Fall von Lisas Schwiegermutter angeführt werden. Während für das Pflegeheim bei sozialer Bedürftigkeit die Kosten
übernommen werden, erfordert die Inanspruchnahme einer 24h-Betreuung ein gewisses monatliches Einkommen oder entsprechende Rücklagen, um finanzierbar zu sein. Dies ist bei
Lisas Schwiegermutter nicht der Fall. Zudem sind die räumlichen Voraussetzungen, um eine
24h-Kraft zu beherbergen, nicht gegeben:
Lisa: "Und da haben wir lange überlegt wegen einer 24-Stunden-Pflege. Aber das ist nicht
finanzierbar gewesen."
Int.: Was kostet das? Oder wie geht das?
Lisa: Du kriegst zwar eine Förderung, aber kurz gesagt: Du brauchst mindestens ein Einkommen von 1.500 Euro im Monat, ohne Pflegegeld, also eine Pension, damit sich das ausgehen
kann. (…) Also das wäre finanziell schlichtweg nicht möglich gewesen. Und erstens das, und
zweitens hätten wir baulich etwas machen müssen. Weil, es ist so, dass sie, - weil die Pflegerin
braucht dann ein eigenes Zimmer, und das wäre dann ein Durchgangszimmer gewesen. Also
das wäre absolut nicht gegangen, abgesehen davon, dass sie absolut nicht wollte, dass jemand in ihre Räumlichkeiten geht und irgendwas macht. Also das, - pff! Hätte wahrscheinlich
nicht wirklich funktioniert. Und dann ist es auch relativ klein. Also die Pflegerin hätte auch nicht
auskönnen. Also wahrscheinlich nach drei Wochen hätte irgendwer den anderen erschlagen
gehabt (lacht). Also das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Also von daher war klar, es gibt
nicht wirklich eine Alternative und wir werden das mit dem Heim machen." (Int. 01: 135-137)
Bei Sissi stellt sich die Situation insofern anders dar, als die 24h-Betreuung aufgrund der hohen Pflegestufe ihres Mannes (Stufe 6) in Verbindung mit einer guten Pension ("also mit der
Pension kommen wir jetzt auf ungefähr 3000") finanzierbar ist und auch Räumlichkeiten zur
Verfügung stehen. Im Fall einer Heimunterbringung geht Sissi davon aus, ausschließlich mit
ihrer geringen Pension von 560 Euro ihren Lebensunterhalt bestreiten und die Kosten für das
Haus tragen zu müssen. Dies ist für sie finanziell nicht tragbar:
Int.: "Wie ist das, denken Sie manchmal an die Alternative Pflegeheim?
Sissi: (seufzt) Solange es möglich ist nicht. Außerdem wäre das finanziell glaub ich überhaupt
nicht mehr möglich. Weil das ist ja dann bis auf 200 Euro Taschengeld, was er bekommen
würde, würde alles eingesteckt werden. Dann bleiben mir meine 560 Pension (lacht). Und
damit, also,- Damit ist es nicht geeignet." (Int. 17: 100f.)
Im Fall von Marie, deren Vater von der Mutter bis zu dessen Tod betreut wurde, bleibt es im
Dunkeln, ob die finanziellen Mittel einer Heimunterbringung definitiv entgegenstanden. Dieses
Argument wurde von der Mutter gegenüber Marie vorgebracht, von dieser jedoch bezweifelt:
64
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Marie: "Und von daher, natürlich hab ich dann gesagt, ‚Mutti, gib ihn doch ins Pflegeheim. Wir
können uns doch ein gutes raussuchen. Schauen, wie die Leute dort behandelt werden und
so weiter.‘ Sie war dann auch auf Urlaub, und da war er dann auch in einem schönen Pflegeheim. Ja, aber sie hat immer irgendwie gemeint, es ist unleistbar, ein richtig gutes Pflegeheim.
Da muss ich sagen kenne ich mich finanziell zu wenig aus, warum das trotz einer eigentlich
gut situierten Situation, warum das unleistbar,- Aber dort war es eben wirklich schön. Ja, und
da hat sie ihn eben wieder genommen. Also nach dem Urlaub." (Int. 08:39)
4.4.2.2 Ablehnung durch Betreuten
Von der Erfahrung, dass die pflegebedürftigen Angehörigen Betreuungsangebote nicht annehmen, wird von mehreren Interviewpartner/innen berichtet. Gerade von mobilen Personen mit
noch verhältnismäßig geringem Pflegeaufwand, jedoch bereits deutlichen kognitiven Einschränkungen wird die Notwendigkeit einer ständigen Betreuung häufig strikt verleugnet.
Nicht immer führt dies letztendlich dazu, dass die angedachte Variante nicht umgesetzt wird.
Antons Vater lehnte etwa eine 24h-Kraft zunächst ab, als diese dennoch von Anton organisiert
wurde, war er jedoch sehr bald "Feuer und Flamme". Annikas Mutter konnte sich in den ersten
Wochen mit der 24h-Kraft ebenso wenig anfreunden ("Naja, die kannst du jetzt eh nach Hause
schicken, weil die brauchen wir jetzt nicht.") wie Lisas Schwiegermutter mit dem Umzug ins
Pflegeheim ('Nehmt's mich mit heim?'). Beide Frauen kommen aber laut ihren Angehörigen
mittlerweile sehr gut mit der neuen Situation zurecht.
In anderen Fällen wird bzw. wurde eine von den Angehörigen gewählte Variante jedoch aufgrund des Widerstandes der betreuten Person aufgegeben und eine andere Alternative herangezogen. Elisabeths Mutter etwa konnte den "Total-Eindringling" im eigenen Haus nicht akzeptieren, woraufhin nach einem Monat dieser Versuch abgebrochen wurde:
Elisabeth: "Und das mit der 24-Stunden-Pflege hat nicht wirklich funktioniert, weil sie, weil
meine Mutter sie nicht angenommen hat. Also sie hat eben wirklich eine fremde Person dann
im Haus quasi (lacht) neben gehabt. Es war zwar um einen Stock getrennt, das Haus ist groß
genug, es war auch genug Platz da und so weiter. Aber das war für sie eben quasi so ein
Total-Eindringling, und sie hat es eben nicht verstanden, was die jetzt denn da macht. Und da
sind dann die ganzen Konflikte eben hochgekommen. Ja, also weil, eine Frau, die ihr Leben
lang selbständig war, stark, alles auf die Reihe gekriegt hat, die ganze Family gemanagt hat,
und, und, und, und – die plötzlich eben merkt, es geht nicht mehr, aber es nicht wirklich merkt."
(Int. 02: 36)
Von manchen Angehörigen werden bestimmte Formen der Betreuung aufgrund entsprechender negativer Vorerfahrungen gar nicht mehr in Betracht gezogen. Erwies sich etwa eine Heimbetreuung im Rahmen eines Kurzzeitpflege-Aufenthalts als problematisch, wurde oft von einer
dauerhaften Unterbringung in einem Pflegeheim abgesehen. Die berichteten Widerstände
reichten hier von Verzweiflung und Weinen (Annikas Mutter) über Weglaufen (Cornelias Oma,
Antons Vater) bis zu aggressiven und/oder psychotischen Ausbrüchen (Gittis Schwiegervater).
Nicht nur permanente Betreuungsdienste, sondern auch mobile Angebote wie Hauskrankenpflege oder Assistenzpflege stoßen bei den Betroffenen nicht immer auf ungeteilte Begeisterung. Von manchen dementen Personen werden diese Dienste generell abgelehnt und deshalb von Haus aus nicht in Anspruch genommen (Gregors Vater), aber es finden sich auch
Beispiele dafür, dass Versuche, diese Betreuungsformen heranzuziehen, gescheitert sind.
Von diesbezüglichen Erfahrungen berichten etwa Felix und Sissi:
Felix: "Aber ich hab ja daheim, ich habe ja vorher eine Prostata-Operation gehabt, und in
dieser Zeit hab ich dann über so eine Versicherung, wo dann auch Assistenzpflege drinnen
65
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
war, und da hab ich eine Pflegerin gehabt dann, die die Wohnung geputzt hat und ein bisserl
gekocht hat und eben so geholfen. Und aus dem Gespräch heraus sind wir draufgekommen,
dass sie eigentlich auch schon solche Patienten gehabt hat und war ausgebildet in dem Sinn
aus der Tschechei. Und die war mir auch sympathisch, hätte genau gepasst. Und dann haben
wir zweimal eine Halbtages-, habe ich zweimal die Frau mit ihr allein gelassen. Das hat eigentlich eh so halbwegs gepasst. Und dann beim ersten Mal einen ganzen Tag, war es schon
aus. Sie ist sie ihr bei der Tür davon gegangen und so hat sie gesagt, nein, sie kommt mit ihr
nicht zurecht. In dem Sinn, sie will noch immer, dass ich mit der Pflegerin was hab und so
reden und einfach auch in dem Sinn abweisend ist zu ihr. Und dann hat sie keine Chance."
(Int. 16: 30)
Sissi: "Das war vom Hilfswerk, die machen das also so ehrenamtlich, kann man dann zahlen,
was man will. Und haben wir zuerst einmal versucht mit einem Mann, hat er sofort abgelehnt.
Sofort abgelehnt. Dann haben wir gesagt, ‚Okay, dann versuchen wir es mit einer Frau‘, auch
vom Hilfswerk. Abgelehnt. Dann ist da eine ganz eine fesche Ungarin, weil wir gesagt haben,
mein Mann war immer eigentlich auf fesche Frauen, und haben es versucht. Sie hat vielleicht
einen Fehler gemacht, sie ist hereingekommen und hat (wird lauter) ‚Ja, und ja, und Herr
(Name), wir gehen dann spazieren und wir gehen dann das und das‘. Also sie war ihm glaub
ich zu impulsiv und zu dominant vielleicht. Und da hat er damals so einen Zorn gekriegt, dass
er mir, wie die weg war, hat er mir die Gläser auf die Erde gehaut. Also da war er richtig
aggressiv dann. Das war dann,- Ja, und dann haben wir es aufgegeben. Dann keinen Versuch
mehr gemacht." (Int. 17: 215)
4.4.2.3 Misstrauen der Angehörigen gegenüber der Betreuungsform
Nicht nur die betreuungsbedürftigen Personen selbst, sondern auch deren Angehörige lehnen
mitunter bestimmte Betreuungsformen ab oder verknüpfen Ängste und Befürchtungen damit.
So sieht Felix die ohnehin schwierige Kommunikation mit seiner Frau als Herausforderung an,
die durch mangelnde Deutschkenntnisse ausländischer Betreuungskräfte, wie sie im Rahmen der 24h-Pflege vermittelt werden, noch verschärft werden würde:
Felix: "Und wenn ich jetzt da von den Rumäninnen jemanden nehme, die eine kann nicht
reden, die andere vielleicht noch weniger. Wie werden sich denn die verständigen? Das ist ja
eine Katastrophe." (Int. 16: 31)
Neben mangelnden Deutschkenntnissen ist es auch die Verlässlichkeit der 24h-Betreuungskräfte, die von Patrizia in Frage gestellt wird, da sie in einem Vortrag sehr negative Dinge über
diese Form der Betreuung gehört hat.
Patrizia: "Und da hab ich, weil diese 24-Stunden-Pflege, dieser Vortrag, der war so fürchterlich. Da kommen die Kräfte mal, oder sie kommen nicht, oder sie gehen zwischendurch wieder
weg, oder sie können nicht Deutsch oder was weiß ich. Ein unheimlich komplizierter Aufwand.
Und da hab ich dann, das war bei der Selbsthilfegruppe, da gab es diesen Vortrag, und da
hab ich dann am nächsten Tag die Leiterin angerufen, und da hab ich gesagt, ‚Wissen Sie
was, Frau (Name), das hat überhaupt keinen Zweck für mich. Denn wenn ich mir vorstelle, ich
fahr da weg und dann ist da keiner zuhause. Also, da kann ich mich überhaupt nicht auf irgendeinen Urlaub oder eine Erholung konzentrieren.‘" (Int. 13: 135)
Starke Vorbehalte bestehen mitunter auch gegenüber der Unterbringung in einem Pflegeheim.
So geht Annika – nicht zuletzt wohl auch aufgrund des Verhaltens ihrer Mutter – davon aus,
dass sich die alten Menschen "sich wohler wahrscheinlich zuhause als in einem Pflegeheim" fühlen. Zita wiederum assoziiert mit dem Begriff Pflegeheim den Umstand "lebendig
begraben" zu sein, räumt aber ein, sich bisher noch nicht mit Pflegeheimen für demente Personen beschäftigt zu haben. Eine negative Einstellung resultiert mitunter auch aus Bewertungen aufgrund von Beobachtungen oder auch kolportierten Erzählungen. So geht Marie davon aus, dass die Unterbringung in einem Pflegeheim das Leben der Betroffenen deutlich verkürzt.
66
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Marie: "Bei meiner Tante war es dann leider, die war im Pflegeheim, was mein Vater ja gottseidank nicht war. Und im Pflegeheim haben sie sie halt ruhiggestellt. Also die wurde so ruhiggestellt, dass sie nicht mehr gehen konnte. Aufgrund dessen haben die Muskeln abgebaut,
und sie hatte dann nur mehr 35 kg oder so am Ende. Also die haben da im Pflegeheim schon
ordentlich dazu beigetragen, dass sie halt relativ bald stirbt. Die hat mit der Demenz auch
nicht mehr lange gelebt, wobei mein Vater dann doch noch acht Jahre hatte quasi. Also sieht
man auch den Unterschied Pflegeheim oder Pflege daheim." (Int. 08: 25)
Interessant ist in diesem Fall, dass Marie der Mutter dennoch zu deren eigenem Wohle dazu
riet, den Vater im Pflegeheim betreuen zu lassen. Inwieweit die pflegende Mutter selbst die
Einschätzung ihrer Tochter teilte und für sie damit ein definitiver Hinderungsgrund vorlag, lässt
sich dem Interview leider nicht entnehmen.
Zwei weitere Personen, nämlich Curt und Arnold, hegen nicht grundsätzlich eine Abneigung
gegen die Betreuungsform Pflegeheim, erachten bzw. erachteten sie aber für ihre Lebenspartnerinnen als nicht adäquat. Während Curt die hohe Pflegebedürftigkeit der Heimbewohner/innen abschreckt, geht Arnold davon aus, dass die ideale Betreuung nur durch ihn selbst, nicht
jedoch in einem Heim möglich sei.
Curt: "Da gibt es eine Tagesbetreuung. Da kann man in der Früh hingehen, sie abgeben und
dann wieder abholen. Da war sie einen Tag, aber (lacht ein bisschen) der Eindruck war da
eher deprimierend. Weil da sind Leute, die müssen gefüttert werden, ja. Teilweise, teilweise.
Da war ich auch in dem anderen da, in dem anderen, in dem Altersheim da hier, da war ich
auch. Ja, da ist er überhaupt arg (lacht). Und da haben wir beschlossen, nein, wir machen da
eben irgendwas anderes." (Int. 12: 179).
Arnold: "Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
auf die Krankheit meiner Frau abgestimmt, das Pflegeheim eine Alternative wäre. Sie hätte ja
überhaupt mit niemandem kommunizieren können. Weil sie nicht mehr spricht und so weiter.
Und die wissen über meine Frau nicht Bescheid. Bescheid weiß ja nur ich." (Int. 14: 37)
4.4.2.4 "Was denken die anderen?"
Bezeichnenderweise wird nur von einer Person, die sich größtenteils in der Beobachtungsperspektive befindet, die Thematik angesprochen, dass auch die Erwartungen des Umfelds bestimmte Betreuungsalternativen – allen voran das sprichwörtliche "Abschieben" ins Heim –
mehr oder weniger ausschließen. Marie spricht klar aus, dass die Meinung der "Leute" für ihre
Mutter ein zentrales Motiv für die dauerhafte Übernahme der Pflege ihres Vaters darstellte:
Marie: "Meine Mama ist ein Mensch, der ist extrem wichtig, was andere über sie denken. Das
heißt, ein Pflegeheim für ihn wäre niemals für sie ihn Frage gekommen, weil eben, was denken
die anderen darüber. Also abschieben – gar nix." (Int. 08: 26)
Mitunter wird dieser Erwartungsdruck von den hauptverantwortlich betreuenden Personen
durchaus auch wahrgenommen und formuliert, so etwa von Curt, der lachend zu Protokoll gibt,
seine Frau zu pflegen sei etwas, was "die gesamte Welt" von ihm erwarte. Indirekt klingt diese
Thematik auch beispielsweise bei Gitti an, die einräumt, dass es von ihr als Frau wohl eher
erwartet werde, dass sie sich um den erkrankten Schwiegervater kümmert.
In welchem Ausmaß jedoch der soziale Druck für die Übernahme der Pflegeverantwortung
tatsächlich eine Rolle spielt, lässt sich auf Basis der Interviews nicht zufriedenstellend klären.
67
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.5
Finanzierbarkeit der Pflege
Inwieweit die Finanzierung der erforderlichen Pflegeleistungen ein Problem darstellt, ist von
einer Reihe von Faktoren abhängig. Eine zentrale Rolle spielt dabei sicherlich der Umstand,
welche Betreuungsformen zum Einsatz kommen.
Die kostengünstigste Möglichkeit der Betreuung stellt naturgemäß die vorwiegend familiale
Unterstützung dar, da hier keine Kosten anfallen, sondern im Gegenteil der Aufwand durch
das Pflegegeld zumindest teilweise abgegolten wird. Die Finanzierung der Pflege stellt folgerichtig auch bei jenen Betroffenen kein bedeutsames Problem dar, bei denen die familialen
Ressourcen diese Form der Betreuung ermöglichen. Ist der Betreuungsaufwand noch verhältnismäßig gering, d.h. kann die betroffene Person noch viele Dinge selbst erledigen und
benötigt (noch) keine permanente Beaufsichtigung aufgrund der Demenz, ist die Pflege im
Familienverband zumeist noch gut zu bewältigen, ohne dass externe Unterstützungsleistungen in größerem Umfang zugekauft werden müssen.
So sieht etwa Zita in der Finanzierbarkeit der Pflege kein Problem, da die die Mutter noch
verhältnismäßig wenig Unterstützung benötigt. Sie ist sich jedoch bewusst, dass sich mit steigendem Betreuungsbedarf sehr wohl die Kostenfrage stellen könnte:
Zita: "Und meine Mama ist sozusagen noch, hat ja eigentlich überhaupt noch keinen Pflegebedarf.
Int.: Das heißt, sie hat auch keine Pflegestufe oder so, wo sie Pflegegeld bekommt?
Zita: Ich glaube, dass sie sie Pflegestufe 2, also 1 sicher oder 2 ist, weil sie, wenn jetzt niemand bei ihr wohnen würde, natürlich bräuchten die dreimal am Tag eine Heimhilfe, die halt
kocht und schaut, dass sie halt zumindest einmal in der Woche die Unterwäsche wechselt
oder solche Sachen. Wenn jemand bei ihr wohnt, ist das was, was nebenbei automatisch
mitgeht. Wenn sie am Wochenende bei uns ist und sich am Abend umzieht und schlafen geht,
schnapp ich das Gewand und schmeiß es in die Wäsche und leg ihr ein frisches hin. Da red
ich nicht einmal drüber. Aber jetzt, ja im Moment ist es noch kein finanzieller Aufwand. Wenn
sie herumwandert oder sich nicht mehr auskennt, dann wird es was anderes werden." (Int. 10:
52f.)
Im Fall von Gregors Vater, der die Mindestpension bezieht und ebenfalls noch keine umfassende Betreuung benötigt, würde das Pflegegeld (Stufe 3) es nun ermöglichen, regelmäßig
einen mobilen Dienst zur Unterstützung im Alltag, zum Beispiel bei der Körperpflege, zu organisieren. Dass diese Möglichkeit von der Familie nicht in Anspruch genommen wird, liegt keinesfalls in der mangelnden Finanzierbarkeit, sondern im ablehnenden Verhalten des demenzkranken Vaters begründet.
Etwas anders präsentiert sich die Situation von Annemarie, deren Schwiegermutter einen sehr
hohen Pflegebedarf aufwies und vor ihrem Tod sogar die höchste Pflegestufe in Anspruch
nehmen konnte. In diesem Fall waren es die zeitlichen und auch fachlichen Ressourcen
der pensionierten Krankenschwester, die eine kostengünstige Betreuung in den eigenen vier
Wänden sichergestellt haben. Die umfangreiche Geldleistung, die aufgrund des enormen Betreuungsaufwandes zustand, ermöglichte es der Familie zudem, verschiedene formelle und
informelle Hilfen (Hauskrankenpflege, Verwandte, Freunde…) problemlos zu finanzieren. Annemarie gesteht jedoch ein, dass das Geld keineswegs ausreichend gewesen wäre, die eigene Unterstützungsleistung finanziell abzugelten:
Annemarie: "Ja, es ist so: Die Oma hat ja die Pflegestufe, wenn wir angesucht haben um die
nächsthöhere Pflegestufe, hat die Oma immer gekriegt. Sie ist nie abgewiesen worden. Und
68
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
mit dem Pflegegeld – weil die Pension, von der Landwirtschaft hat die Oma nur ganz ein kleine
gehabt. Und von ihrem Mann, das war nur ganz klein. Aber mit dem Pflegegeld sind wir schon,
das hat gereicht. Das hat schon gereicht, ja. Weil wir ja selber auch viel gemacht haben auch.
Selber viel getan haben wir, und wenn wir die Personen geholt haben wie eben die, die gezahlt
worden sind, das hat schon ausgereicht. Wenn wir die Stunden aufgerechnet hätten, die wir
gepflegt haben, das hätte nicht gereicht. Aber das war so." (Int. 04: 48)
In diesem Kontext ist allerdings zu berücksichtigen, dass die geringe Verfügbarkeit von Geldmitteln, weil die betroffene Person zum Beispiel nur eine sehr geringe Pension bezieht, auch
umgekehrt ausschlaggebend dafür sein können, dass der kostengünstigen Variante der innerfamilialen Betreuung der Vorzug gegeben wird. In welchem Ausmaß dies allerdings auf Kosten
der betreuenden Person gehen kann, wird an Gittis Beispiel deutlich. Um die Betreuung finanzierbar zu gestalten, hat sie dauerhaft auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet. Selbst die Aufnahme einer geringfügigen Tätigkeit erwies sich als nicht praktikabel, da die Kosten der Betreuung während der erwerbsbedingten Abwesenheit Gittis das damit erzielte Einkommen
deutlich überstiegen. Dass mit dem Verzicht auf eine eigene Erwerbstätigkeit nicht nur ein
erheblicher Verdienstentgang verknüpft ist, sondern möglicherweise auch Pensionsansprüche
davon betroffen sind, wird im Interview nicht weiter thematisiert11:
Gitti: "Er hätte schon mögen, dass ich ein Geld verdient hätte. (…). Aber er hat gesehen, also
ihm war es trotzdem wichtiger, dass ich auf sie schaue. Ja, war so. Und arbeiten gehen und
da jemanden her tun, das kann man sich nicht leisten. Also ich habe zwischendurch, eben
durch das, dass meine Schwester geschaut hat, habe ich so zwischendurch so ein, zwei Tage
so irgendwie so eine Arbeit gehabt, eben mit jungen Leuten, mit Jugendlichen. Das war voll
schön für mich. Aber das war nachher, also ich habe richtig aufgelebt, also mehr oder weniger.
Aber wenn nachher daheim wieder mehr zu tun war, habe ich wieder gesehen, dass es einfach nicht geht. Und vor allem, wenn ich jetzt das Hilfswerk zahlen muss, (…) dass ich da die
Hälfte von dem verdiene, was die kriegen. Die kriegen 20 Euro die Stunde, und ich habe zehn
Euro die Stunde verdient, also -;
Int.: Rechnet sich nicht, ja.
Gitti: Eben. (…) und wenn man fix irgendwas arbeiten würde, man könnte sich das nicht leisten. Das ist so. Wir können uns das leisten, weil ich nicht arbeiten gehe und daheim bin. Es
ist so." (Int. 09: 150f.)
Von Erwerbseinbußen aufgrund von Pflegetätigkeit berichtet auch Elisabeth, wenn sich diese
auch nicht so umfassend präsentieren wie bei Gitti. Als selbständige Künstlerin ist sie auch bei
kurzzeitigen beruflichen Auszeiten mit schmerzhaften Einkommensverlusten konfrontiert.
Elisabeth: "Also wenn ich mal eben, ich war ja eben dann am Anfang, ich bin ja ein ganzes
Monat unten gewesen. Hab alles abgesagt in Wien, alle meine Jobs. Ich habe jetzt dieses
Jahr mindestens zwei Monatsverdienste Verlust gehabt. Zahlt mir ja niemand, wenn ich nicht
arbeite." (Int. 02: 72)
Im Rahmen der Betreuung eines dementen Familienangehörigen stellt sich in manchen Fällen
auch das Problem, dass mit Fortschreiten der Erkrankung zunehmend Hilfe zugekauft werden muss, um Betreuungslücken im Tagesverlauf schließen zu können. Oft können Angehörige auch nicht mehr für kurze Zeit alleine gelassen werden, was sich jedoch nicht immer im
zugesprochenen Pflegegeldbezug widerspiegelt. Neben dem hohen organisatorischen Aufwand ergibt sich daraus ein beträchtliches finanzielles Problem. Die Situation von Gitti, aber
auch von Lisa (vor der Heimunterbringung der Schwiegermutter) kann hier als typisches Bei-
Es geht aus dem Interview leider nicht hervor, ob Gitti die Möglichkeit der kostenlosen PensionsSelbstversicherung bekannt ist bzw. ob sie diese in Anspruch nimmt.
11
69
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
spiel herangezogen werden. Zum Interviewzeitpunkt steht Gitti vor der Situation, dass sie kürzlich den Bescheid erhalten hat, dass die Pflegestufe und der damit verbundene Geldbetrag
von 6 auf 4 herabgesetzt wurden. Das stellt Gitti und ihre Familie vor erhebliche Schwierigkeiten:
Gitti: "Also, ja, wir waren da ziemlich geschockt. Und das ist, und das geht sich sicher nicht
aus nachher. Vor allem, jetzt haben wir eh schon so wenig eigentlich, deshalb, ich meine,
wenn ich jetzt, ich habe ja manchmal gesagt, wenn ich jetzt einen Nachmittag frei haben will,
muss ich ja auch wieder das Hilfswerk holen. Und das Hilfswerk kostet wahnsinnig viel Geld,
das kostet 20 Euro die Stunde für uns. Und wenn wir da 600 Euro kriegen, da kann man sich
ausrechnen, wieviel dass man die nehmen kann. Das heißt, ich muss halt nachher, ich meine,
gottseidank, wenn ich meine Mutter und meine Schwester nicht hätte, nachher, ja, wäre es
noch schlimmer. Aber Wochenende einmal einen Tag wirklich zusammen was unternehmen,
das kann man sich nicht leisten. Das geht sich nicht aus." (Int. 09: 125).
Ähnliches berichtet Lisa, deren Schwiegermutter zuletzt Pflegestufe 4 bezog:
Lisa: "Und in den letzten Jahren war das mit dem Fortfahren immer extrem schwierig. Also wir
haben, - also eben, weil wir alles haben bezahlen müssen. Also einen Tag wegfahren, wenn
du sechs, sieben Stunden weg bist, dann sind das 60, 70 Euro. Und dann gibt es halt Tage,
wo es halt sein MUSS, wo es Termine gibt, und das ist einfach dann nicht finanzierbar gewesen mehr. Also mit Pflegegeld plus Pension sogar. Weil, ich meine trotzdem muss sie dann
essen und so weiter. Also sie hat eh keine Unkosten sonst gehabt. Aber allein schon die
Betreuung zu bezahlen, also da kommt dann ordentlich was zusammen." (Int. 01: 169)
Was die 24h-Betreuung betrifft, so stellt dies grundsätzlich eine Betreuungsform dar, die man
"sich leisten können muss". Einige Interviewpartner/innen, deren demente Angehörige
diese Möglichkeit in Anspruch nehmen, geben an, in finanzieller Hinsicht durchaus an die
Grenzen des Machbaren zu stoßen. Mit den Worten von Sissi: "Also passieren darf nichts".
So berichtet auch Annika, die eine vergleichsweise günstige Variante der 24h-Betreuung nutzt,
dass die Mutter mit dem Geld "eben so" über die Runden kommt. Und Cornelia gibt an, dass
ihre Eltern für die Großmutter – obgleich diese eine eigene sowie eine Witwenpension bezieht
– einen finanziellen Beitrag leisten müssen, um den gesamten Aufwand finanzieren zu können.
Annika: "Die Fünfer. Also bleibt im Prinzip nichts. Nicht, weil die Pflegerin 1.200 Euro, und die
Versicherung muss man zahlen, die Sozialversicherung jedes Monat. Und natürlich, ja, die
Kosten, die jetzt sowieso, Strom, Wasser, Telefon. Ich meine, das hätte die Mama auch, aber
weitaus nicht so hoch. Nicht, die Stromkosten wären sicher nicht -; Aber egal. Nur es bleibt in
dem Sinn nichts." (Int. 11: 101)
Int.: "Und, - also ich weiß nicht, wie weit du da Einblick hast: Das kostet ja auch Geld. Also
eine 24-Pflege. Ist das mit, - also ich glaube, sie hat eine eigene Pension, Cornelia: Ja, sie hat eine Pension, sie hat eine Witwenpension. Also mit dem Pflegegeld und
ihrer Pension, deckt das die Grundkosten ab. Und dann das Einkaufen und die Betreuerinnen
bekommen für Hin- und Rückreise bekommen sie Reisegeld, 100 Euro, das zahlen meine
Eltern dazu. Also das geht sich nicht mehr aus mit der Pension. Und Medikamente und so.
Int.: Also es ist schon knapp.
Cornelia: Ja, genau. Also alleine mit der Pension geht es nicht." (Int. 03: 74ff.)
Lisa, deren Schwiegermutter nach Jahren der familialen Betreuung nun in einem Pflegeheim
untergebracht ist, gibt als Finanzierbarkeitsgrenze für eine 24h-Betreuung einen konkreten
Betrag von 1500 € an, der an Grundeinkommen (Pension) vorhanden sein muss, damit es
überhaupt möglich ist, diese Variante nutzen zu können, ohne dass Angehörige einspringen
müssen. Dies ist jedoch in der Realität insbesondere bei von Demenz betroffenen Frauen
häufig nicht der Fall, so auch nicht bei Lisas Schwiegermutter.
70
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Bei Antons Vater sind die entsprechenden Voraussetzungen hingegen gegeben. Anton ist sich
sehr wohl bewusst, dass er sich in einer privilegierten Situation befindet:
Int.: "Aber da hat er dann von da noch eine hohe Pension. Haben Sie jetzt glaub ich einleitend
gesagt.
Anton: Ja, genau, deswegen die lange – Ja, er hat eine halbwegs hohe Pension und Pflegestufe 6. Also, es geht sich aus. Ja, zum Glück. Auch da sind wir gesegnet, muss ich ehrlich
sagen." (Int. 05: 121f.)
Auch für Curt stellt die Finanzierung der Pflege – neben der 24h-Betreuung beschäftigt er auch
eine Entlastungshilfe – kein Problem dar. Obgleich seine Frau nur eine geringe Pflegegeldleistung (Stufe 1) bezieht – ob und in welcher Höhe sie auch eine Pension aus eigener Erwerbstätigkeit erhält, ist nicht bekannt – "gebricht es nicht an Geld". Dies liegt nicht nur in dem
Umstand begründet, dass Curt aufgrund seiner früheren beruflichen Tätigkeit vermutlich selbst
eine sehr gute Pension zusteht, sondern vielmehr in der Tatsache, dass er und seine Frau "ein
Leben lang Geld gespart" haben, um Situationen wie diese bewältigen zu können:
Int.: "Wie sieht das aus, Stichwort ‚finanzielle Situation‘?
Curt: Das kostet am Tag 80 Euro. Plus Reise hin und zurück. Das macht 2400 Euro im Monat.
Int.: Und kriegen Sie das hin? Können Sie das mit dem Pflegegeld und so -;
Curt: Ja, ja. Na, Pflegegeld, wir haben nur Pflegestufe 1. Da ist nicht viel Geld dahinter. Dafür
habe ich halt das Geld, mein Gott (lacht ein bisschen). Ein Leben lang haben wir Geld gespart.
An Geld gebricht es nicht." (Int. 12: 188ff.)
Die Unterbringung in einem Pflegeheim ist im Gegensatz zur 24h-Betreuung grundsätzlich
leichter finanzierbar, da bei nicht ausreichenden finanziellen Mitteln und bei Vorliegen einer
bestimmten Pflegestufe (zumeist Stufe 4) das Sozialamt einspringt und den Differenzbetrag
übernimmt. Der betreuten Person verbleiben 20 % der Pension samt Sonderzahlungen (13.
und 14. Einkommen) sowie 45,20 € Pflegegeld als monatliches "Taschengeld".12 Bei einer
Pension von etwa 1000 € im Monat steht somit rund 250 € im Monat zur Verfügung, zuzüglich
der Sonderzahlungen zweimal jährlich. Davon zu begleichen sind persönliche Ausgaben wie
Toilettenartikel, Friseurbesuche, Bekleidung und Medikamente.
Von wesentlicher Bedeutung für die Heimunterbringung ist jedoch nicht nur die finanzielle Situation der betreuten Person selbst, sondern sind auch die Auswirkungen für die nahen Angehörigen, insbesondere für den bzw. die Lebenspartner/in. Die zentrale Frage lautet hier, inwiefern ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen der dementen Person und dem/der
betreffenden Angehörigen besteht.
Interessanterweise ist die Abschaffung des Pflegeregresses dabei für die überwiegende Zahl
der Befragten nur von untergeordneter Bedeutung. Gitti gibt an, ihr Schwiegervater habe ohnehin kein Vermögen besessen, auf das ein Rückgriff hätte erfolgen können, dies sei kein
Hinderungsgrund gewesen. Dies trifft auch auf die Schwiegermutter von Lisa zu, die im Pflegeheim lebt – auch hier sind keine Auswirkungen spürbar. Ähnliches gilt für Patrizia, deren
Mann ebenfalls seit Kurzem im Heim untergebracht ist. Da sie als alleinige Besitzerin des gemeinsamen Hauses fungiert, wäre auch vorher bereits kein Rückgriff möglich gewesen.
12
Vgl. https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360542.html
71
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Für eine Reihe von Personen wäre eine Heimunterbringung ohnehin nicht in Frage gekommen, weil diese Möglichkeiten von den Angehörigen oder aber den Betroffenen selbst strikt
abgelehnt wurde. Dies betrifft beispielsweise Annika und ihre Mutter, Arnold und seine Frau
oder auch Anton und seinen Vater.
Lediglich eine Person gibt an, von der Abschaffung profitiert zu haben – für die Unterbringung
an sich war dies jedoch nicht von Relevanz. Seine Reaktion fällt dennoch verhalten aus:
Int.: "Jetzt ist aber ganz gut, glaub ich, also gerade für Personen, die im Heim sind, die Abschaffung vom Pflegeregress, oder? Haben Sie das mitbekommen?
Felix: Ja. Wir waren dann das halbe Jahr bis zum Jänner Selbstzahler, weil wir ja gesagt
haben, ja, wenn der jetzt eh fällt, dann tun wir bis dorthin das selber finanzieren, bzw. sie hat
ja wohl ein Sparbuch, wo wir auf das zugreifen können auch noch. Es war ja noch die Differenz
einfach zu zahlen nachher von der Pension, die Pension ist sowieso weg, plus Pflegegeld.
Und dann, jedes Heim kostet so zwischen drei und dreieinhalb da drinnen. Das sind die Kosten. Und da musst du halt die Differenz zahlen. Das haben wir gemacht, und seit dem Jänner
haben wir jetzt dann umgestellt (…) Natürlich ist das ein bisserl eine Besserstellung. Aber sie
kann jetzt, sie kriegt da noch 20 % von der Pension als Taschengeld, kriegen wir überwiesen
nur mehr. Der Rest geht dann rein, und 50 oder 60 Euro vom Pflegegeld." (Int. 16: 98f.)
Von zwei Personen wurde die Abschaffung des Pflegeregresses insofern kritisch beurteilt, als
"Menschen, die die Leute daheim pflegen, durch die Finger schauen" (Gitti) bzw. Personen,
die eine 24h-Betreuung in Anspruch nehmen, im Vergleich dazu benachteiligt sind (Annika).
In den Interviews wurde jedoch eine andere Problematik sichtbar: Die Entscheidung, den/die
Lebenspartner/in in einem Pflegeheim unterzubringen, wirkt sich mitunter gravierend auf die
persönliche Einkommenssituation aus, da das Partnereinkommen gänzlich wegfällt. Hiervon sind vor allem jene betroffen, die nur über geringe eigene Einkünfte verfügen, insbesondere, wenn der Ehepartner im Gegensatz dazu einen großen Teil zum Haushaltsbudget beigesteuert hat. Dies trifft beispielsweise auf Patrizia zu, die es als freischaffende Künstlerin
verabsäumt hat, eigene Pensionsansprüche zu erwerben und nun auf die Unterstützung ihrer
Kinder angewiesen ist.
Patrizia: "Finanzielle Situation ist gar nicht so einfach. Aus dem einfachen Grunde, ich habe
keine Rente. Ich hatte irgendwann mal eine Firma, und dann hab ich gesagt, ‚Soll ich mich
jetzt anmelden oder was?‘ Und da hat mein Mann gesagt, ‚Ach, brauchst du nicht. Wir kommen doch mit dem Geld aus, das wir haben‘. Ja, und wenn einer ins Heim kommt, ist das ganz
anders. Da ist das nämlich so, dass die Rente an das Heim geht, das Pflegegeld geht ans
Heim. Und dann hab ich bei der Landesregierung angerufen und hab ich gesagt, ‚Und was
wird jetzt mit mir?‘ Und die haben gesagt, ‚Ja, Sie bekommen die Mindestpension‘. Das sind
909 Euro. Und meine Kinder haben gesagt, ‚Mach uns mal eine Aufstellung, was du jeden
Monat bezahlen musst, und wir helfen dir jetzt über diese Durststrecke hinweg." (Int. 13: 123)
Mindestens ebenso prekär präsentiert sich die Situation von Sissi. Aus ihrer Sicht scheidet die
Unterbringung ihres Mannes in einem Pflegeheim aus finanziellen Gründen aus. Sie war bis
zu ihrem 70. Lebensjahr erwerbstätig, hat die Stundenzahl jedoch aufgrund der Pflegetätigkeit
zunehmend reduziert, weshalb ihr nun lediglich eine sehr geringe Pension von 560 € zusteht.
Sie geht davon aus, dass sie bei einer Übersiedelung ihres Mannes in ein Heim mit diesem
geringem Betrag dauerhaft auskommen muss. Während die 24h-Betreuung aufgrund der
überdurchschnittlichen Pension, der hohen Pflegestufe und des gewährten Zuschusses durch
das Land gerade noch finanzierbar ist – jedoch: "Passieren darf nichts!" – kann sie sich nicht
72
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
vorstellen, bei einer Heimunterbringung ihres Mannes ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Obgleich sie unter der aktuellen Situation leidet, lassen die finanziellen Möglichkeiten in
Verbindung mit ihrem eigenen Gesundheitszustand keine Alternativen zur 24h-Betreuung zu.
Das Beispiel von Felix zeigt, dass nicht nur Frauen von dieser Problematik betroffen sind.
Obgleich er sein persönliches Einkommen nicht offenlegt, wird deutlich, dass sich seine finanzielle Situation durch den Umzug seiner Frau ins Pflegeheim deutlich verschlechtert hat:
Felix: "Ja, ich meine, natürlich jetzt, seit sie im Heim ist, ist natürlich für mich auch kritisch.
Eine große Wohnung, jetzt sind die ganzen finanziellen Belastungen halt auf mich, was jetzt
rein heraußen -; Und da geht schon 50 % der Pension auf das auf nur rein Wohnen. Also, das
heißt, wenn noch andere Sachen, Versicherungen, Auto -; Und dann bist du schon ziemlich
an der Grenze. Also, da musst du dir schon überlegen, ob sich die Wohnung noch für dich
auszahlt. Und natürlich, sie hat, für eine Frau, eigentlich keine schlechte Pension gekriegt."
(Int. 16: 97)
Am Beispiel von Theresa zeigt sich, mit welchen Folgewirkungen Familien zu kämpfen haben,
wenn ein Partner aufgrund einer Erkrankung seinen Beruf aufgeben muss und pflegebedürftig wird. Im konkreten Fall machte die infolge eines Schlaganfalls entwickelte Demenz eine
Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit unmöglich. "Wie blöd ist man eigentlich, wenn man jung
ist?" fragt sich Theresa angesichts der Tatsache, dass zwar umfassende finanzielle Vorsorgemaßnahmen für den Todesfall getroffen wurden, jedoch keinerlei Absicherungen für den Fall
einer Berufsunfähigkeit. Ironischerweise hat gerade das Entgegenkommen des Arbeitgebers
zur Verschärfung der finanziellen Situation maßgeblich beigetragen.
Theresa: "Uns hat irrsinnig,- diese sieben Monate Arbeitsversuch, die haben uns irrsinnig hineingezogen, weil dadurch die Pension wieder weniger geworden ist, weil er ja diese sieben
Monate viel, viel weniger gearbeitet hat. Weil er war ja vorher leitende Position, er war Prokurist, und ist dann im neuen Job eigentlich nur so ein Bankbeamter gewesen, ein kleiner, mit
einem ganz einem niedrigen Gehalt. Einfach, weil sie wollten ihm die Chance geben, dass er
wieder ein bisserl (seufzt tief), ja, da hineinkommt, dass er sich wieder ein bisserl beweisen
kann. Und das hat uns eigentlich das Genick gebrochen. Also ich habe dann angefangen,
Gott sei Dank, ich habe wieder mehr arbeiten anfangen können, also ich bin stetig mit den
Stunden hinauf gegangen, bin jetzt wieder fast Vollzeit. Und ja, es ist uns zugutegekommen,
dass jetzt wenigstens die Große auch arbeiten geht." (Int. 15: 97)
Während Theresas Mann vor seiner Erkrankung als Hauptverdiener fungierte, liegt die finanzielle Verantwortung nun nahezu ausschließlich bei Theresa. Erschwerend kommt hinzu, dass
die von der GKK vorgeschriebenen Reha-Maßnahmen ebenfalls ein großes Loch in die Haushaltskasse reißen.
Theresa: "Aber finanziell ist es sicher schwierig. Schon allein, weil du die Auflagen kriegst, du
musst Therapien machen. Dann heißt es immer, du kriegst ja von der GKK eh was zurück,
diesen Selbstbehalt. Der bleibt dir ja. Aber dass sich das summiert, weil du brauchst Physiotherapie, eine Ergotherapie, psychologische Betreuung. (…) du hast ja so ein Care-Center
von der GKK aus, die einfach schauen, dass du Reha-Maßnahmen machst, damit du ja wieder
gut wirst. Und wieder eingegliedert wirst in den Beruf. Und da hast du Auflagen, da kriegst du
am Anfang, jedes Jahr kriegst du einen Zettel, welche Auflagen du erfüllen musst. Also da
steht oben: ‚Neurologische Fachuntersuchung, Physiotherapie‘, je nachdem, was er alles hat,
was er nachweisen muss, welche Sachen. Das musst du erfüllen, und dann am Jahresende
gehst du hin und dann macht sie Hakerl, ‚erfüllt, erfüllt, erfüllt‘ oder ‚nicht erfüllt‘. Wenn das
nicht erfüllt ist, dann können sie auch von dem Rehageld zum Beispiel wieder etwas abziehen.
Du musst diese Maßnahmen einfach leisten. Ob sich das finanziell ausgeht oder nicht." (Int.
15: 97ff.)
73
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.6
Strukturelle Schwierigkeiten und Hürden
Die Inanspruchnahme von Sozialleistungen, wie sie auch von Demenz betroffene Personen
und deren Angehörige zusteht, ist immer auch mit einem gewissen bürokratischen Aufwand
verbunden. Es müssen Informationen eingeholt, Ansuchen gestellt und Formulare ausgefüllt
werden. Nicht immer gestaltet sich dabei die Abwicklung reibungslos, wie auch eine Reihe von
Aussagen aus den im Rahmen dieser Studie durchgeführten Interviews belegt – mitunter sind
Angehörige mit bürokratischen Hürden konfrontiert, die es zu überwinden gilt. So spricht
etwa Elisabeth, die angibt, als selbstständige Künstlerin Behördenwege u.a. zwecks Subventionsansuchen gewohnt zu sein, von einem "Spießroutenlauf" im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit ihrer Mutter. Sehr konkret schildert Theresa – aus persönlicher wie auch aus
beruflicher Erfahrung – wie schwierig sich die Situation für die Betroffenen mitunter gestaltet.
Theresa: "Es ist nur halt einfach, weil viele Leute da einfach wieder durchfallen, weil sie eben
sagen, ‚Naja, ähm -;‘ Die Pflegestufe muss stimmen. Dann muss ich den Platz haben. Das ist
schwierig, du hast so viel Papierkram, du musst so viele Sachen beilegen. Wir brauchen für
das eine Beglaubigung, dort brauchst du was. Wenn mein Angehöriger oder meine Tochter
jetzt für mich diese Pflege übernimmt, dann muss die wieder einen Dienstentgang nachweisen. Also es ist immer so viel Bürokratie. Es funktioniert nichts so gleich. Und da bei den
Sachen, wenn es oft pressiert, wenn einfach wirklich jemand dringend operiert werden muss,
dann geht das nicht. Ich kann nicht gleich operieren, obwohl ich einen OP-Termin habe. Ich
muss zuerst warten, bis das alles, bis diese Mühlen gemahlen haben. Das ist einfach so mühsam. Und deswegen sind einfach viele Leute, die sagen, ‚Na, hören Sie mir auf, ich mach so
was gar nicht mehr, ich brauch keine Förderung. Vergiss es. Ich mach das selber‘." (Int. 15:
129)
Auch Gregor berichtet von negativen Erfahrungen im Umgang mit Behörden und bürokratischen Anforderungen, die ihn und seine Familie letztendlich davon abhielten, die Möglichkeit
der Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen. Nachdem er beim Angehörigenstammtisch die
Information erhalten hatte, dass diese Möglichkeit in Frage käme, suchte er mit seiner Familie
das Sozialamt auf:
Gregor: "Und da sind wir rein, und ich muss echt sagen, so was Unfreundliches hab ich noch
nie erlebt. Hinein, und dann ‚Ja, was wir brauchen‘. Haben wir gesagt, dass wir eben erfragt
haben, dass man da eine Unterstützung kriegt oder was. Die hat uns den Antrag hergegeben
und hat -; ‚Das ist zum Ausfüllen‘. Da sag ich, ja, ob sie uns da helfen kann. ‚Das steht eh
alles genau da.‘ Sie hat uns weder geholfen, noch sonst irgendwas. Und dann hätte man, da
hat sie eine Liste gehabt, dann hätte ich auf die Minute genau müssen aufschreiben, was ich
für die Mutter alles mache. Was ich mache, was die Frau macht, was der Sohn macht. Die
ganze Pflege detailliert aufschreiben. Und dann haben sie gesagt, dann wird das gewertet, ob
ich überhaupt Hauptpflegeperson sein kann. Habe ich gesagt, ‚Und wenn nicht, habe ich jetzt
die Mutter nachher illegal gepflegt, oder wie ist denn das?‘ Also von der Seite her, also von
da, da müsste man noch viel mehr machen. Also, da wird man ziemlich allein gelassen." (Int.
7: 94)
Auch Gitti verzichtete aufgrund bürokratischer Hürden auf Förderungsmöglichkeiten. Sie gibt
an, dass die akribische Protokollierung der persönlichen Freizeitaktivitäten die Voraussetzung
dafür darstellen würde, eine Förderung für die Bezahlung einer privaten Unterstützung für den
kurzzeitigen "Urlaub von der Pflege" zu erhalten.13
Gitti: "Weil es gibt ja so Sachen, wo man ansucht, dass man privat jemanden zahlen kann,
dass man in Urlaub fahren kann. Aber was sie da alles verlangen! Da müsste man jeden Tag,
wenn ich sage, ich bin aber in der Nacht da, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Ding ist ; Jedenfalls geht es halt ums Geld, dass man jemanden privat zahlen kann. So, wenn ich da
jetzt aber -; Also, letztes Jahr haben wir angesucht. Früher war das einfacher, da hat man nur
13 Die Vermutung, dass Gittis Aussage auf einer Fehlinterpretation von Förderrichtlinien beruht, kann an dieser
Stelle nicht eindeutig bestätigt oder widerlegt werden.
74
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
sagen können, in dem und dem Zeitraum habe ich den gebraucht, und da habe ich dem das
gezahlt, und dann krieg ich da was zurück. So. Jetzt ist es so, dann hat sie gesagt, wenn wir
untertags daheim sind und nur Tagesausflüge machen, müssen wir genau aufschreiben, was
habt ihr am Vormittag gemacht, was habt ihr am Nachmittag gemacht. Was habt ihr getan,
seid ihr Rad gefahren, seid ihr baden gegangen? Das müsste man alles aufschreiben. Dann
haben wir gesagt, wenn das so arg ist, dann verzichten wir lieber darauf (lacht). Also es wird
immer schwieriger." (Int. 09: 138ff.)
Ein weiterer Aspekt, der von einigen Personen kritisch beurteilt wird, betrifft die Vorgehensweise bei der Pflegegeldeinstufung. Theresa spricht den geringen Zeitaufwand bei der Begutachtung sowie die Tatsache an, als Bittsteller/in zu fungieren. Gitti wiederum hat kurz vor
dem Interview einen Bescheid über eine Herabstufung des Pflegegeldes von Stufe 6 auf Stufe
4 erhalten und ist darüber völlig verzweifelt. Detailliert schildert sie den Ablauf der Begutachtung durch die zuständige Ärztin:
Gitti: "Die hat alles mit ihm besprochen. Und wenn ich etwas erklärt habe oder erzählt habe,
ja, es ist halt so, dass ich gesagt habe, was früher alles passiert ist, damit die vielleicht merkt,
dass wir deshalb immer dabei sein müssen, oder wirklich 24 Stunden rund um die Uhr immer
bei ihm sind. Und sie hat immer gesagt, ich soll nicht immer Sachen erzählen, die waren, das
war, und jetzt ist es anders. Und es hat sich gesundheitlich nämlich gar nichts getan, und er
hat nachher, er hat ja, er hat sich ja zusammengerissen. (…) Und der hat dann gezeigt, wie
er -; also erklärt, wie er aufs Klo geht. Er kann nicht, er kann absolut nicht selber irgendwo hin
auf den Leibstuhl gehen. Und dann ist er hingefahren, ‚Und das mach ich so und so‘. Ich
meine, ich habe mir gedacht, die muss ja wohl wissen, dass das nicht stimmen kann, aber
vielleicht hat sie ihm das geglaubt, ich weiß es nicht auch. Jedenfalls hat sie immer gesagt,
‚Na, das war einmal.‘ Nur dass seine Dinge noch alle gleich sind, ich weiß nicht. Es war eigentlich, ja, irgendwie voll komisch. Und ich meine, es kommt jetzt eh noch ein Sachverständiger, der das noch einmal anschauen wird, ob das wirklich stimmt. Und ich kann die ganzen
Bestätigungen von den Ärzten wiederholen. Ich habe nämlich keine neuen Bestätigungen geholt, weil ich mir gedacht habe, das ist eh offensichtlich, dass das (lacht kurz) gleich geblieben
ist. Ich habe mir da eigentlich vorher keine Gedanken gemacht. Und weil das ja schon ein
Jahr her ist, die Demenzbestätigung, anscheinend zählt das nicht. Nur, ich habe noch von
keinem Fall gehört, dass die Demenz besser geworden ist." (Int. 09: 117)
In einem Fall wurde auch das Problem von Einkommensgrenzen bei Förderungen angesprochen. Konkret geht es um Annikas Mutter, der angeblich trotz einer geringen Pension von
knapp über 1.000 Euro keine Landesförderungen für die 24h-Betreuung zusteht14.
Annika: "Ja, es geht sich jetzt mit ihrem Pflegegeld und mit der Pension, die sie bekommt,
aus. Und es gibt ja auch diese Förderung im Burgenland, also diese 275 Euro für Pflege, als
wenn du eine 24-Stunden-Pflege hast. Das ist ja vom Sozialministerium. Das gibt es ja schon
länger, und jetzt hat aber das Land (…) beschlossen, nachdem ja dieser Pflegeregress aufgelassen ist, dass es eine Förderung gibt für die 24-Stunden-Pflege, also die Leute, die halt
zuhause gepflegt werden. Jetzt war ich auf der Bezirkshauptmannschaft, hab das alles zusammen gerechnet und auch den Antrag gestellt und ja, sie ist um 100 Euro über dem, was
gefördert werden würde. Obwohl sie nur, 1030 ist die Pension. Und trotzdem ist sie drüber."
(Int. 11: 97)
Beklagt wird von Angehörigen des Weiteren ein Mangel an Informationen, sowohl was finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten betrifft, als auch in Hinblick auf die Krankheit selbst und
den Umgang damit. Deutlich wird aus den Aussagen auch, dass vor allem das Fehlen konkreter Ansprechpersonen für Betroffene ein Problem darstellt. So kritisiert etwa Elisabeth,
die sich die Informationen aus dem Internet zusammengetragen hat, "man soll sich alles selber
14
Da rechtlich deutlich höhere Einkommensgrenzen vorgesehen sind (vgl. www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/36/Seite.360534.html), besteht die Vermutung, dass andere Faktoren – etwa eine
fehlende Ausbildung der Betreuungskraft – ausschlaggebend für die Ablehnung der Förderung waren.
75
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
holen". Auch das zuvor angeführte Zitat Gregors das Ansuchen die Kurzzeitpflege betreffend
schlägt in eine ähnliche Kerbe und macht deutlich, dass durchaus auch ein Bedarf an Unterstützung bei Antragsstellungen im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit besteht. Dies
ist vor allem im Hinblick auf die Tatsache von Bedeutung, dass die Personen, die Angehörige
pflegen, häufig auch schon fortgeschrittenen Alters sind nicht davon ausgegangen werden
kann, dass sie die erforderlichen Informationen über das Internet abrufen können. Aber auch
über die Krankheit selbst und wie diese den Alltag und die Beziehung zur erkrankten Person
verändern kann, wird mehr Aufklärung gewünscht:
Gregor: "Wir hätten gerne einmal irgendwas gehabt, vielleicht einmal einen Kurs oder eine
Schulung oder irgendwas. Es gibt nichts. Es gibt nichts. (…) eine Schulung, dass man irgendwo hingehen kann und sagen kann, ‚Ja, ich möchte das lernen, ich möchte da schauen‘
– das gibt es nicht. Also wenn es nicht vom Stammtisch oder über einen Verein oder über eine
Gemeinde organisiert wird -; Also, da ist sicher Nachholbedarf. Und das ist schade, ja. Ich
habe das Glück gehabt, dass meine Frau vom Fach ist, die Tochter vom Fach ist, die Schwiegertochter vom Fach ist, und dass man halt redet darüber. Und das gemeinsam macht. Das
war mein Glück. Weil sonst wüsste ich gar nichts." (Int. 07: 94ff.)
Mit einer bedeutsamen rechtlichen Problematik, die an Demenz erkrankte Personen und
deren Angehörige betrifft, wurde Anton konfrontiert. Als eine wichtige Operation des Vaters
ansteht, ergibt sich die Situation, dass dieser aufgrund der fortgeschrittenen Demenz de facto
seine Einwilligung gar nicht geben kann, während Anton diese mangels einer bestehenden
Vorsorgesachwalterschaft nicht geben darf. Auch hier zeigt sich ein gravierendes Informationsdefizit. Als Anton den Bogen mit den Patientendaten ausfüllt, wird unter anderem nach
dem Vorliegen einer Vorsorgesachwalterschaft gefragt, jedoch "…ich habe nicht einmal gewusst, was das ist":
Anton: "Im Spital, wie sie mir den Bogen gegeben haben, zum Anmelden war ich ja dabei im
Spital, da haben sie mir einen Bogen gegeben, den man ausfüllen muss mit allen Patientendaten. Da wird so was gefragt, ob es sowas gibt, eine Vorsorgesachwalterschaft, und ich habe
nicht einmal gewusst, was das ist. Habe natürlich nichts angekreuzt, habe dann meinen Vater
unterschreiben lassen, also unterschreiben hat er es noch können. Und dann wurde ich angerufen, dass sie festgestellt haben, er hat bei dem Test, den man da machen muss, ob er
eigenverantwortlich sein darf, hat er von 30 Punkten nur vier gemacht, und das darf er dann
nicht selber unterschreiben. Habe ich gefragt, ob ich das darf, haben sie gesagt, nein das darf
ich nicht, erst, wenn ich diese Vorsorgesachwalterschaft habe, aber die hab ich nicht. Dann
hat zum Glück meine Schwester, weil die arbeitet bei einem Anwaltsbüro -; also man muss
wirklich alle Register ziehen. Die arbeitet bei einem Anwaltsbüro, und die hat dann im Bürgergesetz gefunden, dass Angehörige bei lebenswichtigen Operationen, wenn für sie durch die
Operation kein bleibender Schaden entsteht oder durch die Einwirkung der Operation kein
bleibender Schaden entsteht, wenn sie lebenswichtig ist, dass die Verwandten schon unterschreiben dürfen. Das hat dann das Krankenhaus akzeptiert. Aber eigentlich war es eine
Grauzone." (Int. 05: 15)
Mit einer anderen rechtlichen Hürde musste sich hingegen Gregor auseinandersetzen. Als er
vor einigen Jahren um Pflegekarenz ansuchen wollte, musste er feststellen, dass er als Beamter kein Anspruch auf eine finanzielle Entschädigung besaß. Über die zwischenzeitlich
erfolgte gesetzliche Änderung scheint er keine Informationen zu besitzen15.
Gregor: "Oder ich wollte, wie die Mutter damals so schwer krank war, wollte ich einmal in
Karenz gehen. Weil ich bei (Branche) bin. Die hat gesagt, ‚Ja, passt, ich kann eine Pflegekarenz nehmen.‘ Dann hab ich angesucht wegen Pflegekarenz. Ich stehe mit null Schilling oder
15
Dienstrechtsnovelle 2013 (vgl. www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/dienstrecht/
novellen/XXV/BGBl_I_210_2013.html)
76
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
mit null Euro da, ich verdiene nichts. Dadurch, dass ich Beamter bin, gibt es kein Arbeitslosengeld für mich. Also, ich kann wohl daheim bleiben, aber schau, wie du weiter kommst.
Keine finanzielle Unterstützung, gar nichts." (Int. 07: 94)
Zu guter Letzt soll eine Aussage nicht unerwähnt bleiben, die auf einen positiven Aspekt der
staatlichen Unterstützung fokussiert. Die Hilfsmittel, um die Arnold für seine Frau ansuchte,
wurden von der zuständigen Krankenversicherungsanstalt immer anstandslos bewilligt:
Arnold: "Und das muss ich dazu sagen, also die Versicherung, die (Name), die ist ja super,
muss man sagen. Wir haben jedes Gerät, das wir im Haus hatten, jedes technische Gerät,
das wir gebraucht haben, erhalten. Ob es jetzt der Wannenlift war oder der Patientenlift oder
der Pflegerollstuhl oder das Krankenbett." (Int. 14: 38)
4.7
Emotional Schwieriges und Entlastendes
Im Verlauf des Gesprächs lag ein Fokus darauf, wie die Erzählpersonen ihre jetzige Situation
emotional wahrnehmen, was sie als belastend empfinden und wo sie Entlastung finden. Diese
zwei Aspekte wurden in jedem Interview von der Interviewerin angesprochen und in fast gleichlautenden Worten als Frage formuliert, so dass die folgenden zwei Abschnitte wiedergeben,
wie ähnlich oder unterschiedlich die verschiedenen Personen ihre Situation als pflegende Angehörige wahrnehmen.
4.7.1
Schwieriges
Alle Erzählpersonen wurden gefragt, was sie "momentan als besonders schwierig" empfinden.
Die Antworten waren sehr heterogen, lassen sich aber in drei Kategorien zusammenfassen:
Die Angehörigen berichten (1) von Einschränkungen in ihrem eigenen psychosozialen Wohlbefinden, (2) Problematiken auf der Beziehungsebene und (3) von Schwierigkeiten andere
Personen betreffend (z.B. weitere Betreuungspersonen).
4.7.1.1 Eigenes Wohlbefinden
Die Themen, die im Bereich des eigenen Wohlbefindens angesprochen werden, sind Anstrengung, Überforderung, räumliches "Angebundensein" und die Gefährdung der Verwirklichung eigener Lebenspläne.
Von "Anstrengung" im Pflegealltag spricht zum Beispiel Annika, die ihre Mutter alle zwei Wochen an den Wochenenden besucht. Als Berufstätige würde sie gern das Wochenende zur
Erholung nutzen. Als anstrengend empfindet sie zum Beispiel die sich wiederholende Kommunikation, ihre Mutter würde wegen ihrer Vergesslichkeit "immer wieder dieselben Fragen"
stellen:
Annika: "Wenn man eh die ganze Woche arbeiten geht und dann am Wochenende auch nicht
zur Ruhe kommt, ist natürlich schon auch anstrengend, ja, muss ich sagen. (…) Aber im Sommer ist es auch leichter, weil man ist mehr draußen, und da kann ich im Garten auch ein bisserl
was machen. Da muss man nicht ständig nur mit ihr halt,- Sie ist dann auch draußen und
schaut halt zu, oder,- Ist dann schon leichter als im Winter. Wenn man dann nur drinnen und
den ganzen Tag irgendwie sie,- Ich meine, das ist schon anstrengend, ja. Wenn dann immer
wieder auch dieselben Fragen kommen." (Int. 11: 115)
Wie anstrengend die alltägliche Kommunikation und Aushandlungsprozesse mit dementen
Angehörigen sein kann, illustriert auch das Zitat von Lisa. Sie betreute jahrelang gemeinsam
mit ihrem Mann ihre demente Schwiegermutter im Haus, bevor diese in ein Heim kam. Die
Ansprüche, die die schwer demente Frau aufgrund ihrer irrationalen Ängste hatte, verleitet
77
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Lisa zu der – wenn auch etwas humorvoll gemeinten – Aussage, dass sie sich derart drangsaliert fühlte, dass sie beinahe vor der hochbetagten Schwiegermutter gestorben sei, eben "zu
Tode genervt". Ihr Zitat zeigt auch, dass die negativen Gefühle im Widerstreit mit ihrem Mitgefühl für die Schwiegermutter standen. An anderer Stelle hatte Lisa gesagt, dass sie ihre
Schwiegermutter umso mehr annehmen konnte, "je bedürftiger" sie geworden sei.
Lisa: "Auf der anderen Seite natürlich, also ständig genervt war ich auch. Also das schon. Und
das ist oft schwer. Das ist sehr widerstreitend oft, ja? Also auf der einen Seite hat man Verständnis und das schwankt auch total. Und in den schlimmen Phasen, also war ich wirklich so
derartig fertig und genervt, dass ich gesagt habe, - (zögert) also ich habe einmal zu meinem
Mann gesagt: 'Ich weiß, ich werde sicher vor ihr sterben, und meine Todesursache wird sein,
ich bin zu Tode genervt worden' (lacht). Aber, ja." (Int. 01: 95)
Auch die Erzählung von Marie veranschaulicht, mit welchen Situationen die Angehörigen im
Alltag konfrontiert werden. Sie war noch im Jugendalter, als ihr Vater dement wurde und erkennt in der Rückschau, dass ihr die "schnelle Verantwortung" nicht gut getan habe:
Marie: "Und ist er halt zum Zahnarzt gefahren, es war Gott sei Dank nicht so weit weg, im
Pyjama. Und er ist dann dort ausgestiegen und wir sind dann halt gleich hin und haben gesagt,
‚Papa, was machst du denn da?‘ Ja, er blutet so stark, er muss zum Zahnarzt gehen. Und
dann weiß ich noch, er musste aufs Klo, und er hat dann mitten dort auf der Straße in die
Wiese gemacht. Ich meine, gut, er war im Pyjama, also es dürfte eh jedem klar gewesen sein,
dass das eben ein alter Mann ist, der da irgendwie ein Problem hat. Gott sei Dank hat sich
keiner beschwert. Und dann sind wir eben mit ihm zum Zahnarzt, und der hat schon gemeint,
ja, es war wichtig, dass er da war. Ja, und was soll man machen? (…) Mit ihm konnte ich
schon gar nicht schimpfen. Aber es war dann halt auch so eine schnelle Verantwortung. Also,
ich meine, allein das Hinterherfahren und Nachschauen, was er macht und so. Ja, ist halt
auch nicht schön gewesen." (Int. 08: 23)
Bei Marie klingt schon an, dass der Alltag mit ihrem dementen Vater nicht nur anstrengend
war, sondern sie manchmal auch überforderte. Elisabeth verwendet den Begriff der Überforderung ohne Umschweife: Sowohl sie selbst als auch ihre Brüder seien überfordert mit der
Situation, wobei die Brüder "von der Persönlichkeit" anders damit umgingen als Elisabeth. Sie
würden sich "wegschupfen", während Elisabeth – obwohl sie im Gegensatz zu ihren beiden
Brüdern nicht vor Ort ist – Verantwortung übernimmt.
Elisabeth: "Also ich gehe davon aus, dass sich meine Brüder wahrscheinlich immer mehr ausklinken werden, statt mehr einklinken.
Int.: Warum?
Elisabeth: Weil sie maßlos überfordert sind mit der Situation. Das kommt ja dazu. Also, ich bin
auch überfordert mit der Situation, aber ich versuche damit umzugehen, so gut es geht. (kurze
Pause). Sie sind da nicht so talentiert. Von der Persönlichkeit eben so, gut da, wo es schwierig
wird, das schupfen sie eher weg als sich da reinzu – (bricht ab)" (Int. 02: 153)
Elisabeth ist es auch, die die Krankheit ihrer Mutter mit eigenen Einschränkungen in ihrer
Lebensplanung in Zusammenhang bringt. Nachdem sie erst erläutert, dass sie wegen ihrer
Selbstständigkeit finanzielle Einbußen dadurch hatte, dass sie viel Zeit in die Organisation in
die Pflege ihrer Mutter und in Reisen zu ihr investierte, kommt sie zunächst etwas zögerlich
darauf zu sprechen, dass "gewisse Pläne" nicht verwirklicht werden können. Elisabeth ist Mitte
40, hat aktuell keinen Partner, aber doch noch einen Kinderwunsch. Die jetzige Situation lässt
ihr kaum Raum an "diesen Dingen" festzuhalten, sie hätte ihre eigenen Bedürfnisse hintenan
gestellt, möchte das nun aber ändern:
Elisabeth: "Das waren nicht nur die finanziellen Einbußen, sondern auch die Zeit. Also ich bin
selbständig, ich unterrichte, habe sehr viele Privatschüler, Privatkunden, die halt von einem
Tag auf den anderen wieder weg sein können, wenn man selber nicht präsent ist. Also mein
78
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Business ist da ja quasi auch gefährdet, mehr oder weniger. Eben, also die Einbußen stark.
Persönlich eben auch, dass da gewisse Pläne, die ich verfolgt habe, jetzt einmal seit einem
Jahr quasi brachliegen, und jetzt erst langsam wieder so aufgenommen werden.
Int.: Ist das was Konkretes, oder - ?
Elisabeth: Ja, das sind quasi so – zum einen meine nähere und fernere Zukunft, wie ich mir
das eben vorstellt habe, angefangen von Urlaubsplänen. Ich bin gerne unterwegs (lacht, dann
wieder ernst) und so weiter. Bis hin eben zu quasi Familienplanung und so weiter. Also es
reicht halt da eben rein, und das ist eben alles brachgelegen. (…) Also das war eben dann
dadurch eben eingeschränkt. Also an diesen Dingen quasi festzuhalten. Es war auch gar nicht
Zeit da, es waren auch gar nicht die Gedanken dann da, also für diese Sachen. Was eben so
– okay, gut, wo sind jetzt meine eigenen Bedürfnisse, ja. Das ist ganz weggebrochen eine
Zeitlang. Und das hab ich mir auch wieder erkämpfen müssen." (Int. 02: 188ff.)
Im Fall von Gitti stellen sich die beruflichen Auswirkungen auf die Pflegetätigkeit noch deutlich
einschneidender dar. Durch die Übernahme der Pflege wurde die (Wieder-)aufnahme einer
Erwerbstätigkeit dauerhaft verhindert:
Gitti: "Ich meine, ich war zuerst, wie die Kinder klein waren, ich wollte da gar nicht arbeiten.
Ich wollte die Kinder, derweil sie klein sind, wollte ich daheim bleiben. Und dann war aber
schon mit der Schwiegermutter, dass es angefangen hat, und da habe ich mehr oder weniger
die letzten 15 Jahre gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu tun, weil ich eigentlich immer daheim was tun habe müssen. Also ich war da schon angehängt. Und jetzt wäre
es sowieso nicht möglich." (Int. 09: 24)
Ebenfalls ein Thema, das das eigene Wohlbefinden betrifft, ist jenes, das Lisa als "extremstes
Angebundensein" bezeichnet. Sie sei "wie in einem Gefängnis" gewesen. Wegen der Sorge
um die Schwiegermutter war es nicht möglich, das Haus auch nur für ein paar Minuten spontan
zu verlassen, ohne vorher eine Aufsicht zu organisieren:
Int.: "Könntest du in Bezug auf vorher sagen, was die größte Herausforderung war?
Lisa: Das war unterschiedlich eigentlich. Also zum Schluss sicher genau, also eben, dass man
wie in einem Gefängnis war, also zeitlich und von der Planung. Dass man das organisiert und
dass man das auch finanzieren kann. Also dieses extremste Angebundensein." (Int. 01: 228f.)
4.7.1.2 Beziehungsebene
In vielen Zusammenhängen, die die Pflegenden als schwierig beschrieben haben, geht es
nicht direkt um sie selbst, sondern um die Situation der an Demenz erkrankten Person und
wie dies auf die Beziehungsebene zwischen den beiden wirkt. Die Formulierung einer Interviewpartnerin, deren Partner an Demenz erkrankt ist, illustriert diese Dimension besonders
anschaulich: In einem Moment der Resignation und Wut sagt sie zu ihm: "Das gleiche
schwarze Loch (,in dem du sitzt), in dem sitz' ich auch". Themen, die also unter dieser Dimension der Beziehungsebene codiert wurden, umfassen: die schwierige Kommunikation (beiderseits!), Sorgen um die erkrankte Person und Wesensveränderungen im Laufe der Erkrankung. Es ist leicht erkennbar, dass diese Themen ineinanderspielen uns deshalb oft zusammen angesprochen werden.
Die schwierige Kommunikation ergibt sich aufgrund der kognitiven Einschränkung bereits
auf der rein semantischen Ebene. So sagt Felix, dessen Ehefrau an Demenz erkrankt ist, es
sei besonders schwierig für ihn gewesen, zu "erraten, was sie wirklich will". Dieses Thema
spricht er im Interview an mehreren Stellen an, was die Bedeutung für ihn unterstreicht. Zu
Beginn der Krankheit seiner Frau habe er gedacht, Probleme würden eher in anderen Bereichen auftreten ("also das Anziehen oder so was"), doch die Deutung ihrer Wünsche war für
ihn eine besondere Herausforderung:
79
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Int.: "Gibt es was, was Sie damals, als Ihre Frau noch hier war, besonders schwierig fanden?
Was für Sie besonders schwierig war?
Felix: Ja, eigentlich (das) Schwierige war nur diese Verständigung, was sie will, wenn sie was
gebraucht hätte. Wenn sie sagt, so ‚Weißt du eh, das‘ oder irgendwas oder gesucht. Das
eben, diese Verständigung, das zu erraten, was sie wirklich will. Das war eigentlich die
Schwierigkeit, ja. Das andere war eigentlich nicht so schlimm. Also das Anziehen oder so
irgendwas. Also das habe ich eigentlich auch zuerst gedacht, dass das ein Problem wird werden, aber sie hat das alles akzeptiert." (Int. 16: 106f.)
Außerdem kann es für die Angehörigen schwierig sein, ihren dementen Angehörigen für etwas
zu motivieren, das aus seiner Sicht nicht notwendig ist. Besonders zu Beginn der Krankheit
beobachteten einige Interviewpartner/innen eine Abwehrhaltung bei ihren Angehörigen, die
sich weigerten, Hilfe im Kontext ihrer Krankheit anzunehmen. Die weiter oben zitierte Patrizia
berichtet von ihrem Partner, der sich weigerte, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen
("ich bin ja nicht verrückt!"). Weil sie im bildhaft vermittelte, dass sie als Ehefrau im "gleichen
schwarzen Loch" sitzt, wie er und mitleidet, willigte er schließlich doch ein, den Psychologen
aufzusuchen:
Patrizia: "Drei Monate, nachdem er aus der Reha kam, fiel er in ein tiefes, schwarzes Loch,
weil er Sachen bemerkt hat, die er nicht mehr konnte. Und ein Freund von uns, der war bei
diesem Psychologen und hat gesagt, ‚Geh da hin! Und dann wirst du sehen, der möbelt ihn
auf, von der Stimmung her in Nullkommanichts!‘ Und er wollte das nicht. ‚Bin ja nicht verrückt!‘,
das war immer diese Aussage, die jeder Psychologe wahrscheinlich schon tausendmal gehört
hat. Und ich hab aber gesagt, ‚Und ich bestehe darauf, dass du da hingehst! Ich will, dass du
da hingehst! Denn das gleiche schwarze Loch, in dem sitz ich auch. Und ich will das nicht!‘
So." (Int. 13: 34)
Auch Gregor erzählt, dass sein Vater sich "stur" zeigt, bei ihm geht es um Unterstützung in der
Körperpflege: Sein 91-jähriger Vater kann nicht sehen oder akzeptieren, dass er sie nicht mehr
alleine bewerkstelligen kann:
Int.: "Was ist jetzt für Sie besonders schwierig an der Situation? Können Sie das sagen?
Gregor: Was schwierig ist, ist, dass er sich einfach nicht helfen lässt. Das ist momentan echt
das Schwierigste. Und einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, seine Sturheit. Er ist so,
naja, einfach,- ich sehe, dass er hilflos ist, dass er eine Hilfe braucht, aber er lässt sich nicht
helfen. Das ist wichtig. Das wäre wichtig für ihn. Es fängt ja bei der Körperpflege an, es fängt
beim Essen,- es wäre ja überall wichtig, dass ihm wer hilft. Und auf der anderen Seite will er
es aber nicht. Weil er kann alles allein, er will allein sein." (Int. 07: 63f.)
In Antons Fall leidet sein 77-jähriger Vater neben der kognitiven Einschränkung an Inkontinenz. Die Parallelität dieser beiden Krankheiten beschreibt Anton als besonders schwierig und
als Doppelbelastung, die vermutlich für sie beide galt: für den Vater, der erstens dement und
zweitens inkontinent ist; und für ihn als Sohn, der sich um beide Krankheiten kümmert, medizinische Entscheidungen treffen muss und gleichzeitig den Wünschen seines Vaters nachkommen möchte, der seine medizinische Situation selbst nicht begreifen kann. Anton sorgt
sich um dessen "Lebensqualität", weil der Vater gern in die Natur gehen möchte, aber wegen
seines Prostataleidens kaum das Haus verlassen kann:
Anton: "Das Schwierigste war eigentlich jetzt – Ja, prinzipiell einmal die Kombination Demenz
und Prostataleiden. (…) Das war immer eine Art Doppelbelastung, wo ich mir gedacht habe,
krank und dement: Schwer. Kann man das noch verantworten, dass er operiert wird, oder
kriegt man es doch medikamentös weg? (…) Und das war schon eine Hauptbelastung, weil
ich nie gewusst habe: Operieren – ja – nein, Medikamente – geht – geht nicht. Hat er noch
80
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Lebensqualität? Wie, wenn er dauernd einen Harndrang hat, was kann man dann noch machen mit ihm? Das war eine Hauptbelastung. Weil dauernd hat er ja Wünsche, hat er Ideen."
(Int. 05: 103ff.)16
So zeigt sich, dass bereits das Vermitteln von Tatsachen und alltäglichen Erfordernissen
schwierig sein kann, eben weil die demente Person kognitiv eingeschränkt ist und zudem gerade zu Beginn der Krankheit nicht unbedingt bereit ist, Einbußen im bislang selbstbestimmten
Lebensstil hinzunehmen.
Die Kommunikation auf rationaler Ebene wird naturgemäß schwieriger, je weiter die Demenz
fortschreitet. Eine Interviewpartnerin war so offen, zu berichten, dass eine verzwickte Situation
durchaus in Gewalt münden kann, weil verbales Überzeugen durch die pflegenden Angehörigen einfach nicht mehr fruchtet und sie an ihre Grenzen stoßen. Lisa, die jahrelang mit der
kognitiv schon sehr eingeschränkten (sie hat Wahnvorstellungen), aber agilen Schwiegermutter in einem Haus lebte, berichtet, dass es "hie und da passiert (sei), dass einer von (ihnen,
dem Ehepaar) ausgezuckt ist und kurz einmal losgebrüllt hat". Sie erzählt auch von einem
konkreten Vorfall, wo sie selbst die Schwiegermutter etwas "unsanft hinausbugsiert" habe,
woraufhin diese wiederum "ausgezuckt" sei:
Lisa: "Und das war auch oft in meinem Kopf so, in Richtung Gewalt, ja? Wo ich mir gedacht
habe, okay, wo fängt Gewalt an? (…)
Int.: Gab es körperliche Auseinandersetzungen?
Lisa: Ja! Ganz selten. Aber es hat eine Situation gegeben. Das war, glaube ich, als sie mir die
Kühltruhe ausgesteckt hat. Genau, ja. Also da bin ich wirklich zufällig draufgekommen, weil,
sie hat alles ausstecken wollen. Und ja, - Und aus irgendeinem Grund war sie da auch im
Keller, als ich das gesehen habe. Und ich war da wirklich zornig und habe dann (zögert) –
weil sie dann irgendwie blöd herumgetan hat – auf jeden Fall habe ich sie dann ein bisschen
unsanft versucht, hinauf zu bugsieren, dass sie raufgeht. Aber eh nicht wirklich, - ich habe sie
vielleicht ein bisschen geschoben, ja? Und daraufhin ist sie total ausgezuckt und hat gesagt,
ich haue sie und was weiß ich was. Also ganz extrem. Und ich habe sie dann gelassen und
bin raufgegangen, damit ich kurz einmal runterkomme. Und dann bin ich ein bisschen später
wieder gekommen und dann hat sie zu mir gesagt: 'Ist die schon weg? Ist die schon weg?'
(lacht herzhaft)." (Int. 01: 231ff.)
Genauso können auch die an Demenz Erkrankten aggressive Verhaltensweisen zeigen; bei
manchen gehört es zum Krankheitsverlauf. Patrizias Zitat zeigt, dass die Wutausbrüche ihres
Mannes Wut bei ihr selbst hervorrufen, aber auch "Schuldgefühle, wenn jemand so ausrastet":
Patrizia: "Dass man sich irgendwie schuldig fühlt, wenn jemand so ausrastet. Und das konnte
ich dann aber ablegen. Weil diese Wut, die war dann so groß, dass ich mich manches Mal vor
mir selber erschreckt habe. Und meine Therapeutin hat gesagt, ‚Da brauchst du dir überhaupt
keine Gedanken zu machen, man wird böse davon. Das ist die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu kompensieren‘. Ja." (Int. 13: 49)
Ein zentraler Begriff auf der Beziehungsebene ist jener der Sorge. Dabei fallen emotionale
und praktische Sorge oft zusammen: Man sorgt sich einerseits um den seelischen Zustand
des Angehörigen, wenn er etwa erkennt, dass mit ihm "etwas nicht stimmt" oder sich verlassen
fühlt, wenn er einmal kurz alleine gelassen wird oder auch um mögliche Gefahrensituationen,
die bereits angesprochen wurden ("natürlich die Angst, dass irgendwas ist, wenn einmal eine
halbe Stunde nicht überbrückt ist").
16 Nach der geglückten Operation ist Anton nun zuversichtlich, dass sie wieder gemeinsame Ausflüge in die Natur
unternehmen können.
81
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Das Zusammenkommen von emotionaler und praktischer Sorge ist im Fall von Zita besonders
deutlich zu sehen. Ihre 80-jährige Mutter lebt bei ihrem Bruder, sie holt sie an den Wochenenden zu sich. Ihre spezielle Situation ist, dass sie ihrem Bruder nicht vertraut, sich gut genug
um seine Mutter zu kümmern, für sie sichtbar in der Vernachlässigung ihrer Körperpflege. Das
ist ihre eher "praktische" Sorge. Sie plant, ihre Mutter permanent zu sich zu holen und hat
rechtliche Schritte eingeleitet:
Zita: "Und (wir werden) dem einstweiligen Sachwalter ein E-Mail schreiben und, so wie wir es
beim ersten Mal halt gemacht haben, eine Foto-Dokumentation vom körperlichen Zustand
meiner Mutter, damit völlig klar ist, die wird dort nicht gut versorgt. Ohne es selber wirklich
beeinflussen zu können. Also, klar habe ich sie dann in die Badewanne gesetzt und Nägel
geschnitten, diese Sachen gemacht. Aber dass dort jemand sich liebevoll um sie kümmert,
sodass es für sie auch angenehm ist, das kann ich gerade nicht beeinflussen, und das muss
ich aushalten in dem Wissen, dass es anders werden wird." (Int. 10: 37)
Ihre emotionalen Sorgen zeigen sich in den Momenten des Abschieds, wenn sie ihre Mutter
nach den gemeinsam verbrachten Wochenenden wieder zu ihrem Bruder bringt. Sie sieht, wie
schwermütig ihre Mutter ist, weil sie sich verlassen fühlt und nicht mehr zeitlich einschätzen
kann, dass und wann sie ihre Tochter wieder sehen wird:
Zita: "Ganz im Moment ist das Allerschwierigste, meine Mutter nach diesen, im Moment Besuchswochenenden, zurückzubringen und zu wissen, sie hat innerlich diesen Zeitrahmen
nicht mehr, dass ich ihr sagen kann, ‚Mama, nächsten Freitag hol ich dich wieder‘. Wenn ich
sage, ‚Okay, jetzt ist es Zeit, wir fahren, gehen wir uns anziehen‘, dann wird sie richtiggehend
schwermütig. (…) Und für mich ist das Schwierigste, sie dorthin zurückzubringen und zu wissen, in drei Minuten hat sie vergessen, dass ich sie nächsten Freitag wieder hole, und sie
weiß auch nicht, wann Freitag ist. Und die Zeit dazwischen ist für sie subjektiv eine sehr
lange." (Int. 10: 33)
Auch andere Interviewpartner/innen, die mit ihren Angehörigen nicht zusammenleben – und
bei denen es keine grundsätzlichen Konflikte mit den anderen Betreuungspersonen gibt – sorgen sich darum, ob die Person gut betreut ist oder haben zumindest eine gewisse Unruhe,
weil sie nicht genau wissen, wie sich die Situation in ihrer Abwesenheit gestaltet. Denn eine
zuverlässige Antwort von der dementen Person können sie naturgemäß nicht erwarten ("weil
sie es ja eh vergisst"):
Annika: "Da denke ich mir schon oft, wie geht es ihr? Man weiß es ja nicht genau, nicht? Ob
sie jetzt alles sagt, oder nicht, oder,- Es ist schwierig. Das beschäftigt mich schon, ja. Wo ich
mir auch oft denke, ‚Naja, wir sind die ganze Woche nicht da‘. Ich meine, sie sagt ja über die
Pflegerin im Prinzip nichts, weil sie es ja eh vergisst. Es ist sauber, es ist alles soweit in Ordnung. Nur ob sie sich dann mit ihr auch beschäftigt?" (Int. 11: 75)
Elisabeth geht es ähnlich. Auch sie würde sich wohler fühlen, wenn die Personen der Hauskrankenhilfe, die ihre Mutter betreuen, ihr mehr Auskunft darüber erteilen würden, wie es der
Mutter geht:
Elisabeth: "Es ist auch mit der Hauskrankenhilfe eben. Sie sind sehr bemüht und sehr professionell würde ich mal sagen, was ich eben so mitkriege und tun auch, was sie können sozusagen, um eben die Dinge abzudecken für meine Mutter. Aber es ist eben auch, die Kommunikation ist so, am Anfang waren sie schon bemüht, mit mir die Dinge auch abzusprechen,
aber jetzt, wo es sich so eingependelt hat, ist es wieder so ein Ding, dass es wieder von mir
aus geht, wenn ich wissen möchte, was da jetzt ist, wie es weitergeht, was meine Mutter
vielleicht braucht, was ihnen aufgefallen ist." (Int. 02: 130)
82
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Hier erwächst aus den Sorgen, wie die Betreuungssituation tatsächlich ist, bei einigen Interviewpartner/innen etwas, was sie selbst als "schlechtes Gewissen" bezeichnen. Annika beschleicht dieses schlechte Gewissen, wenn sie ihre Mutter nicht regelmäßig besuchen kann,
zum Beispiel weil sie selbst krank ist:
Annika: "…aber da (wenn sie im Heim wäre) hätte ich wahrscheinlich noch mehr ein schlechtes Gewissen, obwohl ich das jetzt auch manchmal habe wenn ich jetzt zwei Wochenenden
nicht fahren kann. Oder ich war auch krank vor zwei Wochen und dann beginnt es schon mit
schlechtem Gewissen. Also, es ist schon auch eine Belastung." (Int. 11: 107)
Auch Lena, die den Kontakt zum Vater weitgehend abgebrochen hat, weil er sich ihr gegenüber sehr aggressiv verhalten hat, nennt als das Schwierigste an ihrer jetzigen Situation ihr
schlechtes Gewissen. Zwar ist sie überzeugt davon, dass sie mit dem Kontaktabbruch richtig
gehandelt hat, doch trotzdem sei da ein "Zwiespalt", weswegen sie sich zumindest auf die
Telefonate mit ihm einlässt (er meldet sich regelmäßig bei ihr):
Int.: "Was ist so das Schwierigste für dich im Moment an der Situation?
Lena: Das schlechte Gewissen. Also das schlechte Gewissen, nicht da zu sein für ihn und
eben so dieser Zwiespalt, den ich natürlich habe. Wo ich sage, eigentlich würde ich das Ganze
gerne abbrechen, aber da ist eben das schlechte Gewissen, weshalb ich auch immer wieder
mit ihm telefoniere manchmal noch dann." (Int. 06: 72f.)
Eine weitere Dimension, die im Zusammenhang mit emotional Schwierigem angesprochen
wird, ist die wahrgenommene Wesensänderung oder zumindest das Nachlassen einiger Fähigkeiten und Interessen der dementen Angehörigen. Bereits kleine Momente dieser Erkenntnis können durchaus schmerzhaft sein, wie zum Beispiel, dass der Ehemann seine Ehefrau
beim falschen Namen nennt ("ich heiße Theresa, Sylvia war eine Masseurin") oder dass er
nicht mehr an Büchern interessiert ist, die ihm seine Ehefrau mitbringt ("er hat ja früher gerne
gelesen und war ein guter Unterhalter, das alles ist vorbei").
Wie aus medizinischer Sicht bekannt, kann es bei manchen Personen zu Beginn der Krankheit
und in Abhängigkeit der jeweiligen Krankheitsform zu aggressiven Schüben kommen. Für die
Angehörigen ist dies eine zusätzliche emotionale Last. Lenas Vater etwa ist so wütend, dass
er sie beim gemeinsamen Supermarkteinkauft mit dem Einkaufswagen anfährt. Sie erkennt
darin seine Krankheit und versucht diese Ausbrüche aus seiner Sicht zu verstehen, denn er
habe wohl darunter "gelitten", die Anfänge der Demenz erkennen zu müssen. Mittlerweile sei
die Aggressivität einer depressiven Grundstimmung gewichen:
Lena: "Er ist dann sehr aggressiv gegen mich geworden, hat mich auch persönlich sehr angegriffen oftmals, was natürlich alles eine Folge der Demenz ist. Also teilweise waren dann
Sachen, dass wir zusammen einkaufen waren, und er war wütend über sich, weil er irgendwas
nicht mehr wusste. Dann hat er mich mit dem Einkaufswagen angefahren. Oder, also lauter
solche Dinge. Er ist da wirklich aggressiv geworden, was ich natürlich verstehen kann unter
dem Aspekt, dass man selber merkt,- also er hat auch ganz oft am Telefon zum Beispiel, wenn
ihm Dinge nicht mehr eingefallen sind, bestimmte Wörter nicht mehr eingefallen sind, hat er
auch immer gesagt, ‚Mensch, er wird jetzt blöd, was ist denn los mit ihm?.‘ Also,- ja, er hat da
sehr darunter gelitten. Jetzt mittlerweile merkt er auch das nicht mehr, glaub ich, weil mittlerweile ist er nur noch depressiv am Telefon, aber nicht mehr aggressiv." (Int. 06: 31)
Zur wahrgenommenen Wesensveränderung gehört für manche auch, dass bestimmte Rollen
nicht mehr besetzt sind, zum Beispiel die der Mutter, die immer eine Ansprechperson war. Es
sei ein "Stück von Mama weggebrochen", so sagt es Elisabeth, die es als sehr schmerzlich
empfindet, dass sie das "freundschaftliche Verhältnis", das sie mit ihrer Mutter hatte, seit etwa
83
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
einem Jahr nicht mehr wie gewohnt fortsetzen kann. Mit Trauer erkennt sie, dass das "Bedürfnis", das sie gegenüber ihrer Mutter hat, nicht mehr befriedigt werden kann:
Elisabeth: "Und es ist schon eine sehr traurige Geschichte auch. Weil ich hab zu meiner Mama
immer ein gutes Verhältnis und freundschaftliches Verhältnis gehabt. Auch wenn wir uns oft
ein Jahr lang nicht gesehen haben. Wir sind immer in Kontakt gewesen. Wir erzählen uns,
haben uns immer auch alles erzählt. Und da ist eben jetzt so ein ganzes Stück quasi weggebrochen von meiner Mama. Wo ich jetzt nicht mehr dazu komme, sozusagen. Und da quasi
ein Bedürfnis in dem Sinn ja von mir nicht mehr abgedeckt wird. Nämlich dass ich eben mit
meiner Mutter über alles reden konnte. Und wir uns da viel auch geholfen haben. Wir Frauen
sozusagen." (Int. 02: 98)
Auch der 47-jährige Anton erkennt schmerzlich, dass die intellektuellen und auch künstlerischen Fähigkeiten seines Vaters schwinden. Er kann im wahrsten Sinne des Wortes den Ton
nicht mehr angeben – denn Vater und Sohn singen gemeinsam im Chor und Anton hatte sich
stimmlich immer an seinem Vater orientiert.
Anton: "Was wirklich schade ist, dass er früher wirklich ein sehr kluger Kopf war. Also, er war
Programmierer, und zum Beispiel jetzt beim Chor war immer er derjenige, der gesagt hat, das
ist falsch, das gehört so gesungen. Ich habe mich, wenn wir in derselben Stimme waren,
meistens bei meinem Vater angehalten, da hab ich gewusst, das haut hin. Wenn wir ein neues
Lied einstudiert haben. Zum Beispiel also. Und das geht jetzt nimmer mehr. Aber die Beziehung ist immer noch innig und respektvoll." (Int. 05: 55)
So wie Anton an dieser Stelle betont, dass die Beziehung zu seinem Vater emotional gleich
geblieben sei, nämlich "innig" und "respektvoll", ist im gesamten Interview die emotionale Zugewandtheit zwischen Vater und Sohn erkennbar. Sein Vater erkennt ihn auch noch und sie
können miteinander sprechen. Noch schwieriger wird es nämlich, wenn das "Vergessen" ein
Thema wird. Davor hat die 17-jährige Cornelia Angst, wenn sie über ihre Großmutter sagt:
Cornelia: "Das Einzige ist, wo ich mir manchmal Sorgen mache, dass, wenn ich zu lange weg
bin, dass sie sich vielleicht nicht mehr erinnern könnte. (…) Also das hat es prinzipiell noch
nie bei ihr gegeben bis jetzt, dass sie irgendwen nicht erkannt hat. Oder dass diese typischen
Fragen, die man von Demenzpatienten oft kennt, mit dem 'wer sind Sie?' und so was, so was
hat es noch nie gegeben. Und da mache ich mir halt schon Sorgen, wenn das vielleicht so
weiterentwickeln könnte und ich dann nicht so oft zu Hause bin, dass das dann bei mir vielleicht beginnen könnte. Weil meine Eltern halt doch jeden Tag da sind. Ja." (Int. 03: 129)
Auch kann es für die nahen Angehörigen schmerzlich sein, wenn ihre Gesten der Zuwendung
nicht mehr erkannt und erinnert werden, wenn also – aus soziologischer Sicht – eine Grundfeste des sozialen Austauschs nicht mehr funktioniert, das wechselseitige Geben und Nehmen, das den Fortbestand der sozialen Beziehung sichert. Besonders passend ist dazu das
Beispiel von Annika, die es sehr kränkt, dass ihre Mutter sich nicht mehr daran erinnern kann,
dass ihre Tochter ihr eine Blume geschenkt hat:
Annika: "Naja, schwierig ist, dass,- Ich meine, mich, wie soll ich sagen, beschäftigt schon oder
ist mir schon, dass sie eben (zögert), ja dieses Vergessen, dass sie es eben nicht weiß, wenn
ich ihr jetzt, weiß nicht, eine Blume schenke. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber dann
steht das am Tisch und, pft, sie weiß nicht, von wem das ist. So gewisse Dinge, wo ich mir
denke, ja, sie weiß eigentlich nichts!" (Int. 11: 75)
Ein ähnliches Beispiel findet sich in der Erzählung von der oben schon zitierten 17-jährigen
Cornelia, wobei ihr "Schenken" sich auf die emotionale Zuwendung/Zeit der Oma gegenüber
bezieht. Weil ihre Oma sich kurze Zeit später sowieso nicht mehr daran erinnern kann, wenn
Cornelia ihr im oberen Stockwerk des gemeinsamen Hauses einen Besuch abgestattet hat,
84
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
sieht sie auch keinen Sinn darin, das weiter zu tun. Der "Sinn" – nämlich das (dankbare) sich
daran Erinnern der Großmutter – sei nicht mehr da:
Cornelia: "Der Papa ist dann halt immer so: Ja, ich soll öfter raufgehen und so. Und ich bin eh
jeden Tag circa eine dreiviertel Stunde am Abend oben. Und ich muss dann nicht so, - dass
ich dann jeden Tag noch untertags mehrere Male raufgehe oder so, weil ich jetzt eh nicht sooo
sehr den Sinn darin sehe. Ich meine, klar, freut sie sich. Aber sie weiß es zehn Minuten später
auch nicht mehr." (Int. 03: 45)
Besonders schwierig ist im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Änderungen, die als
schmerzlich empfunden werden, dass sie nicht reversibel sind, denn die Demenz ist nicht
rückgängig zu machen – im Gegenteil. Auch das erwähnen manche Interviewpartner/innen als
besonders schwierig: die damit verbundene Hoffnungslosigkeit. Die beiden folgenden Zitate
zeigen das besonders eindrücklich:
"Int.: Was würden Sie sagen, war für Sie besonders schwierig in der Zeit?
Arnold: (überlegt länger) Was war besonders schwierig? Naja, eigentlich der Umstand, dass
man einer Situation ausgesetzt ist, die also ein trauriges Ende hat. Das. (weint ein wenig)"
(Int. 14: 69f.)
Marie: "Also so eine Pflege, du hast halt dann, das kannst du auch nicht mit einem Kind vergleichen. Weil bei einem Kind, da weißt du, das wird besser. Da hast du, das wird eigenständig
und so. Und bei einer dementen Person weißt du, es wird schlimmer. Du weißt nicht, wie lange
es geht, wie schlimm es wird, aber da ist keine Hoffnung mehr da. Wir hatten immer Hoffnung,
dass der Papa irgendwann wieder, was weiß ich, irgendwie fröhlich ist oder so, aber das hast
du halt als Mensch. Aber es ist eigentlich eine sehr deprimierende Situation, weil du eben
weißt, da kann eben nichts mehr Positives kommen. Es wird nur schlimmer." (Int. 08: 39)
4.7.1.3 Soziale Komponente
Drei Personen kamen bei der Frage nach "Schwierigem" auf Themen zu sprechen, welche
den weiteren Personenkreis angeht. Sissi und Curt leben beide mit ihrem/ihrer an Demenz
erkrankten Ehepartner/in zusammen und nehmen außerdem eine 24h-Betreuerin in Anspruch.
Beide empfinden dieses Zusammenleben mit einer fremden Betreuungsperson als Herausforderung. Während Curt darum bemüht ist, die Situation zu akzeptieren ("was soll ich machen, es ist besser so?!"), klagt Sissi eindeutig über "die fremden Leute im Haus". Sie ist nun
aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgesiedelt, weil es ihr peinlich ist, wenn der 20-jährige
Pfleger sie nachts schlafend sieht:
Int.:"Gibt es denn was, was schwierig ist? Sie schildern das jetzt sehr normal. Gibt es Herausforderungen?
Curt: Naja, das ganze Leben ist eine Herausforderung! Ist schon schwierig. Da habe ich jetzt,(lacht) Erstens habe ich jetzt eine 24-Stunden-Hilfe da, die ist jetzt dauernd um mich herum,
ja. Ich bin das,- Das ist für mich auch nicht so einfach. Ich täte auch lieber allein sein da. Das
ist sicher schwierig, ja. Aber was soll ich machen, es ist besser so." (Int. 12: 119f.)
Int.:"Was würden Sie sagen ist für Sie momentan am schwierigsten?
Sissi: Eigentlich die fremden Leute im Haus. Das ist,- Man ist nicht alleine, man kann nicht,Ich bin ausgesiedelt jetzt ins Gästezimmer, da haben wir jetzt eine Matratze drauf gelegt auf
das Bett. Und alles ist so,- Ich habe mein Gewand im Schlafzimmer natürlich drinnen. Neben
ihm kann ich nicht schlafen, weil er immer in der Nacht aufwacht, dann kommen die rein. Ja,
gut bei der (Name Pflegerin) wäre es noch weniger tragisch als Frau, aber der (Name Pfleger)
mit seinen 20 Jahren, also,- Das ist eigentlich das Schlimmste für mich." (Int. 17: 94ff.)
85
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Eine weitere Einschränkung sozialer Art wird von Theresa thematisiert: Ihr an Demenz erkrankter Mann kann gesellige Zusammenkünfte nicht mehr gut verkraften, er bekäme "Angst".
Mittlerweile empfangen sie als Familie keinen Besuch mehr zu Hause, sie trifft sich mit
ihren Freunden und Bekannten in der Stadt:
Theresa: "Oder man ist halt auch ein bisserl eingeschränkt mit Freundeskreis. Früher haben
wir recht viel Besuch gehabt, es war immer ein Treiben, ein Leben im Haus. Und jetzt ist
natürlich, wenn mehr Leute da sind, das strengt an. Dann kann er sich nicht konzentrieren,
dann muss er sich viel mehr zusammenreißen, sind zu viele Eindrücke. Das macht ihm dann
eigentlich Angst. Dann ist das auch schon wieder so, Besuch oder wenn man jemanden trifft,
dann ist es besser, man trifft sich irgendwo in der Stadt, weil daheim ist eher besser Ruhe,
geordnete Verhältnisse, nicht zu viele Leute." (Int. 15: 19)
4.7.2
Entlastendes
Die Interviewpartner/innen wurden außerdem gefragt, ob es etwas gibt, was Ihnen "besonders
gut tut" oder "Kraft gibt", wenn sie eine schwierige Situation oder Phase erleben. Insgesamt
zeigten sich fünf wiederkehrende Themen, die angesprochen wurden, oft in Kombination, das
heißt, nicht nur eines pro Person. Als entlastend identifiziert wurden also (1) der Zusammenhalt im Kreis der Helfenden (meist der Familie), (2) Austausch im Freundes- und Bekanntenkreis (wenn auch mit Einschränkungen), (3) Diagnose und Verstehen der Krankheit, (4)
Ablenkung und (5) ein auf sich selbst Besinnen.
4.7.2.1 Zusammenhalt: "Dass man nicht alleine ist"
Von einigen wird der Zusammenhalt in der Familie als besonders entlastend beschrieben. Auf
die Frage, was ihr am meisten Kraft gegeben hat, als die Schwiegermutter noch im gemeinsamen Haus wohnte und der Alltag für sie sehr anstrengend war, antwortet Lisa sofort: "na hundertprozentig meine Familie, also auf jeden Fall". Sie nennt ihren Mann und die beiden Kinder.
Gregor, der gemeinsam mit der Familie seinen Vater im gemeinsamen Haus pflegt, antwortet
ähnlich und bestimmt:
Gregor: "Was mir am meisten Kraft gibt? Wenn die Familie beieinander ist. (…) Und, also das
Schönste und wo man irrsinnig viel Kraft tanken kann, wenn alle beieinander sind." (Int. 07:
119)
Das Beisammensein mit seiner Frau, seinen zwei erwachsenen Kindern und deren Familie
gibt ihm Halt, wobei auch die Kommunikation Erleichterung verschafft, das "darüber Reden":
Gregor: "Durch das, dass wir uns ausreden und dass wir einfach viel reden darüber, über das,
können wir relativ gut umgehen damit." (Int. 07: 90)
In den beiden genannten Beispielen wird bzw. wurde der Vater bzw. die Schwiegermutter im
Familienverband gepflegt, von mehreren Angehörigen im gemeinsamen Haushalt, was hier
als eine entlastende Konstellation empfunden wird. Dabei zeigt ein weiteres Beispiel, dass es
nicht unbedingt andere Familienmitglieder sein müssen, die ein Gefühl von Zusammenhalt
vermitteln. Anton etwa, dessen Vater von einer 24h-Betreuung gepflegt wird, spricht von einer
"Kooperationsbasis" zwischen der Betreuerin, seiner Schwester und ihm selbst. Dieses Dreieck der aufgeteilten Verantwortung gibt ihm eine gewisse Sicherheit und so hätte er "nicht das
Gefühl, dass ich alleine dastehe":
Int.: "Wer oder was gibt Ihnen Kraft, wenn Sie mal was belastet in dem Zusammenhang mir
Ihrem Vater?
Anton: Naja, Kraft (überlegt) Es ist diese Kooperationsbasis, wo ich dann doch immer zurückgreifen kann. Einerseits die (Name rumänische 24h-Betreuung), die meinen Vater versorgt,
die auch mit ihm ins Krankenhaus gegangen ist. Wo ich sag, das rechne ich ihr hoch an. (…)
86
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Und meine Schwester hat eben das Formelle gemacht. Und ich habe ihn besucht. Also ich
hab nicht das Gefühl, zum Glück nicht das Gefühl, dass ich alleine dastehe. Wäre ich alleine
da gestanden, muss ich ehrlich sagen, hätte ich in manchen Fällen wirklich keinen Ausweg
gewusst. (…) Ja, also zum Glück kann ich, ich hab Reserven." (Int. 05: 60f.)
Obwohl Anton keine eigene Gründungsfamilie oder eine Partnerin hat, betont er, dass er sich
nicht alleine fühlt und dafür sehr dankbar ist. Denn er könne "die Hauptbelastung verteilen":
Anton: "Ich denke mir oft, wenn jemand wirklich allein ist in so einem Fall, (…) da denk ich mir:
Puh. Dem hilft ja dann gar keiner. Das habe ich zum Glück schon, deswegen kann ich jetzt
nicht sagen, ich habe die Hauptbelastung zu tragen. Nein, ich kann die Hauptbelastung eh
verteilen. Jetzt ist es zum Glück so, dass es läuft, ja." (Int. 05: 108)
So scheint der Zusammenhalt nicht unbedingt familial begründet sein zu müssen, vielmehr
kommt es darauf an, dass es einen Kreis engagierter Helfender gibt, die sich die Arbeit aufteilen und auch mit "Gefühl" dabei sind. Denn an anderer Stelle hatte Anton erläutert, dass er zu
den beiden 24h-Betreuerinnen ein fast familiäres Verhältnis habe.
4.7.2.2 Austausch: "Dieses gemeinsame Jammern war schon entlastend"
Ebenso wird der Austausch mit anderen außerhalb der Familie als entlastend wahrgenommen.
Das "gemeinsame Jammern" mit anderen pflegenden Angehörigen, wie Lisa es humorvoll formuliert, sei "schon ein bisschen entlastend" gewesen. Viel wichtiger seien aber ihr Mann und
ihre Kinder gewesen. Auch Annemarie erwähnt den kommunikativen Austausch als entlastend, auch bei ihr geht es um Personen, denen das Thema Demenz aus der eigenen Erfahrung
vertraut ist, entweder, weil sie im Pflegebereich arbeiten oder selbst als Familienangehörige
betroffen sind:
Annemarie: "Es waren einfach zuerst Berufskollegen und dann eben auch in meinem Bekanntenkreis. Eine Schwägerin habe ich, die arbeitet in der Hauskrankenpflege, mit der. Und dann
auch zum Beispiel die Chefin von der Hauskrankenpflege, mit der habe ich viel reden können.
Die war auch ganz, ganz offen, und wir haben alles gut austauschen können." (Int. 04: 52)
Ein paar Erzählpersonen besuchen oder besuchten regelmäßig Selbsthilfegruppen. Dabei
wurde die Selbsthilfegruppe nie als hauptsächliche Quelle für eine emotionale Entlastung genannt, eher geht es um Informationsaustausch von Erfahrungen, was die Pflege betrifft, so
sagt es Gitti, die zu Hause ihren Schwiegervater pflegt. Der Stammtisch sei "nicht schlecht",
aber über "viele Sachen redet man gar nicht mehr", denn "es hilft ja eh nichts", meint sie etwas
resigniert und bejaht auf Nachfrage, dass sie Unzufriedenheiten eher mit sich selbst abmacht
und nicht darüber redet:
Int.: "Wenn Sie so einen Frust haben, mit wem können Sie da am besten reden?
Gitti: (überlegt, seufzt) Ja, viele, also was jetzt die Pflege betrifft, muss ich sagen, ist dieser
Stammtisch, den wir haben, nicht schlecht, weil da kann man das alles sagen. Ja, was jetzt
speziell das betrifft. Andere Sachen, muss ich sagen, - über sehr viele Sachen redet man gar
nicht mehr.
Int.: Das machen Sie dann mit sich selbst ab so?
Gitti: Ah, ja. Mehr oder weniger. Stimmt, ja. Weil man weiß, dass das,- Ja, es hilft eh nichts.
(lacht ein bisschen)" (Int. 09: 59ff.)
Elisabeth äußert sich, als sie dezidiert danach gefragt wird, mit bewusster Abkehr gegenüber
Selbsthilfegruppen und findet gerade den Aspekt des Teilens von Erfahrungen als nicht erstrebenswert. Sie empfindet die Situation mit ihrer seit einem Jahr plötzlich dementen Mutter
87
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
als so "einnehmend", dass sie sich nicht vorstellen kann, "auch noch das Schicksal von anderen zu hören" und mit Empathie darauf zu reagieren ("also sorry, ich bin nicht Mutter Theresa"):
Int.: "Würde es Ihnen helfen, weil Sie jetzt so Selbsthilfegruppen erwähnt haben, so mit anderen sich regelmäßig auszutauschen? Oder Elisabeth: Weiß ich nicht. Also ich möchte eigentlich – ich bin kein Mensch, der quasi sein
Schicksal so groß teilt, beziehungsweise, wenn das eh schon mich so einnimmt, möchte ich
nicht das Schicksal von anderen auch noch hören. Also das wäre mir zu viel. Ich bin ja eh
schon so ein empathischer Mensch und nehme die Sachen wirklich ernst und versuche, das
Beste aus Situationen zu machen in dem Sinn. Und es ist mir zu viel, wenn ich dann eben
höre, wie es allen anderen dann auch noch geht. Also, sorry, ich bin nicht Mutter Theresa."
(Int. 02: 212f.)
Lisa hat ein paar informelle Kontakte zu Personen, die ebenfalls einen dementen Angehörigen
pflegen. Diese Kontakte zu Betroffenen seien zufällig entstanden:
Int.: "Hast du dich mit anderen Betroffenen ausgetauscht?
Lisa: Ja, zum Teil schon, ja. Also das ist, - so dieses gemeinsame Jammern (lacht etwas) war
schon ein bisschen entlastend, ja. (…)
Int.: Und woher hast du die gekannt, die anderen?
Lisa: Bekannte aus der Gegend einfach, die ich schon vorher gekannt habe. (…) Also man
stellt dann erst fest, wie viele Leute eigentlich mit sowas konfrontiert sind." (Int. 01: 198ff.)
Abseits des "gemeinsamen Jammerns", findet die wirklich entlastende Kommunikation bei Lisa
aber innerhalb der Familie (hauptsächlich mit ihrem Ehemann) statt, wie sie an anderer Stelle
betont.
Die Interviews legen nahe, dass die Kommunikation im "allgemeinen" Freundeskreis (d.h. der
nicht andere pflegende Angehörige umfasst) in Bezug auf die Demenzerkrankung eines Angehörigen eher eingeschränkt stattfindet. Freunde und Freundinnen werden von den Erzählpersonen im Zusammenhang mit emotionaler Entlastung kaum genannt, und wenn, dann eher
in nachgereiht, sie stehen "nicht sooo im Zentrum" oder man redet "nicht so wirklich ausführlich":
Cornelia: "Ich rede mit meinen besten Freundinnen darüber. Also es gibt vier Leute, mit denen
ich darüber rede. Manchmal. Aber sonst, - es ist jetzt nicht so, - Also nur, wenn wieder irgendwelche neuen Entwicklungen sind oder so was, dass ich dann mit jemandem darüber rede.
Aber nicht so wirklich ausführlich." (Int. 03: 93)
Lisa: "Also sonst eigentlich, alles andere, so Bekannte oder Freunde nicht sooo im Zentrum."
(Int. 01: 243)
Elisabeth: (…) "Natürlich auch Freunde, also die jetzt eben so das auch mitbekommen haben
auch. Aber es ist halt (kurze Pause) – also in der Gesellschaft, wenn man nicht selber betroffen ist, ist es nicht präsent." (Int. 02: 126)
Das letzte Zitat von Elisabeth deutet an, dass das Verständnis unter denjenigen, die nicht
"selber betroffen sind", eben eingeschränkt sei und legt nahe, dass vor allem Gespräche mit
denjenigen als entlastend empfunden werden, die die Situation nachvollziehen können, entweder weil sie selbst zur Familie gehören oder eine(n) an Demenz erkrankte(n) Angehörige(n)
betreuen oder pflegen. Dabei sind Freunde und Freundinnen aber ganz und gar nicht unwichtig: Sie können – gerade weil sie nicht selbst betroffen sind – von der manchmal schwierigen
Situation ablenken. Marie nennt als Entlastung "Freunde. So einfach die Ablenkung, dass sie
88
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
mit einem was machen" (Int. 08: 85). Dass die "Ablenkung" tatsächlich eine wichtige Quelle
der Kraft ist, wird weiter unten als eigener Punkt behandelt.
4.7.2.3 Verstehen: "Die Diagnose ist fast eine Erleichterung"
Als entlastend wurde ebenfalls der Aspekt genannt, dass die Diagnose der Demenz gestellt
wurde. Eigentümliche Handlungen zu Beginn der Krankheit bekamen mit der Diagnose einen
Namen und man konnte sie besser "einordnen" und auch verzeihen, wie es Lisa berichtet. Sie
hat nun Verständnis für ihre Schwiegermutter, die sich offenbar nicht charakterlich begründet,
sondern wegen kognitiver Einschränkungen plötzlich anders verhielt. In der Reflexion tut es
ihr Leid, dass sie sich ihr gegenüber manches Mal "unfair" oder "gemein" verhalten habe, weil
sie dachte, die Schwiegermutter würde absichtlich so handeln, als sie zum Beispiel alle von
Lisa im Garten gepflanzten Kohlrabi wieder aus der Erde zog:
Lisa: "Wenn jemand deine Kohlrabi erntet, wenn sie ungefähr so groß sind wie Radieschen,
und zwar alle, - dann kann man erst ein paar Wochen oder Jahre drüber lachen, auf jeden
Fall nicht sofort! (lacht). (…) Wenn man mal weiß, okay, das ist es und man kann das irgendwie einordnen, dann kann man sich anders verhalten. Also eigentlich ist eine Diagnose fast
eine Erleichterung. Weil sonst, wenn das nicht ist, dann ist man auch unfair. Weil man dann
natürlich glaubt, die Person macht das absichtlich oder sie will einfach nicht oder sie ist einfach
zu blöd. Und im Nachhinein betrachtet hat man sich in Wirklichkeit einfach gemein verhalten.
Weil man es nicht versteht." (Int. 01: 251, 258)
Auch im weiteren Verlauf der Krankheit hilft es den Angehörigen, wenn sie mehr darüber erfahren. Jetzt, wo Gregor und seine Familie mehr Wissen haben, sei es für sie "nicht mehr so
schlimm", sagt er. Auch habe das gemeinsame darüber Reden geholfen:
Gregor: "Und es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Dadurch, dass wir einfach viel
wissen, oder mehr wissen jetzt über die Krankheit, über die Demenz, ist es für uns nicht mehr
so schlimm, weil man weiß, der Opa ist krank, oder die Oma war auch krank. Und am Anfang
haben wir das ja nicht gewusst, was das ist. Und da wirst du,- also das kommt so schleichend,
wie bei der Oma, und irgendwann,- Man will das nicht wahrhaben. Und am Anfang, weil immer
was war, das hat dich selber aufgerieben auch schon. Und durch das, dass wir aber echt
miteinander geredet haben und gesagt, ‚Was ist das oder wieso ist das so oder was ist?‘
können wir wirklich gut umgehen damit." (Int. 07: 90)
Außerdem hilft ihm das Wissen um die Krankheit konkret im Umgang mit seinem Vater. Habe
er anfangs noch öfter mit ihm gestritten, hat er nun gelernt, dass er sich durch Anschuldigungen nicht mehr kränken lässt und ihm nicht mehr widerspricht. Denn er wisse nun, "wie es dem
Menschen tut", er kann sich in seinem Vater "irgendwie hineinleben":
Gregor: "Früher hat es mich irgendwie gekränkt, wenn er gesagt hat, ‚Du hast mein Werkzeug
versteckt oder hast mir das rausgenommen, hast es mir gestohlen‘. Das hat mich sehr gekränkt. Und heute sage ich, ‚Ja, brauchst du eh nicht mehr‘. Ja, sag ich ‚Was brauchst du das
denn noch?‘ Heute tut es mir nicht mehr so weh. Heute kränkt mich das nicht mehr. Weil ich
eben weiß, wie es dem Menschen tut. Weil ich mich dort eben irgendwie hineinleben kann.
Und das ist halt, wenn ich jetzt denke, jetzt kommt der Vater rauf zu mir und sagt, ich habe
seine Brieftasche gestohlen, dann schaust im ersten Moment einmal blöd aus der Wäsche.
Wenn ich aber weiß, der ist krank und der meint es nicht so und der weiß es am Nachmittag
eh nicht mehr – ja. Dann sag ich ihm halt irgendwas." (Int. 07: 125)
Eine spezielle Form der Auseinandersetzung ist die so genannte "Validation", eine Methode
nach Naomi Feil (siehe Kapitel "Diagnose und Therapie"), welche im Rahmen von Workshops
von Angehörigen von Menschen mit Demenz erlernt werden kann. Dieser Ansatz hat zum Ziel,
Menschen mit Demenz besser zu verstehen und die Kommunikation mit ihnen zu erleichtern.
89
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Annemarie hat eine solche Ausbildung absolviert und nennt diese, als sie danach gefragt wird,
als besonders entlastend:
Annemarie: "Und die Kraft, ja – Ich habe so eine Validationsausbildung gemacht, die hat mir
ganz viel Kraft gegeben, ganz viel. Und schon so durch meinen Beruf auch. Und schon auch,
dass ich halt zu Fortbildungen gegangen bin und so. Das gibt einem schon Kraft, ja." (Int. 04:
50)
Annemarie hat ihre neuen Erkenntnisse innerhalb ihrer Familie weitergegeben und berichtet
davon, dass nicht nur sie, sondern nun auch ihr Mann besser mit Situationen umgehen kann,
in denen seine demente Mutter sich sozial schwierig verhält. Sie erzählt von einer Situation,
die das sehr gut illustriert und deshalb ausführlich wiedergegeben werden soll:
Annemarie: "Und ich glaube, das hat mir ganz viel gegeben. Und auch für einen persönlich.
Weil da lernt man schon auch, wie man selber damit umgeht. Und speziell auch nicht nur ich
selber, sondern auch, dass ich das weitergeben habe auch an meine Kinder und an meinen
Mann und so weiter. (…) Ich will jetzt ein Beispiel erzählen: Wir sind am Abend beim Abendmahl gesessen, beim Jausnen sagen wir. Die Oma ist dort gesessen und wie immer hat jeder
seinen Sitzplatz gehabt, unter anderem mein Mann, das ist ihr Sohn. Dann ist sie aufgestanden, die Oma, hat hinübergegriffen zum Jausenbrettl von meinem Mann und hat gesagt: ‚Nie
einmal tät er mir eine Wurst geben!‘ Und hat aber vor ihr ein Brettl gehabt, wo alles oben war.
Das ganze Brot und alles. Und der, (Name) heißt mein Mann, der hat das aber schon gewusst,
dass das jetzt nicht bösartig ist, sondern weil es die Oma nicht mehr kann. Weil das kommt
von der Kindheit her, was wir in der Validation gelernt haben, sie hat als Kind zuschauen
müssen, wie der Besuch halt eine gute Jause gekriegt hat und die Kinder haben nix gekriegt,
oder nur was anderes. Und dann hat sie gesagt: ‚Nie einmal tät er mir eine Wurst geben!‘ Und
hat halt hinübergegriffen. Und mein Mann hat das aber gewusst, dass das so ist. Ein anderer
tät sagen, ‚Ja, hast eh alles dort‘ und so. Und das war die Validation. Das lernt man in der
Validation. (…) Die alten Leute können nicht anders, weil sie, weil einfach alles heraufkommt,
was sie erlebt haben. Das muss ich sagen war für uns schon eine große Hilfe daheim, dass
wir mit der Demenz anders umgegangen sind." (Int. 04: 60)
4.7.2.4 Ablenkung: "Mit dem beschäftigen, was mir taugt"
Weiter oben wurde bereits erläutert, dass für manche pflegende Angehörige Unternehmungen
im Freundeskreis eine emotionale Entlastung in dem Sinn von "Ablenkung" bieten können. Die
Ablenkung wurde auch von anderen Erzählpersonen als Quelle der Kraft genannt. Gregor
etwa unterstreicht den Wert, den ein zeitweise anderer Fokus hat: Man dürfe seine eigene
Gesundheit nicht aufs Spiel setzen:
Gregor: "Man darf es nicht zu sehr heranlassen, dass einen das krank macht. Und dass man
dann einmal selber so weit ist, dass man dann Hilfe braucht." (Int. 07: 92)
Die oben schon zitierte Marie erzählt, dass ihr Unternehmungen mit ihrer Familie gut tun,
ebenso Beschäftigung mit ihren Tieren. Sie meint, man müsse "für sich finden, was einen
ablenkt auch" und deutet damit an, dass der Fokus eben nicht permanent auf der Betreuung
der zu pflegenden Person und den damit verbundenen Handlungen und Gefühlen liegen sollte,
sondern andere Lebensbereiche wichtig sind, um Kraft zu schöpfen:
Int.: "Was hat dir am meisten Kraft gegeben, wenn es dir einmal nicht so gut ging damit?
Marie: Ja, mein Mann eben und Freunde. So einfach, dass die Ablenkung, dass die mit einem
was machen. Ja, das auch. Meine Tiere auch, dass ich viel mit denen gemacht habe. Auch
sicher das Gefühl, dass die Tiere auch dem Papa helfen, weil der auch immer Tiere um sich
hatte. Ja, so irgendwie. Für sich finden, was einen ablenkt auch." (Int. 08: 84f.)
90
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Unternehmungen mit Freunden, die nicht direkt in die Pflege-Situation involviert sind, Beschäftigung mit Hobbies oder einfach nur ein Spaziergang in der Natur sind für viele der Interviewpartner/innen wertvolle Aktivitäten der Ablenkung:
Int.: "Was gibt dir Kraft, wenn du mal nicht so gut drauf bist?
Lena: Einfach in den Wald gehen. Mit dem Hund in den Wald gehen und das einfach so ein
bisschen von mir lösen." (Int. 06: 74f.)
Curt: "Na, dann fahr ich zum Beispiel in die Stadt, geh zum Friseur, dann gehe ich zu meinem
Kartenbüro, mit dem ich gute Verhältnisse habe, schau, ob ich auch noch für diese oder jene
Oper was kriege. Oder dann treffe ich mich mit Leuten aus meiner (Name Firma)-Zeit oder mit
Leuten aus meiner (Name Firma)-Zeit. Die kenne ich alle, die treffe ich dann in der Stadt, da
gehen wir ins Kaffeehaus. Da sitz ich halt dort zwei Stunden, und dann komm ich um drei
wieder heim." (Int. 12: 224)
Theresa: "Also ich bin sehr kreativ. Ich habe eine eigene Bastelwerkstatt, wo ich dann wirklich
nach dem Dienst hinausgehe. Oder Garten, da bin ich den ganzen Tag draußen. (…) Und ich
kann mich eigentlich dann in meiner Freizeit wirklich nur mit dem beschäftigen, was mir taugt.
Also da muss ich echt sagen, das ist total schön." (Int. 15: 59)
Int.: "Was gibt Ihnen Kraft, wenn es mal schwierig ist?
Gitti: (überlegt länger) Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal fragt man sich selber, wie man
das eigentlich alles noch durchhält. Das ist schon so, dass das bei mir schon sehr grenzwertig
ist. Das Einzige,- Ja, eben meine Mutti. Wenn ich, also ab und zu, sie geht oft mit, wenn wir
spazieren gehen, dass die halt noch mit ist oder meine Schwester. Und noch so ein paar
einzelne Freunde, die man noch hat, wo man einfach,- Ich meine ich gehe weg, wenn ich
Termine habe, dann schaut mein Mann, dass er da ist. Also ich bin bei den Theaterspielern
dabei und gehe Karate. Also das schon. Das gibt einem schon viel dann, ja." (Int. 09: 57f.)
Auch die eigene Erwerbstätigkeit wurde als wohltuende Ablenkung genannt, um die mit der
Pflege verbundenen Herausforderungen einmal hinter sich zu lassen. Lisa meint, dass ihre
Teilzeitbeschäftigung "eigentlich mehr eine Erholung" war:
Lisa: "Also das Arbeiten gehen, das ist für mich mehr eine Ressource gewesen eigentlich, wo
ich gesagt habe, okay, da kann ich jetzt mal weg von der Situation. Das war eigentlich mehr
eine Erholung." (Int. 01: 97)
4.7.2.5 Selbstbesinnung: "Zur Ruhe kommen, damit mein Hirn aufhört zu rattern"
Ein paar Interviewpartner/innen meinen, dass sie belastende Situationen am besten verkraften, wenn sie sich mit sich selbst auseinandersetzen, entweder professionell unterstützt zum
Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie, oder inspiriert von Vorträgen oder Literatur. Annika
etwa hat erkannt, dass ihr schlechtes Gewissen, das sie beschleicht, wenn sie nicht bei ihrer
dementen Mutter ist, ihr nicht guttut und ist nicht gerechtfertigt. Sie hat eine Gesprächstherapie
begonnen, die sie in dieser Auseinandersetzung mit sich selbst unterstützt:
Int.: "Was hilft Ihnen dann, wenn Sie sich solche (negativen) Gedanken machen?
Annika: Naja, ich bin jetzt auch wieder in Gesprächstherapie, weil mich das schon teilweise
sehr auch belastet. Und eben mit diesem schlechten Gewissen. (…) Weil ich muss auch auf
mich schauen oder halt,- Nicht, dass ich das dann irgendwie umdrehe, dass ich sage, ‚Ja, das
brauche ich jetzt. Oder das ist jetzt für mich gut. Und nicht immer denke, ‚Was wird die Mama
am Wochenende machen, wenn ich nicht kommen kann?‘ Also da bin ich jetzt ein bisserl im,Ich muss sagen, es geht mir aber jetzt besser." (Int. 11: 108f.)
Patrizia wiederum, deren langjähriger Ehemann an Demenz erkrankt ist, fand einen Vortrag
91
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
entlastend, der ihr sozusagen das freie Geleit gegeben hat, sich auf sich selbst zu konzentrieren, weil er sagte: "es könnte nicht sein, dass einer sein Leben für den anderen aufgibt". Ihre
Entscheidung, ihren Mann in ein Heim zugeben, kann sie nun besser ertragen, auch weil sie
zusätzlich Unterstützung von einer Therapeutin erhält, die ihr geraten hat, ihren Mann nicht
täglich zu besuchen. Patrizia "übt" das nun:
Patrizia: "Gott sei Dank hatte ich so einen Vortrag gehört von Kurt Tepperwein17 zum Neuen
Jahr, und irgendwie machte mir das Ordnung im Kopf. Ja, weil,- Er hat da zwei Stunden gesprochen und hat gesagt, es könnte nicht sein, dass einer sein Leben für den anderen aufgibt.
Das Leben geht weiter. Auch wenn man, oder gerade, wenn man noch einige Zeit vor sich
hat. Dann soll man sich darum bemühen, dass man das fertig bekommt. Das hat mir sehr gut
getan. Und, ja, nun ist er also da in dem Heim, und ich fange gerade an, mich daran zu gewöhnen. Ich gehe nach wie vor zur Therapeutin, die mir letzten Donnerstag gesagt hat, ‚Jetzt
gehst du aber da nicht jeden Tag hin, sondern tust das, was du tun möchtest und gehst vielleicht einmal die Woche hin!‘ Ist mir gar nicht so leicht gefallen! Ich übe das jetzt gerade (lacht)"
(Int. 13: 16)
Auch Zita referenziert auf die Worte eines anderen, nämlich den Psychiater Viktor Frankl, die
ihr ein entlastendes Gefühl vermitteln. Als aktive und erfolgreiche berufstätige Frau mit drei
Kindern und einer weiteren pflegebedürftigen Person im Haushalt erkennt sie, dass auch Ruhepausen zwischendurch wichtig sind. Sie vertraut darauf, dass sich die Situation irgendwann
zum Guten wenden wird (sie möchte ihre Mutter vom Bruder zu sich holen) und meint, dass
"aussitzen" und "atmen" wichtig seien, damit das "Hirn aufhört zu rattern".
Zita: "Also, wenn es ganz schlimm ist, dann reduziere ich mich auf Viktor Frankl, der irgendwann mal gesagt hat, ‚Am Ende ist immer alles gut, und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch
nicht zu Ende‘. So, dann weiß ich, ich bin gerade mitten drinnen und es ist gerade beschissen,
aber es wird anders. Und dann gibt es manchmal so Situationen, wo ich das Gefühl habe, es
zerlegt mich komplett auf Einzelteile, weil auf der einen Seite muss ich es aussitzen, auf der
anderen Seite würde ich gern viel tun, bin aber über weite Strecken hinweg ohnmächtig, weil
ein Pflegschaftsverfahren dauert halt so lange, wie es dauert. Ahm (kurze Pause), auch ganz
banal: Atmen. Atmen hilft (lacht). Bewusst atmen, zur Ruhe kommen, damit mein Hirn aufhört
zu rattern." (Int. 10: 37)
Obwohl Zita einen Partner und eine große Familie um sich hat, blickt sie in der Bewältigung
der Herausforderungen eher nach innen und zeigt damit, dass die familiale Konstellation nicht
unbedingt ausschlaggebend dafür ist, dass der Austausch in der Familie als besonders wertvoll genannt wird – wobei das nicht heißt, dass er nicht auch wichtig ist. Dies bestätigt der Fall
von der 17-jährigen Cornelia und ihrer dementen Oma, die im Familienverband gepflegt wird.
Am Ende des Interviews, als sie danach gefragt wird, ob noch etwas "wichtig" sei, was bislang
nicht besprochen wurde, erwähnt sie, dass sie nicht mit in die Gespräche einbezogen werden
möchte, welche die Eltern über die Pflegesituation führen. Sie empfindet es so, dass ihre Eltern
ihr diese Kommunikation "aufdrängen". Ihr würde es damit schlechtgehen, sie möchte die Situation lieber mit sich selbst abmachen und wünscht sich, dass ihre Eltern "mit anderen Leuten" reden, wenn sie Hilfe bräuchten. Sie als Tochter sieht sich nicht in der Rolle derjenigen,
mit der sie darüber sprechen sollten.
Auch die 73-jährige Sissi, deren Mann mittlerweile schwer dement ist und von einer 24h-Betreuung im gemeinsamen Haushalt gepflegt wird, ist eher auf sich selbst fokussiert, wenn es
um das "Kraft tanken" geht. Ihr "Traum" sei es, einmal "zwei, drei Tage in eine Therme zu
Deutscher Unternehmer und Heilpraktiker, der sich mit Lebensthemen und Esoterik auseinandersetzt
und darüber Bücher schreibt.
17
92
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
fahren". Auch geht sie gern spazieren und trifft Freundinnen. Doch danach gefragt, ob sie sich
mit den Freundinnen auch über ihre Situation austauscht, verneint sie. Sie sei eher introvertiert
und das sei schon immer so gewesen:
Int.: Was tut Ihnen denn im Moment gut?
Sissi: (lacht) Ich wüsste eigentlich nicht, was ich sagen soll. Eigentlich das Einzige, was ich
positiv daran finde, ist, dass ich jetzt sage, ‚Okay, ich gehe jetzt mal eine Stunde spazieren
oder ich gehe jetzt auf einen Kaffee zu der Freundin oder zu der Freundin. Aber ansonsten ist
noch nicht so viel Positives.
(…)
Int.: "Reden Sie mit Freundinnen, anderen Personen über das, was Sie bewegt?
Sissi: Hm, eigentlich weniger (lacht)
Int.: Warum?
Sissi: Ich weiß es nicht. Ich war immer schon ein bisserl introvertiert. Ich wollte,- Habe ich
auch früher nicht gemacht, auch wenn wir irgendwann mal so ein bisserl Eheschwierigkeiten
gehabt haben. Waren keine großen, aber ich hab da nie irgendwen einbezogen oder reden
wollen.
Int.: Also machen Sie eher so mit sich selbst aus?!
Sissi: Ja. Eigentlich ja. Das war eigentlich immer schon so." (Int. 17: 112ff.)
Ohne viel Umschweife antwortet Elisabeth, die die Pflege für ihre Mutter in einem entfernten
Bundesland organisiert auf die Frage, wer ihr am meisten Kraft geben würde: "Ich selber!" und
belässt es dabei. Sie ist alleinstehend und erwartet von ihren beiden Brüdern nicht viel.
Freunde gebe es "natürlich auch", aber diese sind in dieser Hinsicht nicht so relevant, wie ihr
Zitat nahelegt:
Int.: "Sie haben jetzt schon gesagt, dass es für Sie schwer ist. Wo kriegen Sie Ihre Kraft her?
Wer gibt Ihnen oder wer oder was gibt Ihnen Kraft?
Elisabeth: Ich selber! Natürlich auch Freunde, also die jetzt eben so das auch mitbekommen
haben auch. Aber es ist halt (kurze Pause) – also in der Gesellschaft, wenn man nicht selber
betroffen ist, ist es nicht präsent." (Int. 02: 125f.)
4.8
Verantwortung: Engagement und Grenzen
Das folgende Kapitel untersucht, warum und inwieweit pflegende Angehörige Verantwortung
übernehmen und wo diese Verantwortung endet. Was assoziieren die Interviewpartner/innen
zum Begriff "Verantwortung"? Welche Rolle spielt die Beziehung zu der an Demenz erkrankten
Person? Und inwieweit beeinflusst das System "Familie" diesbezügliche Entscheidungen?
Es ist zu berücksichtigen, dass sich die befragten Personen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen befinden, was einerseits den Pflegeaufwand betrifft und andererseits ihre eigenen
zeitlichen und körperlichen Ressourcen, vor allem bestimmt durch die Lebensphase, in der sie
sich gerade befinden. So hat etwa eine Frau im Pensionsalter eher Zeit, ihren Partner umfassend zu betreuen, aber vielleicht nicht die Kraft, ihn alleine zu pflegen, sollte er nicht mehr
mobil sein; hier wird schon das "Aufheben" nach einem Sturz zur Herausforderung.
Die 17 Fallgeschichten wurden auf Themen und Formulierungen untersucht, die Aufschluss
darüber geben, wie sich die Interviewpartner/innen im Zusammenhang mit dem Begriff "Verantwortung" selbst verorten. Dazu wurde jedes Mal die Frage gestellt: "Ich gebe Ihnen einmal
das Stichwort 'Verantwortung' – was fällt Ihnen dazu ein?". Auch weitere Interviewpassagen
wurden in die Analyse miteinbezogen. Zu berücksichtigen ist, dass die Zuordnung thematisch
93
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
und fallspezifisch orientiert ist. Das heißt, dass eine Person sowohl damit zitiert sein kann,
warum sie Verantwortung übernimmt, als auch damit, wo sie ihre Grenzen sieht.
4.8.1
Verantwortung beanspruchen: "Ich krieg' es nicht übers Herz, da zuzuschauen"
Zwei Fallbeispiele zeigen, wie die aktive Verantwortung im Sinne einer Betreuungs- oder Pflegetätigkeit übernommen oder sogar eingefordert wird, obwohl die erkrankte Familienangehörige weiter entfernt lebt und "eigentlich" von jemand anderem versorgt wird. Die beiden Fälle
ähneln sich: Es handelt sich jeweils um die Tochter, die für ihre Mutter sorgt oder sorgen
möchte, weil sich die Brüder aus ihrer Sicht nicht genügend engagieren. Im Fall der 43-jährigen
Zita bemüht diese sich darum, ihre demente, aber mobile Mutter aus der Fürsorge ihres Bruders und ihres Vaters zu sich zu holen, weil sie meint, dass ihre Mutter nicht gut versorgt wird:
Zita: "ich traue mir einfach zu, ein Gefühl dafür zu haben, wie es ihr geht. Und das klingt jetzt
vielleicht total arg, aber das traue ich meinem Bruder und auch meinem Vater und dessen
Freundin, also der Freundin meines Bruders, schon gar nicht zu". (Int. 10: 39)
Ihre Formulierung, dass sie "ein Gefühl" dafür habe, wie es ihrer Mutter geht, weist bereits
darauf hin, was sie an anderer Stelle am Interview weiter expliziert: Sie fühlt sich ihrer Mutter
emotional verbunden und meint, dass sie und ihre Mutter innerhalb der Herkunftsfamilie "die
emotionalste Verbindung sicher hatten, und auch immer noch haben". So scheint es diese
enge Bindung an ihrer Mutter zu sein, die sie dazu motiviert, in einer recht massiven Art und
Weise die pflegerische Verantwortung einzufordern: Sie hat rechtliche Schritte eingeleitet, den
körperlichen Zustand ihrer Mutter fotografisch dokumentiert und dem einstweiligen Sachwalter
geschickt, "damit völlig klar ist, die wird dort nicht gut versorgt". Ihr Anliegen, die Mutter permanent zu sich zu holen, löst bei ihrem Bruder massiven Widerstand aus, und er bedroht sie
sogar mit einer Schusswaffe, als Zita sich in seiner Wohnung befindet und ihrem Vater erklären
will, warum sie die Mutter zu sich holen möchte. Doch Zita verfolgt ihr Vorhaben auch nach
diesem Vorfall, obgleich sie bereits ein "volles" Leben hat, wie sie sagt. Als erwerbstätige Mutter von drei Kindern sorgt sie außerdem gemeinsam mit ihrem Mann für dessen hochbetagte
Großmutter, die im gemeinsamen Haushalt lebt. "Verantwortung" sei sie also gewöhnt:
Int.: "Ich habe noch ein paar Stichwörter für Sie. Das erste heißt ‚Verantwortung‘.
Zita: Ja. Also ich habe drei Kinder, ich würde ein viertes auch noch kriegen, jetzt haben wir
halt eine Omi. Insofern ‚Verantwortung‘ ist kein Thema (lacht). Habe ich immer viel getragen."
(Int. 10: 43f.)
Sehr ähnlich – wenn auch nicht so prekär – gestaltet sich die Situation bei Elisabeth, die ebenfalls ihre beiden Brüder kritisiert, weil sie sich aus ihrer Sicht nicht genügend um ihre Mutter
kümmern. Sie wird schließlich selbst aktiv. Die beiden Brüder sind vor Ort, einer der beiden
wohnt mit der Mutter in einem Haus. Aber es ist Elisabeth, die sich mit einem Anfahrtsweg von
mehreren hundert Kilometern regelmäßig darum kümmert, dass alles im Haushalt funktioniert.
Ihre Brüder würden die "Verantwortung hin- und her schieben", also wird sie aktiv, bevor es
niemand tut:
Elisabeth: "Ich fahre einmal im Monat runter ein Wochenende. Manchmal, also, wenn ich Zeit
habe, auch eine ganze Woche zwischendurch und putze, koche, repariere, alles.
Int.: Warum machen Sie das? Warum glauben Sie, machen Sie das?
Elisabeth: Weil meine Brüder zu blöd sind und lieber streiten und die Verantwortung hin- und
her schieben, bevor sie einfach einen Schraubenzieher in die Hand nehmen und halt eben ein
Bild anschrauben." (Int. 02: 65ff.)
94
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Die Verantwortung anstelle der Brüder zu übernehmen ist für sie eine emotional-familiäre
Pflicht, der sie nachkommt, weil sie es "nicht übers Herz bringt, eben da zuzuschauen". So wie
viele andere Interviewpartner/innen, verbindet sie mit dem Begriff ein spontanes Reagieren
auf die Erfordernisse, man "funktioniert" und "handelt einfach", wobei auch eine gewisse
Selbstlosigkeit damit verbunden ist, wie sie für sich erkennt:
Int.: "Was fällt Ihnen zum Stichwort Verantwortung ein?
Elisabeth: Übernehmen. Müssen! Ja, was soll’s. Ist meine Mum, ja? Also ich krieg es nicht
übers Herz eben da zuzuschauen, also grad der eigenen Familie soll es ja gut gehen. Und
grad in so einer Situation. Selbstlosigkeit ist natürlich auch dabei, wenn man jetzt von Verantwortung spricht. Dass da so eine Selbstlosigkeit ganz stark zum Vorschein kommt, wo man
seine eigenen Bedürfnisse eine Zeit lang zurücksteckt. Gar nicht so bewusst, sondern eben
das passiert. Man funktioniert dann eigentlich nur wie eine Maschine, wenn man sieht: okay,
da fehlt’s, da fehlt’s, da fehlt’s. Und da handelt man dann einfach." (Int. 02: 134)
So wie bei Zita ist bei Elisabeth die emotionale Verbindung zu ihrer Mutter die treibende Kraft
dafür, dass sie einen Großteil der Verantwortung übernimmt ("ist meine Mum, ja?"). Im Interview erzählt sie davon, dass sie ein enges und freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Mutter
hat, sie war immer ihre Vertraute in vielen Fragen und Elisabeth konnte mit ihr "über alles
reden", man habe sich "auch viel geholfen". Ihre an anderer Stelle gebrauchte Formulierung
"wir Frauen" deutet an, dass es in der Familie eine Geschlechterlinie gibt, Mutter und Tochter
sind eine Einheit und distanzieren sich dabei von den Männern der Familie, namentlich den
beiden Brüdern. Der Vater ist ohnehin seit vielen Jahren abwesend, es besteht kein Kontakt
mehr. Insofern erklärt sich das Engagement von Elisabeth bestimmt aus diesem engen Band
zwischen Mutter und Tochter. Ihr Engagement wird dabei von den Brüdern als nicht so umfassend wahrgenommen, wie Elisabeth es selbst wahrnimmt. Denn danach gefragt, wie ihre Brüder die Situation sehen würden, sagt sie, da gebe es eine "komplette Realitätsverschiebung".
Jeder meint, er hätte die Hauptverantwortung:
Elisabeth: "Und (ich) werde aber von den Brüdern so gesehen, dass, ich bin ja diejenige, die
am wenigsten macht, die so weit weg ist. Und sie sind die, die alles (lachend) übernommen
haben. Also komplette Realitätsverschiebung. Nicht nur meine Mama (lacht).
Int.: Wenn ich jetzt fragen würde: ‚Wer ist hauptverantwortlich für die Betreuung Ihrer Mutter?‘
Was würden Sie da sagen?
Elisabeth: (überlegt) Die Hauskrankenhilfe und ich.
Int.: Und Ihre Brüder, was würden die sagen?
Elisabeth: Sie (selbst)." (Int. 02: 164ff.)
Auch wenn beide Frauen die Übernahme ihre Verantwortung als Selbstverständlichkeit deklarieren, gibt es doch ein stark aktives Moment, sie nehmen die Verantwortung nicht nur an, weil
sie etwa mit der Mutter zusammenleben würden, sondern sie setzen sich ein, nehmen Wege
und innerfamiliäre Unannehmlichkeiten in Kauf, um für die Mutter da zu sein, zu der sie eine
besonders starke Bindung haben. Interessant ist die fast deckungsgleiche Konstellation, dass
in beiden Fällen zwei Brüder anwesend wären, die aber in ihrer Betreuungs- und Pflegetätigkeit abgewertet werden, so dass jeweils die einzige Tochter als Pflegeverantwortliche für die
Mutter hervortritt.
4.8.2
Verantwortung annehmen: "Ich kann mich ja nicht einfach so abseilen"
Am häufigsten war in den Interviews als Antwort auf die Assoziationsfrage zur "Verantwortung", dass es doch "selbstverständlich" sei, sich für den Familienangehörigen verantwortlich
zu fühlen und organisatorische oder pflegerisch-betreuerische Verantwortung zu übernehmen.
95
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Oder es wurde einfach kurz bestätigt, dass man sich "schon verantwortlich" fühle für denjenigen, der nicht mehr alleine auf sich schauen kann. Das Warum wird oft nicht weiter expliziert,
so als gebe es nicht viel zu überlegen, inwieweit Verantwortung übernommen wird oder nicht.
Man stellt sich den Tatsachen:
Annika: "Naja, ich fühle mich schon verantwortlich für die Mutter, also für die Mama. Also das
(kurze Pause) würde ich, ja, würde ich schon. Weil sie eben ja nichts selbst entscheiden kann.
Also, entscheiden. Ich meine, auch was das Geld oder eben, was zu zahlen ist, das weiß sie
ja alles nicht mehr." (Int. 11: 94f.)
In vielen Zitaten werden ethisch-normative Formulierungen sichtbar, im dem Sinn, dass
sich die Interviewpartner/innen nicht nur selbst positionieren, sondern formulieren, was sich
generell "gehört", was "man tun muss". Arnold etwa, der lange seine Frau zu Hause gepflegt
hat, formuliert so etwas wie eine Aufgabe ("Verantwortung annehmen!"), die er erfüllt und fügt
hinzu, dass ihm das Verantwortungsgefühl vielleicht deswegen vertraut ist, weil er lange als
Lehrer gearbeitet hat:
Arnold: "Verantwortung annehmen! So wie ich es gemacht habe. Das ist für mich kein
Fremdwort, so ein Thema, das nur andere Leute angeht. Vielleicht kriegt man das auch im
Beruf mit, wenn man Lehrer ist und immer mit Menschen zu tun hat, entwickelt sich das." (Int.
14: 95)
Sehr deutlich wird in den Interviews die auf die Familie gerichtete Verpflichtung, die in der
Norm enthalten ist: Für auf Hilfe angewiesene Familienmitglieder hat man da zu sein. Entweder wird das als Anspruch an sich selbst formuliert oder aber es wird die Haltung der eigenen
Familie erläutert, die nämlich erwartet, dass Ehepartner füreinander sorgen oder Kinder für
ihre Eltern. Marie formuliert das in einem generellen Statement und fügt an, es sei einerlei, ob
man die "Familie leiden kann" und Curt meint, "die gesamte Welt" würde von ihm erwarten,
dass er für seine Frau da ist – wobei er mit der "Welt" seine Familie und Freunde meint:
Marie: "Ja, Verantwortung hast du für dich selber und für deine Angehörigen. Und genauso ist
es bei der Demenz. Du hast halt die Verantwortung, für die Familie da zu sein. Ob du die
Familie leiden kannst (lacht ein bisschen) oder nicht, ist egal. Glaub ich." (Int. 08: 95)
Int.: "Glauben Sie, dass von Ihnen erwartet wird, dass Sie
derjenige sind, der so voll für Ihre Frau da ist?
Curt: Ja, das glaub ich schon. Das glaub ich schon, ja (lacht). Das glaub ich sehr, ja.
Int.: Wer ist das, wer erwartet das von Ihnen?
Curt: Na alle, die gesamte Welt! (lacht) Meine Kinder, meine Freunde, alle erwarten das von
mir! Ihre Schwester ganz besonders (lacht). Ja, ich kann mich ja nicht einfach jetzt abseilen.
Ich kann nicht einfach, ich kann nicht morgen in den Flieger steigen und abhauen, das geht
nicht (lacht)." (Int. 12: 315)
Auch Anton zitiert die Norm, dass man für die Familie da sein sollte, klingt aber etwas zurückhaltend, wenn er sagt, dass man Verantwortung übernehmen müsse, "obwohl sie niemand
wirklich will":
Anton: "Ja, Verantwortung ist das, was übernommen werden muss, obwohl sie niemand wirklich will (lacht). Ist auch wie in der Arbeit: Geld verdienen gern, Verantwortung naja, schauen
wir mal, ob wir nicht – Aber natürlich eine Sache, die, wenn es hart auf hart geht, die man
wahrnehmen muss. Da kann man sich nicht einfach abseilen und sagen, nein, ich mach jetzt
auch Urlaub, mich geht das alles nix an. Ja, also Verantwortung ist einmal da sein, wenn man
gebraucht wird. Das ist so meine Assoziation. In der Familie." (Int. 05: 83)
96
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Warum Anton an dieser Stelle etwas zurückhaltend klingt, ist unklar, denn er kümmert sich
aktiv und liebevoll um seinen Vater und scheint sich mit seiner Situation gut arrangiert zu haben.
Weitaus positiver sehen diese Familien-Norm Annemarie und Gregor. Beide pflegen im Familienverband einen Angehörigen der Elterngeneration und sehen in der Fürsorge innerhalb der
Familie "etwas Schönes" oder "ganz was Großes". Annemarie beschreibt diese Einstellung
quasi als Tugend, die zwischen den Generationen weitergeben wird und fast als vererbter
Charakterzug dargestellt wird ("das ist so drinnen"):
Annemarie: "Wie soll ich sagen, das Verantwortungsgefühl, das war, das ist, auch bei meinem
Mann,- das war immer ganz, ganz groß. Wir hätten das nie so verantworten können, dass
unsere Eltern nicht ordentlich alles gehabt hätten oder dass man für sie nicht hätte das Beste
hätte wollen und alles. Gut geschaut haben wir. Das ist so drinnen. Und auch wieder wir unseren Kindern so weitergeben. Unsere Kinder sind auch wieder so. Das ist für uns ganz was
Großes. Die Verantwortung, das war, eigentlich immer ist das da, ja. Und jetzt auch geht es
weiter, muss ich sagen. Ich glaube, unsere Kinder sind auch so." (Int. 04: 64)
Gregor: "Verantwortung? Was soll man dazu sagen? (überlegt) Ich fühle mich einfach verantwortlich für ihn. Das ist, weiß ich nicht, das ist richtig oder nicht richtig, aber ich fühle mich
einfach für ihn verantwortlich, und das ist eine Verantwortung, die man einfach gerne übernimmt auch. Das ist ja, so wie er früher für uns verantwortlich war, für Kinder und das, ist man
halt sehr lange jetzt für ihn verantwortlich. Und ist ja was Schönes auch wieder. Und auch so,
dass man die Verantwortung,- Ich will auch keine Verantwortung irgendwie abwälzen auf irgendwen anderen oder was. Mir macht das nichts. Das, was ich mache, das mache ich gerne,
und sonst mach ich es eh nicht." (Int. 07: 104)
Gregor spricht hier außerdem einen Aspekt an, der im folgenden Unterkapitel weiter vertieft
wird, weil er von mehreren Interviewpartner/innen von Bedeutung war: die Umkehr der Verantwortung im Lebenslauf und Generationenkontext ("so wie er früher für uns verantwortlich
war"), die ebenfalls eine Rolle dabei zu spielen scheint, ob man bereit ist, innerfamiliale Pflege
zu übernehmen.
4.8.2.1 Generationenbeziehung: "Etwas zurückgeben"
Einige Interviewpartner/innen erzählten, dass sie die Pflege übernehmen, weil sie im Sinne
der Generationensolidarität etwas "zurückgeben" möchten. Vor allem diejenigen, die Schwiegereltern oder Großeltern pflegen, haben diesen Aspekt angeführt.
Annemarie zum Beispiel, die seit knapp 40 Jahren gemeinsam auf einem Bauernhof mit den
Schwiegereltern lebt, spricht vom "gegenseitigen Geben und Nehmen", das sich "immer mehr
gesteigert" hätte. Zunächst hatten die Schwiegereltern die Betreuung von Annemaries Kindern
übernommen, so dass sie keine externe Betreuung brauchten, und so hatte man auch beide
Großeltern innerfamilial statt extern betreut und später gepflegt. Nach und nach hätte sich das
Verhältnis umgekehrt, was sie am Beispiel der Essensversorgung illustriert:
Annemarie: "Und irgendwie auch ein bisserl auch das, weil die Oma und der Opa, die haben
auf meine Kinder geschaut, ich habe sie nie müssen irgendwo hingeben. Das war ein bisserl
so eine Gegenseite auch. Und dann ist man so drinnen, und das ist halt so." (…) Zuerst (in
der Kindheit/Jugend) hat meine Tochter bei ihr das Essen oft bekommen, dann hat aber meine
Tochter für sie schon Sachen gemacht. Da war meine Tochter in der Mittelschule, da hat sie
für die Oma schon was heruntergebracht zum Essen und so." (Int. 04:30, 50)
97
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Bei Lisa ist die Situation ähnlich. Sie erzählt, dass sie, gemeinsam mit ihrem Mann und ihren
Kindern, die Schwiegermutter zunächst im eigenen Haus betreut haben und auch jetzt, nach
ihrer Übersiedlung ins Heim, diejenigen sind, die sich hauptverantwortlich um sie kümmern.
Dass sie – und nicht der Bruder ihres Mannes – die Pflege im Haus übernommen haben,
begründet Lisa damit, dass die Schwiegermutter früher auf ihre beiden Kinder geschaut und
sie damit "extremst entlastet" habe. Nur so hätte Lisa ihr Studium inklusive Doktorat abschließen können und einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Sie sagt ganz klar, dass dies ein
"Kriterium" dafür war, dass ihre Fürsorge "selbstverständlich" war:
Lisa: "Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch schon ein Kriterium, warum das auch
selbstverständlich war, dass WIR uns kümmern: Also sie haben uns beide damals bei (Name
des ersten Kindes) extrem unterstützt, sonst wäre das nicht so möglich gewesen mit dem
Arbeiten gehen. (…) Und die Schwiegermutter hat quasi, - also ich habe überhaupt nichts zu
Hause machen müssen, ja? Das hat alles sie gemacht. Also sie hat gekocht, die hat mir die
Wäsche gebügelt. Also die haben mich schon extremst entlastet, muss ich sagen. Also von
daher, ja. Und dann hat es sich halt irgendwann umgekehrt." (Int. 01: 181ff.)
Lisas Darstellung erscheint eher als faire Anerkennung denn als emotionale Zuneigung für die
Schwiegermutter, was bereits in dem technischen Wort "Kriterium" anklingt, welches zudem
eigentlich im Widerspruch zur "Selbstverständlichkeit" steht (entweder ist etwas selbstverständlich oder es gibt Kriterien zur Abwägung). Tatsächlich bestätigt Lisa an einer anderen
Stelle des Interviews, dass ihre Beziehung zur Schwiegermutter kein Naheverhältnis war, obwohl sie schon viele Jahre in einem gemeinsamen Haus leben. Die Schwiegermutter sei das
"komplette Konträr" zu ihr, zwischen der Akademikerin Lisa und der Hausfrau gibt (gab) es
wenige Berührungspunkte. Erst als sie krank wurde, kann Lisa sie besser annehmen.
Lisa: "Also außer über das Kochen und über ihre kleine Welt hast du eigentlich nicht wirklich
mit ihr über etwas anderes reden können. Und eigentlich je mehr sie bedürftiger geworden ist,
umso mehr habe ich sie eigentlich auch mehr angenommen in Wirklichkeit." (Int. 01: 95)
Auch Cornelia kommt beim Stichwort "Verantwortung" auf das Thema der umgekehrten Fürsorge zu sprechen: Die im selben Haus lebende Großmutter hätte früher auf sie geschaut, als
sie Kind war, und nun würde sie manchmal auf die Oma schauen, wenn ihre Eltern nicht zu
Hause sind; die Verantwortung hätte sich "dann ziemlich schnell umgekehrt":
Int.: "Ich habe dann noch ein Stichwort. Einfach nur spontan, was dir dazu einfällt. Das erste
wäre Verantwortung.
Cornelia: Dass sich das halt umkehrt teilweise. Weil, als ich klein war, hat sie immer auf mich
aufgepasst, hatte halt sozusagen die Verantwortung. Und es war dann auch schon so: Als sie
noch keine 24h-Pflege hatte, aber schon nicht mehr so gut beieinander war, dass meine Eltern
auch gesagt haben, dass ich raufschauen soll und aufpassen soll, dass alles okay ist, wenn
sie einmal weg waren. Also dass ich dann sozusagen eher so die Verantwortung hatte im
Haus, wenn wir nur zu zweit da waren. Dass sich das dann ziemlich schnell umgekehrt hat
eigentlich." (Int. 03: 92f.)
Ebenso wie Lisa, empfindet Cornelia nur eine eingeschränkte von Emotion geleitete Motivation, sich mit ihrer Großmutter zu beschäftigen; sie besucht sie zwar einmal am Tag, aber ist
weniger engagiert, als ihr Vater das von ihr einfordert. Insofern ist es ihr Verständnis, dass
man zwar etwas "zurückgibt", dass es aber durchaus Grenzen gibt (dazu siehe weiter unten,
am Ende des Kapitels "Grenzen").
Interessant ist, dass dieses intergenerationale "Zurückgeben" nicht von Interviewpartner/innen
thematisiert wurde, die als Kind ihre Eltern pflegen (im Gegensatz zu Schwiegertöchtern und
-söhnen). Mit Blick auf die oben zitierten Kinder, die aus innerer Verbundenheit zur Mutter die
98
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Pflegeverantwortung übernehmen, ist das hier erkennbare rationale Abwägen möglicherweise
eher typisch für angeheiratete Familienmitglieder. Aufgrund der kleinen Gruppe der Befragten
ist dies aber nur ein erster Gedanke, der nicht als Hypothese formuliert werden kann.
4.8.2.2 Partnerschaft: "Nicht nur für schöne Tage"
Eine ganz andere Situation als bei der Erkrankung von Eltern oder Schwiegereltern ergibt sich,
wenn der Partner oder die Partnerin an Demenz erkrankt. Anders als bei der Eltern-Kind-Beziehung ist das Eingehen einer Partnerschaft selbstgewählt, und zwar meist mit dem Anspruch, dass sie ein Leben lang hält und man gemeinsam altert, wohingegen das frühere Ableben der eigenen Eltern zu erwarten ist.
In unserer Stichprobe gibt es sechs Personen, die mit ihrem/ihrer Ehepartner/in zusammenlebten, als die Demenz diagnostiziert wurde. Diejenigen von ihnen, die betonen, dass sie sich
für ihren Partner verantwortlich fühlen und diese Verantwortung auch angenommen haben,
begründen dies mit der partnerschaftlichen Verbundenheit, die sie empfinden, ziehen aber
auch durchaus "Bilanz", was die bisherige Ehe betrifft.
Arnold ist 79 Jahre alt und hat seine Frau bis zu ihrem Tod zu Hause gepflegt, gemeinsam mit
einer 24h-Kraft. Er formuliert seine Motivation, für seine Frau da zu sein, fast so, wie das Ehegelübde lautet: "Nicht nur für schöne Tage":
Arnold: "Wir hatten eigentlich eine gute Ehe geführt, und ich konnte mich auf sie auch immer
verlassen. Sie war auch immer für mich da. Das war sie eigentlich. Nicht nur für schöne Tage."
(Int. 14: 60)
Kurz deutet er auch das Motiv an, das weiter oben schon angeklungen ist: das "Zurückgeben"
von erfahrener Unterstützung: Auch seine Frau sei "immer für (ihn) da" gewesen. Dass er die
Pflege übernommen hat, sei für ihn nicht leicht gewesen, aber er habe es gern getan und "nie
als Belastung" erlebt. Er beschreibt den Umstand, dass er sich der schwierigen Situation angenommen hat, als positive Erfahrung:
Int.: "Gab es etwas Positives in der Zeit, wo Ihre Frau krank war für Sie?
Arnold: (Pause) Na einfach dieser Umstand, dass ich mit dieser Situation leben gelernt habe.
Weil ich hab das nie als Belastung empfunden. Und das verstehen manche Leute nicht. (längere Pause18) Mehr weiß ich nicht dazu." (Int. 14: 143)
Auch Interviewpartner Curt fühlt sich für seine Frau verantwortlich, mit der er seit über 50 Jahren verheiratet ist ("Verantwortung habe ich, klar"). Zwar habe es seiner Ehe "manchmal
Knatsch und Wickeln" gegeben, aber die Partnerschaft habe "funktioniert", wie er sagt:
Curt: "Wenn man so lange verheiratet ist, gibt es natürlich manchmal Knatsch und Wickeln
(lacht). Aber die haben sich wieder gelegt. Es kam niemals dazu, dass ich da, dass wir gesagt
hätten, ‚Na, hören wir auf miteinander‘. Nein, nein. Und jetzt überhaupt, so Blödsinn. Also
Partnerschaft hat schon funktioniert, ja." (Int. 12: 256)
Auch Sissi zieht eine Art Bilanz, wenn sie auf ihre lange Ehe zurückschaut, die sie "im Großen
und Ganzen" als "harmonisch" bezeichnet. Obgleich ihr Mann auf seinen vielen Reisen wohl
nicht immer treu war, beschreibt sie ihn als "wahnsinnig liebevollen Ehemann eigentlich" –
eine Formulierung, die durchaus Ambivalenzen zeigt:
18
Vermutlich weint Arnold ein wenig (aus der Erinnerung der Interviewerin).
99
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Sissi: "(Unsere Partnerschaft) war im Großen und Ganzen also immer (kurze Pause) harmonisch, vielleicht aus dem Grund, dass wir uns auch nicht wahnsinnig, nicht ununterbrochen
gesehen haben und er also sehr viel unterwegs war. (…) Mit Höhen und Tiefen natürlich
schon, wie es in jeder Partnerschaft vorkommt. Aber im Großen und Ganzen ist es,- Vielleicht,
weil ich auch sehr viel einstecken konnte. Ja, ja. Weil so ganz ohne war mein Mann auch
nicht, (lacht kurz auf) bei seinen Geschäftsreisen. Aber ich glaube, er hat nie eine feste Beziehung gehabt. Nein, das hätte ich auch gemerkt. Aber so kleine Ausrutscher waren schon
da.
Int.: Haben Sie darüber hinweggesehen?
Sissi: Ja. Er war ja sonst ein wahnsinnig liebevoller Ehemann eigentlich. Da kann ich nichts
sagen. Aber wie gesagt,- Wir haben ja vorgehabt noch so viel. Reisen und,- Ja, es kommt halt
alles anders." (Int. 17: 173ff.)
Trotz seiner "Ausrutscher" ist es für Sissi keine Frage, dass sie für ihren Mann da sein möchte,
ihre Bilanz ist positiv.
So zeigen diese Interviewausschnitte von pflegenden Ehepartner/innen, dass die Übernahme
der Pflege in einer Partnerschaft durchaus mit rückblickenden Überlegungen im Sinne einer
emotionalen "Bilanz" (wie war unsere Ehe?) verbunden sein kann, aber insgesamt der Wert
des Beieinander Bleibens auch in schlechten Zeiten ein großes Gewicht zu haben scheint.
4.8.3
Pflichtgefühl gegenüber Dritten: "Aus Liebe zu meinem Mann"
Zwei Interviewpartner/innen stellten in ihrer Erzählung eher andere Personen als ihren erkrankten Angehörigen beziehungsweise die ganze Familie ins Zentrum, wenn sie erläuterten,
warum sie die Betreuungs- oder Pflegeverantwortung übernommen haben. Sie befinden sich
in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, aber treffen sich in ihren Geschichten an genau
dieser Begründung. Zum einen ist das Theresa, Mutter von drei Kindern, deren Mann im Alter
von 40 Jahren an Demenz erkrankt ist, die andere ist die 50-jährige Gitti, die hauptverantwortlich ihren 96-jährigen Schwiegervater zu Hause pflegt.
Gitti sagt zum Stichwort "Verantwortung", dass sie diese "sicher" innehat, aber sie ist nicht
glücklich darüber, denn sie spricht auch gleich die Bürde an, die sie damit trägt: dass sie nämlich verantwortlich dafür sei, wenn dem Großvater etwas passiert, falls sie einmal nicht auf ihn
schaut:
Int.: "Nächstes Stichwort ist 'Verantwortung‘.
Gitti: (stößt Seufzer aus) Ja. Mhm, Verantwortung. Man übernimmt, sogar in dem Fall, muss
ich sagen, so wie bei mir, ich übernehme wirklich die Verantwortung für alles. Für meinen
Schwiegervater. Wirklich für alles. Also von dem her, dass es ihm ja gut geht, dass jeder
Arztbesuch stattfindet, und dass alles, ja, geregelt ist. Also, mehr oder weniger, ja, da habe
eigentlich ich alles. Und dann auch die Angst, falls da wirklich was passieren würde, obwohl
ich eh so aufpasse. Was ich da wahrscheinlich, ja, von seinen anderen Kinder wahrscheinlich
angegriffen werden würde, ‚Warum hast du nicht?‘ Also ich habe sicher die Verantwortung für
das, für alles." (Int. 09: 94f.)
Es wird deutlich, dass Gitti die Pflege ihres Schwiegervaters nicht aus Sympathie zu ihm übernommen hat, denn danach gefragt, wie die Beziehung zu ihm vor seiner Erkrankung war, sagt
sie: "Man schaut halt einfach, dass man einigermaßen gut auskommt." Sie habe die Pflege für
ihn übernommen, weil sie im selben Haus wie die Schwiegereltern wohnten. Die sechs Geschwister ihres Mannes hätten daraufhin erwartet, dass sie sich im Pflegefall um die Eltern
kümmern ("ihr habt das Haus gekriegt und ihr müsst das machen"). Dabei wollte Gitti gar nicht
100
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
zu den Schwiegereltern ziehen, wie sie erzählt, weil sie sich mit ihnen "gar nicht so gut verstanden" habe. Aber sie habe sich dann "doch wieder überreden lassen dazu." Sie sei in die
Pflege "hineingerutscht" und sei ein "zu gutmütiger Mensch". Dass es nach wie vor kein emotionaler Beweggrund ist, den Schwiegervater zu pflegen, verbalisiert sie eindeutig, sie sieht
"es" als "Aufgabe" und verzichtet, die Beziehung zum Schwiegervater näher zu erläutern:
Int.: "Und wie würden Sie so die Beziehung zu ihm (Schwiegervater) beschreiben? Das ist
jetzt doch sehr nahe. Sie sehen sich ja fast den ganzen Tag.
Gitti: Puh. Ja (überlegt, lacht kurz) Ja ich sehe es halt einfach als Aufgabe. Das ist ja so zugeteilt, und ja. Ich bin eigentlich ein extrem gutmütiger, ein zu gutmütiger Mensch, und da
macht man das halt (lacht)." (Int. 09: 64ff.)
Gitti artikuliert ganz offen ihre gegenwärtige Unzufriedenheit:
Gitti: "Manchmal fragt man sich selber, wie man das eigentlich alles noch durchhält. Das ist
schon so, dass das bei mir schon sehr grenzwertig ist." (Int. 09: 58)
Interessant ist bei ihr nun die Erklärung dafür, dass sie sich doch rund um die Uhr um ihren
Schwiegervater kümmert: Die "Liebe zu (ihrem) Mann" wäre der Grund:
Gitti: "Es kann noch zehn Jahre dahingehen. Ich meine, er ist 96, also ja. Aber trotzdem, für
seine Verhältnisse, was er eigentlich alles hat, ist es schon ein Phänomen, sagt unser Hausarzt immer. Aber ich sage zu jedem: ‚Macht das nicht‘.19
Int.: Hätten Sie das können? Hätten Sie es überhaupt ablehnen können?
Gitti: (stößt Seufzer aus) Ich war am Anfang einmal knapp davor, dass ich einfach gegangen
wäre. Wenn man jetzt,- Entweder, ich bleibe da bei meinem Mann mit den Kinder, oder ich
trenne mich, damit ich einfach weg kann davon. Aber das habe ich auch nie geschafft. Mehr
oder weniger aus Liebe zu meinem Mann habe ich das gemacht (lacht kurz). Ist wirklich so,
ja." (Int. 09: 162ff.)
Die nächste Fallgeschichte, die der Kategorie Pflege aus Verantwortung gegenüber Dritten
zuzuordnen ist, ist die von Theresa, auch wenn sie auf den ersten Blick ganz anders ist. Theresas Familie ist vergleichsweise jung, sie ist 41 Jahre alt, ihr Mann ist an Demenz erkrankt,
gemeinsam haben sie drei Kinder, die noch im elterlichen Haushalt leben. Seit einem Schlaganfall hat ihr Mann kognitive Einschränkungen und ist arbeitsunfähig. Die Frage nach Alternativen der jetzigen Lebenssituation scheint sich gar nicht zu stellen. Jemand muss die Familie
weiter ernähren, die Aufgabe fällt jetzt ihr zu. Recht nüchtern stellt sie nur fest, dass sie Verantwortung nun eben "größer geworden" sei. Interessanterweise führt sie als Beispiel nicht
etwa an, dass sie von der Hausfrau zur erwerbstätigen Ernährerin der Familie geworden ist,
sondern dass sie beim Autokauf, der vermutlich vorher in den – klassisch männlich konnotierten – Zuständigkeitsbereich ihres Partners fiel, Unsicherheiten hatte, alleine zu entscheiden
("darf ich das?"), als ihr Mann im Koma lag:
Theresa: "Mhm. Was mir da einfällt? Verantwortung, ja. Also die Verantwortung ist größer
geworden. Also schon allein, bei mir ist genau damals das Auto eingegangen, das Familienauto, wo er im Krankenhaus im Koma gelegen ist. Und dann war es so: Ich brauche ein Auto.
Und jetzt muss ich allein ein Auto kaufen gehen! So ‚Pft, darf ich das überhaupt? Darf ich
überhaupt so viel Geld ausgeben, und was ist, wenn ihm das Auto nicht gefällt, wenn er munter wird und er sagt, ‚Was hast du da für einen Blödsinn gekauft?‘ Also so,- Verantwortung,
boah, das wird für viel größer, wenn gerade so eine Situation, oder wenn sich einfach die
Rollen tauschen, dann ist Verantwortung ein großes Paket." (Int. 15: 93)
Im weiteren Kontext des Interviews wird deutlich: Sie gibt das als Ratschlag für andere potenziell
Pflegende und meint, dass sie nicht in die Pflege "hineinrutschen" sollen, so wie sie.
19
101
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Der von ihr selbst so bezeichnete "Rollentausch" wird im nächsten Kapitel näher erläutert. Was
hier jedenfalls im Zusammenhang mit der Übernahme von Verantwortung von Bedeutung ist,
ist ihre Begründung: Sie übernimmt die Verantwortung vor allem mit Blick auf das Familiensystem, speziell auf ihre Kinder. Von ihnen wird sie "einfach gebraucht", und so kann sie auch
in schwierigen Momenten ihre Situation annehmen:
Int.: "Gab es die Momente bei Ihnen, - so, dass Sie gesagt haben, ‚Na, jetzt will ich eigentlich
nicht mehr‘?
Theresa: Mhm (bejahend)
Int.: Und dann?
Theresa: Und dann, ja dann waren eben da die Kinder wieder, die einen einfach gebraucht
haben." (Int. 15: 44ff.)
Bei ihr steht deutlich das "System Familie" im Mittelpunkt, nicht die Partnerschaft, wie es etwa
(verständlicherweise) bei den älteren und alten Paaren der Fall ist, die keine Fürsorgeaufgaben mehr für minderjährige Kinder zu erfüllen haben.
4.8.4
Grenzen
Wo ziehen die Interviewpartner/innen ihre persönliche Grenze, wenn es um Verantwortung für
ihren Angehörigen geht? Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil die Übernahme
von Verantwortung vielgestaltig ist. Sie reicht von der generellen Bereitschaft, Kontakt zu halten über die Entscheidung, einzelne organisatorische Aufgaben zu übernehmen, die Person
regelmäßig zu besuchen, mit ihr zusammen zu wohnen, im Team mit anderen oder sogar ganz
alleine zu betreuen oder rund um die Uhr zu pflegen. Die eher sachlich-praktischen Begründungen dazu, welches Pflegearrangement gewählt wird, wurden bereits im dazugehörigen Kapitel erläutert und werden hier nicht noch einmal behandelt. Hier geht es vor allem um die
psychische- und die Beziehungsebene.
Zunächst ist festzuhalten, dass nicht jede/r im Interview die eigenen Grenzen angesprochen hat, auch wenn die Belastung deutlich wurde, wie zum Beispiel bei Gitti, die offen bereut,
dass sie die Pflegetätigkeit für ihren Schwiegervater übernommen hat. Mit der Feststellung,
sie sei ein "zu gutmütiger Mensch" deutet sie an, dass sie die Pflege weiterführen wird und
nicht beenden kann. Mitunter aber sind die eigenen Grenzen auch unklar, weil die Zukunft,
bei einer Verschlechterung der Krankheit Angst macht und man sich nicht vorstellen kann, wie
der Alltag dann geregelt werden soll. So sagt Elisabeth auf die Frage, was sein würde, sollte
die Mutter einmal nicht mehr alleine leben können: "Das ist ein Szenario, wo ich noch gar nicht
dran denken möchte". Weil die Mutter in einem weit entfernten Bundesland lebt, sie aber ihren
Brüdern vor Ort die Pflege nicht zutraut, ist die Zukunft unklar und sie weiß nicht, was sie sich
selbst "zumuten" möchte, wie sie sagt ("wenn sich das jetzt wirklich verschlechtert, was will
man ihr zumuten? Und einem selber auch?").
Vor allem zu Beginn der Demenzerkrankung ist oft die Kombination aus geistiger Verwirrtheit
und körperlicher Unruhe ein Problem für die Angehörigen, weil Gefahren drohen. Diese Problematik wurde ein paarmal in den Interviews angesprochen, so etwa von Gitti, die ihren
Schwiegervater ständig mit einem Bildschirm-Babyphon überwacht, damit er nicht mit dem
Rollstuhl umkippt "oder irgendwo hinfährt". Auch Lisa sorgt sich um ihre Schwiegermutter, die
in ihrem gemeinsamen Haus lebt. Sie ist schon viele Jahre dement, aber voll mobil. Gerade
im Begriff der "Verantwortung" sieht sie auch die Grenzen der alleinigen Familien102
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Pflege ("was ist, wenn was passiert?"). Sie spricht von einer "tickenden Zeitbombe". Damit
definiert Lisa Verantwortung so, dass sie selbst Schuld auf sich geladen hätte, wäre die
Schwiegermutter in ihrer Abwesenheit die Treppen hinuntergefallen. Die Schwiegermutter ist
mittlerweile im Heim. Die alleinige Zuständigkeit im Sinne der häuslichen Pflege sei ihr "zu
groß" geworden, sie hätte im Falle eines Unfalls Sorge gehabt, zur Rechenschaft gezogen zu
werden:
Int.: "Das Stichwort heißt Verantwortung. Was fällt dir dazu ein?
Lisa: Boah, ja. Sagen wir so, die Verantwortung, - Also in der Zeit, bevor sie ins Heim gekommen ist, so das letzte Jahr, ist die Verantwortung wirklich ein Problem geworden, also das
Gefühl der Verantwortung. Also genau das: Was ist, wenn was passiert? Also wo man dann
wirklich sagt, man kann sie wirklich überhaupt nicht mehr allein lassen. Also da ist die Verantwortung dann wirklich so, dass man sagt: 'Das wird mir jetzt zu groß'. Weil, wie rechtfertigst
du dich, wenn du gerade einkaufen gehst und inzwischen ist sie die Stiegen heruntergefallen?"
(Int. 01: 172)
Wenn die zu pflegende Person nicht mehr mobil oder eingeschränkt ist in der Bewegung,
kommt eine weitere Grenze hinzu, die vor allem Frauen in Partnerschaften betrifft: Ihnen fehlt
schlichtweg die Kraft, ihren Partner "aufzuheben", wenn er gestürzt ist oder ihn beim Anziehen
oder bei der Körperpflege zu stützen. Somit erfordern die eigenen körperlichen Grenzen
eine zusätzliche Unterstützung (z.B. andere Familienangehörige oder mobile Dienste) oder ein
gänzlich alternatives Pflegearrangement wie eine 24h-Betreuung oder eine Heimunterbringung, wie bereits im Kapitel zur den verschiedenen Betreuungsarrangements dargestellt
wurde.
Die Grenzen, die nicht sachlich, sondern auf der eigenen Gefühlsebene gezogen werden, werden nun genauer in den Blick genommen. Es geht erstens um die eigene psychosoziale
Gesundheit der pflegenden Angehörigen und zweitens um die Beziehung zu der erkrankten Person. Natürlich sind diese Gründe nicht als "entweder oder" zu sehen; oft gibt es sowohl
externe Faktoren (z.B. eigene Erwerbstätigkeit) als auch persönliche Gründe, die zu dem Entschluss führen, dass zum Beispiel eine Pflege zu Hause nicht mehr fortgesetzt werden kann.
4.8.4.1 Eigene psychosoziale Gesundheit: "Ich war mit den Nerven völlig runter"
Im Kapitel über "Schwieriges" für die pflegenden Angehörigen wurde bereits erläutert, dass
das eigene Wohlbefinden durch Anstrengung und Überforderung für einige eingeschränkt ist.
Diese Belastungen sind es auch, die für manche – aber nicht alle – eine Grenze markieren,
die sie dazu veranlasst, sich aus dem Kontakt mit der erkrankten Person zurückzuziehen oder
das Betreuungsarrangement zu ändern. Lisa hat das zum Beispiel schon getan, denn ihr "ständiges genervt Sein" in Bezug auf ihre Schwiegermutter war für sie und ihren Mann nicht mehr
erträglich, so dass ein Heimplatz organisiert wurde. Auch Patrizia, die ihren Ehemann viele
Jahre begleitet und gepflegt hat, hat ihre Grenzen erkannt. Die aggressiven Anfälle ihres Mannes haben ihr zuletzt so zugesetzt, dass sie in ihrer kreativen Tätigkeit als freischaffende
Künstlerin eingeschränkt war:
Patrizia: "Es fiel mir ganz schwer, aber ich hab mir gesagt, das muss ich jetzt machen, denn
ich hab keine andere Möglichkeit. Dann haben sie ihn dabehalten, weil ich gesagt habe, ich
bin nicht mehr bereit, mich weiter um ihn zu kümmern, weil das ist unerträglich, ich kann das
nicht. Und ich konnte gar nicht mehr arbeiten. Ich bin (künstlerischer Beruf), und immer wenn
er so einen Anfall hatte, dann war ich für drei Tage außer Gefecht. Ich war mit den Nerven
völlig runter." (Int. 13: 8)
103
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
So ist ihr Mann nun seit Kurzem in einem Pflegeheim, und obwohl ihr die Umstellung schwerfällt, ist sie dankbar für diese Möglichkeit und dass sie sie genutzt hat. Sie sagt: "Wenn es so
ein Heim nicht gebe, dann wäre ich wie jemand, der gefangen ist."
Eine Grenze kann auch markiert werden, indem man sich zurückzieht, weil man emotional
überfordert ist, ein Wechsel des Pflegearrangements muss nicht unbedingt damit verbunden sein. Dies ist der Fall bei der 17-jährigen Corinna, deren Oma im gemeinsamen Haus
lebt und neben einer 24h-Kraft von ihren Eltern und ihr selbst betreut wird. Cornelias Grenze
ist das Erleben negativer Emotionen. Sie möchte die traurige Situation nicht so nah an sich
heranlassen und zieht sich innerhalb der Familie zurück, indem sie die Großmutter weniger
besucht, als es sich ihr Vater (=Sohn der Oma) von ihr wünscht. Sie versucht, manche Dinge
"mit Humor" zu sehen und interpretiert ihr Verhalten als "Selbstschutz":
Cornelia: "Ich geh da viel mit Humor auch rein, weil, ja eben wie ich – sonst wär’s eben nur
zum Weinen eigentlich. Und deswegen ist es besser, die Dinge auch mit ein bisschen einem
Sarkasmus und Humor eben anzugehen, zum Selbstschutz natürlich auch." (Int. 03: 197)
Sie erzählt außerdem, dass sie nicht bereit ist, an Gesprächen ihrer Eltern teilzunehmen, in
denen die Situation im Familienrat erörtert werden soll ("wie es weitergeht"). Sie sieht sich
ganz klar nicht in der Verantwortung, Gesprächspartnerin der Eltern zu sein, diese Funktion
sollten "andere Leute" übernehmen. Sie möchte "solche sensiblen Dinge" für sich alleine "abhandeln":
Int.: "Gibt es noch etwas, was dir selber noch wichtig wäre zu sagen?
Cornelia: (überlegt) – Vielleicht, dass bei solchen Dingen, - natürlich ist Kommunikation in der
Familie immer wichtig. Aber mir geht es zumindest so damit, dass teilweise, - also mir geht es
viel besser, wenn ich mit meinen Eltern nicht wirklich darüber rede, (…) der Papa halt auch
manchmal so ist, dass er über irgendwelche Sachen unbedingt reden muss. Also überhaupt,
wie es weitergeht. Aber dass es mir einfach besser geht, wenn ich das alles auf mich zukommen lasse und nicht mit irgendwem darüber rede. Also ich komme prinzipiell viel besser mit
Dingen klar, wenn ich die für mich selber abhandeln kann und nicht unbedingt mit anderen
Leuten. Also dass Kommunikation zwar wichtig ist, aber dass man es auch nicht Leuten aufdrängen soll. Vor allem, wenn es um solche sensiblen Dinge geht.
Int.: Also auch, dass vielleicht deine Eltern das für sich irgendwie,- ?
Cornelia: Ja, genau. Also wenn sie zwar, - also wenn sie Hilfe brauchen oder so, dass sie das
entweder mit sich selber klären sollen oder mit anderen Leuten, aber halt nicht, - weil der Papa
ist dann halt auch immer so, dass er sagt, dass ich so selbstsüchtig bin, wenn ich nicht über
so was reden will. Und dass man das halt dann, - Mir geht es halt besser damit, wenn ich
nicht, (stoppt)" (Int. 03: 116ff.)
Was der Vater als "selbstsüchtiges" Verhalten seiner Tochter anklagt, darf jedenfalls nicht als
generelle Gefühlskälte der Großmutter gegenüber missverstanden werden. Denn Cornelia äußert sehr wohl, dass die Erkrankung ihrer Oma vor allem zu Beginn "sehr belastend" für sie
gewesen sei. Sie hätte aber gelernt, im Verlauf der Zeit "distanzierter" zu sein. Sie kann diese
Position leicht beziehen, weil sie nicht die Hauptverantwortliche in der Pflege ist, sondern als
Kind in der Familie lebt. Auch ist – systemisch betrachtet – der Platz desjenigen in der Familie,
der sich am meisten um die Großmutter sorgt, schon von ihrem Vater besetzt. Ihre Mutter und
sie selbst seien hingegen eher "pragmatisch".
Geradezu gegenverkehrt zum Vater von Cornelia sieht Theresa die Position ihrer Kinder im
Familiengefüge: Sie zieht die Grenzen ihres Engagements für ihren Ehemann genau an dem
Punkt, wo die Unbeschwertheit der Kinder gefährdet ist. Zwar nennt sie ihre drei Kinder im
104
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Zitat nicht explizit, aber es ist davon auszugehen dass "die Angehörigen oder die Familie", die
nicht "auf der Strecke bleiben" dürfen, ihre Kinder und vielleicht auch sie selbst meinen:
Theresa: "Und jetzt sehe ich einfach, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht nur
diesen Kranken, um den es eigentlich geht, dass man den begutelt und begatelt und schaut,
dass alles passt, sondern dass eigentlich die Angehörigen oder die Familie extrem auf der
Strecke bleibt. Weil man einfach immer nur alles tun will, damit es dem Kranken besser geht.
Aber die anderen, die hängen irgendwie immer in der Luft (seufzt tief)." (Int. 15: 25)
Dieser Rat liest sich fast so, als sei er an sie selbst gerichtet, denn an anderer Stelle wurde
deutlich, dass sie und ihre Kinder sich sehr auf das Wohlbefinden des Vaters einstellen und
deutlich im Alltag zurückstecken, wenn es etwa darum geht, dass man beim Abendessen darauf achtet, dass man nicht durcheinanderredet, weil das den Vater anstrengt oder dass
Freunde nicht mehr nach Hause kommen, sondern man sich außer Haus trifft, ebenfalls aus
Rücksichtnahme auf den Vater.
4.8.4.2 Beziehungsebene: "Je nachdem, wie das Verhältnis ist"
Es gibt in den Interviews einige Aussagen, die darauf hindeuten, dass die Definition der eigenen Grenzen durchaus mit der Persönlichkeit der hilfebedürftigen Person und der Beziehungsqualität in Verbindung gebracht wird. Sind die oben dargestellten psychosozialen Belastungen
eher allgemeiner Natur, die alle Pflegenden treffen können (z.B. überfordert sein, genervt
sein), gibt es spezielle Geschichten in der Beziehungs-Biografie, die das Verhältnis der beiden
Personen belasten. In der für beide neuen Situation, dass Hilfe benötigt wird, bricht Altes wieder auf und die Interviewpartner/innen distanzieren sich. Die Überschrift "je nachdem, wie das
Verhältnis ist" stammt aus einem Zitat der 34-jährigen Lena, die sich von ihrem Vater zurückgezogen hat und nur noch ab und zu mit ihm telefoniert. Sie hadert manchmal mit einem
schlechten Gewissen und macht sich darüber Gedanken, wann Kinder für ihre Eltern verantwortlich sind – und wann nicht. Der Interviewerin stellt sie quasi die Frage, ob es Studien dazu
gibt, dass das Eltern-Kind-Verhältnis ausschlaggebend dafür ist, ob Kinder ihre Eltern pflegen.
Vielleicht sucht sie nach einer Legitimierung, dass ihr Rückzug in Ordnung ist:
Int.: "Das Stichwort heißt 'Verantwortung'.
Lena: (überlegt). Ja, das ist natürlich schwer jetzt. Das ist natürlich so das Thema, ziehe ich
mich etwas aus der Verantwortung oder habe ich diese Verantwortung gar nicht? Das ist eine
sehr persönliche Sache, ob man,- inwieweit man sich in der Verantwortung fühlt dann für so
jemanden. Kommt auf das Verhältnis an, würde ich sagen. (…) Und das ist durch diese Demenz natürlich, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, finde ich allgemein. Ob jetzt Kinder
ihre Eltern pflegen, je nachdem, wie das Verhältnis ist, also,- ja. Deswegen hatte mich das
auch so interessiert, diese Studie, weil ich das einen wichtigen Punkt finde." (Int. 06: 73f., 87f.)
Bei ihr liegt die Distanzierung in der Vater-Kind-Beziehung der Vergangenheit begründet, das
sagt sie selbst. Sie hat ihren Vater, der während ihrer Kindheit inhaftiert war, erst mit 16 Jahren
kennen gelernt. Das Verhältnis sei immer schon "eher distanziert" gewesen. Ihre Formulierung
Verantwortung "für so jemanden" mit Bezug auf ihren Vater zeigt die Distanzierung bereits
sprachlich. Zwar hat Lena bei Ausbruch der Demenz ihren Vater etwas unterstützt (sie haben
im selben Ort gewohnt), mittlerweile ist sie aber bewusst (weit) weggezogen und hat den Kontakt weitgehend abgebrochen, "weil das dann sehr feindselig geendet ist". Der Vater kann
noch alleine leben und wird von ein paar Bekannten unterstützt. Sie betont jedoch, dass es
nicht seine Demenz-Erkrankung und die damit verbundene Aggressivität gewesen sei, die sie
zum Kontaktabbruch bewogen hat. Vielmehr sei es "immer schon sehr schwierig" gewesen:
105
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Lena: "Also es ist jetzt nicht die Demenz, ist nicht der Grund, das was letztendlich zu dem
Kontaktabbruch geführt hat. Oder beziehungsweise zu der Kontakteinschränkung. Das nicht,
das nicht. Es war schon immer recht schwierig, genau. Ich hab ihn auch erst mit 16 kennen
gelernt, also hatte da immer ein eher distanziertes Verhältnis zu ihm. Wir sind allerdings dann
nochmals mehr zusammengewachsen 2014, dadurch, dass ich recht viel bei ihm war und ihn
da sehr unterstützt habe. Aber, ja, also jetzt wirklich durch die Demenz, als es dann schlecht
geworden ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, wenn wir von Anfang an ein besseres
Verhältnis gehabt hätten, hätte ich oder wäre ich auch immer noch dort vermutlich und würde
ihn weiter unterstützen. Klar." (Int. 06: 45)
Ihre Abwesenheit spiegelt die Abwesenheit des Vaters in ihrer Kindheit wider, es ist quasi ein
"Zurückgeben" im negativen Sinn, also das Gegenteil davon, dass die jüngere Generation der
älteren jene Unterstützung zurückgibt, die sie als Kinder oder Enkelkinder erhalten haben
(siehe Kapitel Generationenbeziehung: "Etwas zurückgeben").
Dieses quasi "nachtragende" Verhalten der Kinder-Generation spricht auch Marie an. Es geht
dabei nicht um sie und ihr Verhältnis zu ihrem dementen Vater, sondern um die Kinder aus
seiner ersten Ehe. Sie erklärt den Rückzug ihrer Halbgeschwister damit, dass sie als Kinder
unter seinen Handgreiflichkeiten gelitten hätten.
Marie: "Aber dann, als mein Vater dement war, waren sie da gar nicht involviert. Also mein
Bruder hat schon meinen Vater dann öfter eingeladen, aber es war ihm lästig. Und ja, da war
halt die Beziehung noch schlimmer. Das kann man ihm überhaupt nicht vorhalten, dass er
sich nicht gekümmert hat. Ich weiß da auch nicht recht viel, aber da war mein Vater damals
noch gewalttätiger, also da gab es eine Watsche, wenn er einen Zweier auf die Lateinschularbeit hatte. Ja, also das war noch schlimmer. Der hatte eigentlich dann, der war teilweise halt
auch sehr enttäuscht, wie der Vater dann gegangen ist, aber auch erleichtert." (Int. 09: 79)
Noch ein Beispiel für eine – jedoch nur in Ansätzen – schwierige Eltern-Kind-Beziehung ist
das von Annika. Ihre Mutter wird von einer 24h-Betreuung versorgt, mit ihrem Bruder im Wechsel besucht sie sie an jedem zweiten Wochenende. Damit übernimmt sie natürlich Verantwortung und ist in die Pflege involviert. Aber sie hat auch ihre Grenzen, und diese zieht sie im
Verzicht auf eine größere räumliche Nähe. Als Grund nennt sie, dass die Mutter-Kind-Beziehung in der Vergangenheit von "Spannungen" geprägt war und ein häufigeres Sehen "nicht
funktionieren" würde:
Annika: "Ich glaube, wenn wir immer in (Wohnort der Mutter) wären, dass es (sic!) diese Beziehung zwischen Mutter und Tochter viel emotionaler ist, und dass das gar nicht so gut funktionieren würde.
Int.: Erzählen Sie mal, das würde mich interessieren: Wie ist Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter?
Jetzt, vielleicht, wie war sie auch vorher, was hat sich da getan?
Annika: Naja, vorher war es eher, wie soll ich sagen,- Ich habe (überlegt), ich kann,- Nein,
nicht dass ich sie nicht gemocht habe, aber es war immer zwischen uns irgendwie doch Spannung." (Int. 11: 27ff.)
Ihre Angst vor "Emotionen" rührt aus der Vergangenheit. An anderer Stelle erzählt sie, dass
ihre Mutter sie früher bevormundet hätte und sie auf die traditionell weibliche Frauenrolle festlegen wollte. Es gab Kritik daran, dass Annika ihren Mann nicht genügend versorgt hätte, im
Sinne einer traditionellen Hausfrau. Vermutlich ist es die mütterliche Kontrolle, der sie immer
noch entfliehen möchte, obwohl sie betont, dass ihre Mutter im Zuge ihrer Demenzerkrankung
"sanfter" und "lockerer" geworden sei.
Ein letztes Beispiel für diese Kategorie ist die Paarbeziehung von Felix und seiner Frau, die
mittlerweile im Heim lebt, nachdem er sie vier Jahre lang zu Hause betreut hat. Auch bei Felix
106
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
ist anzunehmen, dass es in der Beziehung zu seiner Frau früher Spannungen gab, die im
Verlauf der Krankheit wieder Thema werden und ihn dazu veranlassen, sein Engagement etwas einzuschränken (aber nicht aufzugeben!). Er sagt offen, dass seine Ehe "nicht die glücklichste" gewesen sei, trotzdem habe er zunächst seiner Persönlichkeit entsprechend ("das Soziale in mir") die Pflege übernommen:
Felix: "Ja, Verantwortung. Wie gesagt, ich habe immer eigentlich, das war,- Wie gesagt, obwohl wir nicht die glücklichste Ehe gehabt haben, aber das Soziale in mir, das war halt immer
so, dass, derweil es irgendwie geht, werde ich das selber machen. Ja, das war die Verantwortung in dem Sinn, die ich getragen habe. Ja, und die Entscheidungen jetzt in dem Sinn mit
meinen Töchtern zusammen halt, das ist,- Da kommen sicher noch ein paar Entscheidungen
auf uns zu." (Int. 16: 72ff.)
Einen Bruch gab es für ihn, als ihn seine Frau abgelehnt hat. Mit der Zurückweisung konnte er
nicht umgehen, auch wenn er die Situation(en) nicht näher ausführt:
Felix: "Für mich war dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, ‚Jetzt
lehnt sie mich eigentlich ab und ich will das nicht noch verstärkt mehr miterleben‘, dass ich
dann gesagt habe,- . Es war für die Familienangehörigen, für ihre Geschwister natürlich abrupt
irgendwie, diese Entscheidung." (Int. 16: 24)
Weil er sagt, dass seine Entscheidung, seine Frau nicht länger alleine zu pflegen, für die anderen Familienangehörigen "abrupt" kam, ist anzunehmen, dass das für ihn nicht so war, und
tatsächlich kommt das Thema "Ablehnung" bereits auf, als er von der Entwicklung ihrer Krankheit berichtet:
Felix: "Und da hat sie halt immer angefangen dann (…), dass sie dann schon zeitweise gesagt
hat, ‚Geh weg, lass mich in Ruhe!‘ und so getan hat, als ob sie mich nicht kennen würde. So
auf die Art. So ein bisserl eine Aversion. Und wenn ein Fremder hingegangen ist, ist sie mitgegangen." (Int. 16: 24)
Möglicherweise hat Ablehnung oder zumindest Entfremdung der beiden Eheleute bereits vor
der Erkrankung eine Rolle gespielt, denn Felix erzählt, dass seine Frau früher "voll für die
Kinder gelebt" hätte und dafür zum Beispiel die gemeinsamen Wanderausflüge an den Wochenenden mit ihrem Mann aufgegeben hatte, um die Kinder zu ihren Sportveranstaltungen
zu fahren. Zu Beginn ihrer Krankheit gibt es eine Annäherung, er sei "bedeutend näher hingekommen als die Jahre davor", aber sie hätte sich eben nur "krankheitsbedingt" ihm gegenüber
geöffnet, so seine etwas traurig klingende Vermutung:
Felix: "…dass man eigentlich in dieser Zeit, wenn du mit einem solchen Menschen dann zusammen bist, eigentlich bedeutend näher hinkommst als die Jahre davor. Und das war eigentlich, ja,- Die vier Jahre eigentlich war es eh in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist halt krankheitsbedingt vielleicht, dass sie eben gemerkt hat, sie braucht die Hilfe. Also allein funktioniert
das nicht mehr, und,- Ja. Aber das ist eh egal." (Int. 16: 95)
Als die Ablehnung wieder für ihn spürbar wird, entschließt er sich, sie aus seiner vollen Obhut
in ein Heim zu geben. Die Grenze dessen, was er emotional tragen kann, ist erreicht. So zeigt
sich an dieser, wie auch in den anderen hier vorgestellten Fallgeschichten, dass negativ erlebte Beziehungsmuster die Gestaltung der Betreuung durchaus mitgestalten – so wie das
umgekehrt auch für positive Erlebnisse gilt. In beiden Fällen wird – bewusst oder unbewusst –
emotional Bilanz gezogen.
107
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.9
Veränderungen im Familiensystem
Wie an einigen Stellen schon mit Beispielen erläutert wurde, zieht die Erkrankung eines Familienmitglieds natürlich Änderungen im Familienalltag nach sich: Die Kommunikation birgt neue
Fallstricke, die Person braucht Unterstützung und bei zunehmender Orientierungslosigkeit
kann sie – wenn noch mobil – irgendwann nicht mehr alleine gelassen werden, was generelle
Überlegungen zum Betreuungsarrangement nach sich zieht. Diese Veränderungen im Familienalltag sind bereits in den bisher behandelten Themen sichtbar geworden. In diesem Kapitel
wird der Blick nun weniger darauf gerichtet, wie sich der Alltag im Einzelnen neu gestaltet,
sondern es wird tiefer analysiert: Wie gestalten sich die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern, was ist neu im Rollengefüge, was bleibt gleich? Die Veränderungen, die sich im
Zusammenhang mit neuen Rollen ergeben, werden vor allem im Kontext von Generationen
und Geschlecht vorgestellt.
4.9.1
Neue Rollen und Rollenumkehr
Die Erkrankung eines Familienmitglieds bringt immer Veränderungen mit sich, welche die Beziehungen im Familiengefüge betreffen. Neue Rollen etablieren sich (z.B. die des "Hilfeempfängers") und bisherige Rollen können nicht mehr erfüllt werden, weil etwa die bisher für das
Kochen allein zuständige Ehefrau dieser Aufgabe nicht mehr alleine gewachsen ist. So ziehen
selbst anfangs kaum merkbare kognitive Einbußen einen Rollenwechsel nach sich, und die
Familie ist weitaus mehr davon betroffen, als sich Außenstehende oft vorstellen können. Davon erzählt Theresa. In ihrer Familie mit drei Kindern hat sich nach dem Schlaganfall ihres
noch recht jungen Mannes enorm viel verändert. Das soziale Umfeld, hier die Mediziner, wollten oder konnten dies erst nicht realisieren:
Theresa: "Wie reagiert man in der Familie? Weil das bringt mir nichts, wenn mir im Klinikum
gesagt wird, ‚Das ist alles ganz normal!‘ Da ist mir nicht geholfen. Dass sich diese Situationen
daheim ändern, das will vielleicht niemand sehen oder, ja, jeder ist froh, wenn er das Problem
abgeben kann." (Int. 15: 17)
Wie die innerfamilialen Veränderungen bei ihr und den anderen aussahen, wird im Folgenden
erläutert.
4.9.1.1 Generationenaspekt: "Wie ein viertes Kind"
Die Veränderungen können in verschiedener Hinsicht die Generationenbeziehungen im Familiengefüge betreffen. Besonders folgenschwer ist, dass die erkrankte Person ihren Status als
selbstverantwortliche, erwachsene Person nach und nach einbüßen wird. Die Verhältnisse
kehren sich teilweise um, der Erwachsene kann in eine Rolle rutschen, die der Kinderrolle
ähnelt. Anschaulich beschreibt das Zita. Sie erzählt davon, dass ihre an Demenz erkrankte
80-jährige Mutter zunehmend Schwierigkeiten hat, mit ihren Enkeln Brettspiele zu spielen.
Geistig stünde sie mittlerweile auf einem Niveau zwischen ihren beiden vier- und achtjährigen
Kindern, sagt Zita. Sie sei neben ihren drei Kindern "wie ein viertes Kind" und es sei mitunter
"mühsam", denn man müsse sie quasi "mitbetreuen wie ein ganz jungen Kind, das mitspielen
will":
Zita: "Die Nachmittage sind sicher so, dass die zwei Kleineren ganz viel mit ihr gemeinsam
sein werden und spielen mit ihr. Was ich bis jetzt gemerkt habe, ist, der Jüngste, der wird jetzt
eben bald vier, der kommt natürlich zunehmend in das Alter, wo er auch Brettspiele spielen
will. Das ist manchmal ganz schön mühsam, weil meine Mutter einfach bei neuen Spielen, die
sie, auch wenn es einfache Kinderspiele sind, die Regeln von einem aufs andere Mal vergisst.
Da muss man sie halt mitbetreuen wie ein ganz junges Kind, das mitspielen will. Und wir
108
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
haben dann auf gewisse Art und Weise ein viertes Kind mit dabei, und sie steht sozusagen
von ihren Fähigkeiten her eigentlich zwischen dem Achtjährigen und dem knapp Vierjährigen."
(Int. 10: 40)
Umgekehrt können jüngere Kinder in der Familie in eine etwas erwachsenere Rolle hineinwachsen, wenn sie erkennen, dass ein an Demenz erkrankter Erwachsener Unterstützung
braucht. Im Fall von Lisa geht es um ihre beiden Kinder im Teenageralter und ihre stark verwirrte Schwiegermutter, von der Lisa oft "sehr genervt" ist. Die Unterstützung der Kinder sieht
so aus, dass sie die 95-jährige Großmutter verteidigen, wenn sie das Gefühl haben, sie wird
zu sehr in die Ecke gedrängt. Sie seien "empathischer oft" gewesen, "wo (sie selbst) dann
manchmal schon die Nerven weggeschmissen" hatte. Lisa illustriert das mit einer konkreten
Begebenheit, in der ihre Kinder den reschen Ton der Oma gegenüber gerügt haben:
Lisa: "Also die Kinder haben eigentlich, - also niiiie irgendwie gesagt, dass sie, - oder mir
vermittelt, dass sie von der Großmutter genervt sind oder dass sie sie ablehnen. Überhaupt
nicht. Im Gegenteil: Sie haben viel mehr Verständnis gehabt für sie. Also meine Tochter hat
mal zu mir gesagt: 'Mama, schimpf' nicht mit der Großmutter, sie versteht das nicht' – ja? Also
die haben mich eher runtergeholt. Und einmal haben wir eine etwas gröbere verbale Auseinandersetzung gehabt, also da bin ich einfach mal kurz ausgezuckt, - also ich mit der Schwiegermutter halt, das war wegen einem Blumenkisterl, und da waren die Kinder total schockiert,
ja? Weil eben, - das war, - immer, wenn es regnet oder es nach Regen ausgeschaut hätte,
wollte sie das Blumenkisterl nämlich von ihrer Terrasse runterheben und unter die Bank stellen, obwohl das Balkonblumen sind. Und du hast das ständig auf und ab heben müssen die
ganze Zeit. Und jetzt habe ich halt mal gesagt (resolut): ‚Das bleibt jetzt dort!‘ – Ja? (lacht)
Und dann war der Auslöser, ich habe es einfach genommen und habe es weggetragen und
habe gesagt: 'Es gibt jetzt keine Blumen mehr. Aus'! Woraufhin sie in Tränen ausgebrochen
ist und völlig verzweifelt war (lachend) – 'uuuh, meine Blumen und die ist so böse zu mir'. Und
völlig fertig. Und die Kinder waren echt schockiert und haben gesagt: 'Mama!' Also sie haben
versucht, das wieder glattzubügeln. Die waren da eigentlich empathischer oft, wo ich dann
manchmal schon die Nerven weggeschmissen habe." (Int. 01: 71)
Die Erkenntnis, dass ein erwachsener Mensch, den man vorher einmal anders kannte, nun in
einer schwächeren Position ist, setzt bei Kindern aber ein gewisses Alter und einen Prozess
des sich Bewusstwerdens voraus. Hier beschreibt Theresa anschaulich, wie ihre Kinder zu
Anfang der Krankheit (sie waren damals 2, 8 und 12 Jahre alt) nicht verstehen konnten, dass
ihr gerade einmal 40-jähriger Vater nicht mehr der umfassend kompetente, ihnen überlegene
Vater ist, von dem sie lernen können, sondern dass er sie um Hilfe bittet. Dass er sie nicht aus
Lust an elterlicher Unterweisung, sondern aus einer schwachen Position heraus bittet, ihm
zum Beispiel bei der Suche nach verlorenen Dingen zu helfen, kann der jüngste Sohn anfangs
nicht begreifen. Theresa muss ihm die neue Situation erst einmal erklären:
Theresa: "Aber es war eben einfach eine schwierige Zeit, weil sich hat alles müssen umstrukturieren. Den Kindern hast du immer sagen müssen: 'Ah, schau, der Papa macht das nicht
zum Spaß'. Der Kleine hat das ganz lang nicht verstanden. Der hat immer gesagt, ‚Ma, das
ist so unfair, der
Papa schickt mich immer, ich muss das Handy suchen, die Brille suchen, dabei weiß er genau, wo er es hingelegt hat!‘" (Int. 15: 25)
Die Kränkungen waren beiderseits vorhanden: So wie der kleine Sohn meinte, sein Vater
würde ihn "unfair" behandeln, fühlt sich der Vater ebenso unwohl in der neuen Situation. Er
habe sich anfangs von der Familie "ausgeschlossen" gefühlt, weil er Dinge, die man ihm erzählt hatte, vergaß und dachte, man hätte sie ihm verschwiegen. Durch diese kognitiven Einschränkungen büßt ihr Mann etwas von seiner Rolle als elterliche Bezugsperson ein. Theresa
erzählt von einem Beispiel, das dies sehr gut verdeutlicht. Als sie ihren Mann einmal mit den
109
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Kindern alleine lässt, kann der seine Fürsorgepflicht nicht voll erfüllen, weil er sich nicht bewusst ist, dass er für die Mahlzeiten verantwortlich ist und auch derjenige sein sollte, der die
Kinder an das Duschen und Zähneputzen erinnern muss ("er hat eigentlich gar nicht gewusst,
was die Kinder in dem Alter können und was nicht"). Die Kinder sind verunsichert und erzählen
ihrer Mutter davon, dass sie ihn an seine Pflichten erinnern mussten:
Theresa: "Ich war mit dem Chor vier Tage auf Kreuzfahrt. Ja, es war schon schön, aber,- Also
eigentlich hab ich gar nicht mehr das Bedürfnis, dass ich wegfahre. Überhaupt nicht. Es war
irgendwie so witzig, das erzähle ich immer, wenn ich jetzt in meiner Arbeit bin, wie einfach
mein Mann da mit dieser Situation dann umgegangen ist. So, jetzt ist er eigentlich ganz allein
wieder mal verantwortlich für die Kinder. Obwohl, ich meine, die Großen brauchen jetzt nicht
wirklich noch jemanden, aber,- Da hab ich dann irgendwann am dritten Tag einmal angerufen
daheim, und der Kleine,- Und ich habe gesagt, ‚Und passt es eh, tust du Zähne putzen und,-‘
‚Ja, aber gebadet hab ich noch nie!‘ Sag ich, ‚Was, geduscht?‘ ‚Nein, wieso?‘ Hab ich gesagt,
‚Ja, hat der Papa nicht gesagt, dass du dich am Abend duschen musst oder dass du in die
Badewanne gehst?‘ ‚Nein, der Papa hat nichts gesagt‘. Und dann, als ich heimgekommen bin,
habe ich zu (meinem Mann) gesagt, ‚Ja, hast du dem Kleinen nicht gesagt, dass er sich waschen muss?‘ Dann hat er gesagt, ‚Na, Entschuldigung, ich hab mir gedacht, jetzt ist er eh
schon so alt, der wird das ja wohl wissen!‘ Also es war irgendwie so, er hat eigentlich gar nicht
gewusst, was die Kinder in dem Alter können und was sie nicht können. Also so ein bisserl,Sie haben halt irgendwie so in den Tag hineingelebt, und der Kleine hat oft gesagt, ‚Ja, Mama,
ich hab dem Papa sagen müssen, es ist Mittag, wir müssen jetzt was zum Essen kochen‘.
Also manchmal hab ich nicht gewusst, sind die Kinder die, die auf ihn aufgepasst haben, oder
ist doch der Papa der, der schaut, dass nichts passiert? Aber ja. Irgendwie sind sie manchmal
auf gleicher Ebene. Also der Kleine dann und er." (Int. 15: 91)
Besonders ihr Schlusssatz zeigt, dass sich fast so etwas wie ein Rollenwechsel zwischen den
Generationen vollzogen hat, der Verwirrung stiftet: Wer schaut auf wen, der Vater auf seine
Kinder oder die Kinder auf den Vater? Das "Aufpassen" der Kinder auf den Vater geht aber so
weit, dass er sich in seiner Integrität mitunter angegriffen fühlt. So ist zumindest Theresas Zitat
zu interpretieren, als sie erläutert, dass die Kinder ihm bei schlechter Stimmung in der Familie
schon einmal vorschlagen, dass er seine Tabletten nehmen solle. Dass nicht er alleinverantwortlich für eine schlechte Stimmung ist oder dass er ernstzunehmende Gründe für eine Verstimmung haben könnte, wird wohl häufiger ausgeschlossen und folglich fühle er sich dann
"auf die Tabletten reduziert":
Theresa: "Wenn mein Mann wieder ein bisschen eine schlechtere Zeit gehabt hat, dass ich
ihm gesagt habe, ‚Hast du deine Tabletten schon genommen?‘ So ein bisserl vorwurfsvoll:
‚Hast du die eh schon genommen? Vielleicht bis du deswegen so!‘ Und dass ich jetzt manchmal bei den Kindern einfach dann heraushöre, wenn wir gerade einen Spaß haben, dass sie
dann sagen, ‚Ma, Papa, bitte nimm die Tabletten, damit du eh gut bleibst. Vergiss ja nicht,
jetzt am Abend die Tabletten nehmen!‘ Und er sagt dann immer, ‚Es ist eigentlich so arg, dass
man eigentlich von der Stimmung so auf die Tabletten reduziert wird‘." (Int. 15: 95)
Theresa und die Kinder versuchen jedoch, dass sie ihn in seiner wichtigen Vaterrolle bestärken. Zwar hätten die Kinder mehr Vertrauen in ihre Mutter, zum Beispiel, wenn es ums Hausaufgabenmachen geht. Aber gerade ihre beiden älteren Kinder seien zu "irrsinnigen Strategen
geworden", weil sie ihn bei wichtigen Fragen scheinbar miteinbeziehen, obwohl sie die Dinge
vorher schon mit ihrer Mutter geklärt haben, einfach, um ihm das Gefühl zu vermitteln, dass
seine Meinung wichtig ist:
Int.: "Ist er eine Ansprechperson für Ihre Kinder, wenn sie was, wenn sie Rat brauchen? Also
diesen Vater brauchen, der ihnen hilft?
Theresa: Ehrlich gesagt, bin mehr ich. Das bin eher ich. Weil er oft sagt, ‚Jetzt bin ich daheim,
warum redet ihr das nicht mit mir aus?‘ Oder beim Aufgaben machen. Der Kleine ist auch so,
dass er dann sagt, ‚Nein, ich mach das lieber mit der Mama‘ oder ‚Der Papa glaubt mir nicht,
dass die Lehrerin sagt, dass ich das so und so machen muss.‘ (…) (Aber) man merkt, dass
110
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
die Kinder ihn schon, dass sie sich schon bemühen, dass sie ihn irgendwo schon als Oberhaupt sehen, aber sie sind da schon sehr geschickt worden mit dem den Papa zwar fragen,
aber heimlich dann doch mit mir darüber reden. Weil ich auch immer gesagt habe, ‚ihr müsst
ihn genauso fragen und genauso miteinbeziehen. Probieren muss man immer, ob er das kann,
nicht kann, versteht oder nicht versteht. Also die sind irrsinnige Strategen geworden, meine
Kinder. Die wissen genau, wie sie das handeln (Anm.: von engl. "to handle"), dass das nicht
so auffällt, dass man ihn jetzt einfach nur fragt, weil man ihn fragen sollte. Ja." (Int. 15: 78ff.)
Das Thema generationale "Rollenumkehr" wird von manchen Interviewpartner/innen auch im
Zusammenhang mit der Körperpflege erwähnt, der intimsten Form von Unterstützung. Marie
erzählt von einem Film, der sie sehr bewegt hat, weil man darin sieht, wie das Leben "rückwärts
läuft" und sie sich an die Situation mit ihrem Vater erinnert fühlte. Als vorher einflussreicher
Mann in einem angesehenen Beruf sei er am Ende seines Lebens wieder hilflos und ein
"Mensch mit Windeln" gewesen:
Marie: "Sicher hast du eine neue Rolle. Weil du hast plötzlich, du weißt, dass deine Eltern halt
für dich verantwortlich waren, und du wechselt dann einfach so in eine andere Rolle. (…) Es
gibt eben einen Film auch, und so diese Tagline ist: 'We all end up in diapers'. Ja, also du
startest als Kind mit Windeln, und wahrscheinlich endest du auch als Kind, also als Mensch
mit Windeln. Und dieser Film hat mich extrem beeinflusst eigentlich auch. Geprägt. Ich muss
sagen, ich hab fast den ganzen Film lang geweint, weil mich das einfach so erinnert hat an
mich und an die Beziehung auch zu meinem Vater. Also einfach, wie das Leben rückwärts
laufen würde. Dass du einfach als alter Mensch wenig mehr weißt, vielleicht dement bist, und
als Kind eigentlich auch keine Ahnung, als Baby auch keine Ahnung hast. Also so diese Parallelen. Wir sind am Anfang hilflos und am Ende auch. Du brauchst Hilfe halt als Baby, und
du brauchst Hilfe als alter Mensch. Und so ist halt dann auch die Rolle, hat sich dann halt
einfach geändert auch. Du hast plötzlich quasi ein Kind, so. Du bist selber kein Kind mehr,
sondern du hast eigentlich jetzt ein Kind. Das würde ich so beschreiben." (Int. 08: 67)
Dieses körperliche Angewiesen sein auf Unterstützung hat freilich nur bedingt mit einer Demenzerkrankung zu tun. Allein das Altern bringt diese Art der intergenerationalen Rollenumkehr mit sich, auch für geistig gesunde Menschen. Eine Demenzerkrankung aber verstärkt
sicherlich den Grad der Abhängigkeit und die Verantwortung, die pflegende Angehörige übernehmen.
4.9.1.2 Geschlechteraspekt: "So wie ich früher war, das ist jetzt er!"
Theresas Situation mit ihrem recht jung an Demenz erkrankten Mann und den drei Kindern
beinhaltet noch eine weitere Dimension des Rollenwechsels, und zwar auf Geschlechterebene. Nachdem ihr Mann, den sie als "Karrieretyp" beschreibt und der nur an den Wochenenden zu Hause war, durch den Schlaganfall mit nachfolgender Demenz nicht mehr arbeitsfähig ist, haben sich die Rollen innerhalb des Elternpaares "total gedreht": Nun ist sie die
Hauptverdienerin und ihr Mann führt den Haushalt. "So wie ich früher war, das ist jetzt er",
meint sie. Auch wenn er das Kochen (ehemals ihr Bereich) nicht übernommen hat ("funktioniert
nicht"), hat sie nun die traditionell typisch männlichen Bereiche inne: Finanzen, Autofahren,
Haupterwerb. Einfach war die Umstellung nicht für sie, sie musste sich erst orientieren:
Theresa: "Also das (die Finanzen) war früher alles seins. Ich habe mich da überhaupt nicht
ausgekannt, ich hab nicht gewusst, welche Versicherungen wir haben. Ich hab mich ums Geld
nie kümmern müssen. Also er hat eigentlich verdient, ich bin nur arbeiten gegangen, damit ich
ein bisserl drinbleibe. Also ich war wirklich nur geringfügig einmal in der Woche (arbeiten).
Einfach nur, damit ich ein bisserl in meinem Beruf drinnen bleibe, aber finanziell haben wir es
nicht notwendig gehabt. Und dann war das natürlich, hab ich mich überhaupt nicht ausgekannt, und da war das Erste, dass ich mich hab müssen selber mal auf die Hinterbeine stellen,
dass ich wirklich einmal hab schauen müssen, war für Versicherungen haben wir überhaupt,
gibt es eine Krankenversicherung? Wie schaut es finanziell aus? Ich hab gar nichts gewusst.
111
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Also ich war auf dem Gebiet total eine Niete. Und jetzt hat sich das eben total geändert, weil
er vergisst irgendetwas einzuzahlen, er hat keine Ahnung mehr, ob er schon etwas gezahlt
hat oder nicht. Also das ist jetzt alles meins. Da kenne ich mich jetzt auch gut aus (lacht). Das,
ja,- Also eigentlich haben sich die Rollen total verändert. Es ist wirklich das, so wie früher ich
war, das ist jetzt so ein bisserl er. Also eigentlich, ja, Haushalt, daheim sein, so. Ich meine,
kochen funktioniert nicht, aber ja. Jetzt bin eigentlich ich der, der verdient, der einfach schaut
auch mit den Versicherungen, finanziell, dass das alles läuft. Bin jetzt der, der Auto fährt, weil
er das auch nicht mehr hat. Also eigentlich haben wir, hat sich die Rolle total gedreht." (Int.
15: 85)
Während sich Theresa scheinbar mit der neuen Rolle arrangieren kann, erzählt sie, dass ihr
Partner Probleme hat. Er büßt Teile seiner männlichen Rolle ein und leidet darunter. Dazu
gehört nicht nur der Jobverlust ("jetzt kann ich nicht einmal mehr arbeiten gehen"), sondern
ebenso der Rückgang seiner Libido aufgrund der Medikamente, die er einnehmen muss:
Int.: "Es ist Ihr Partner, der erkrankt ist. Und sehr jung. Was macht das mit einer Partnerschaft?
Theresa: Hmm! (lacht)
Int.: Großes Thema?
Theresa: Naja, es ist total witzig, weil das zurzeit wirklich gerade ein Problem ist, aber nicht
für mich, sondern für ihn. Weil aufgrund der ganzen Medikamente irgendwo seine Libido nicht
so funktioniert und er jetzt einfach so, ‚Ja, jetzt kann ich eh schon nicht mehr arbeiten, und
jetzt kann ich das nicht mehr, und jetzt bin ich Mann auch keiner mehr!‘ Aber so,- (…) Mich
stört das überhaupt nicht! Also das ist, glaub ich, echt immer so ein Männerproblem!" (Int. 15:
50ff.)
Seinen offensichtlich schmerzhaften Verlust einiger Fähigkeiten, die er mit seiner Rolle als
Mann verknüpft, kann nur eine neue Art der Wertschätzung lindern, meint Theresa. Ihrem
Mann würde es guttun, wenn sie seine Haushaltstätigkeit lobt, manchmal würde er sogar darum "betteln", dass sie ihm dafür dankt, dass er aufgeräumt hat. Doch sie erinnert ihn mitunter,
dass sie in ihrer vorherigen Hausfrauenrolle auch kein Lob erhalten habe ("früher war dir das
eigentlich auch wurscht"):
Int.: "Was tut ihrem Mann besonders gut?
Theresa: Wenn er ein Erfolgserlebnis hat. Also, es ist so, es reicht oft schon, wenn ich heimkomme und sage, ‚Ma, schon so sauber!‘ Also früher,- Also ich habe nie eine Bestätigung,Also bei mir ist er manchmal schon gekommen und hat gesagt, ‚Pf, was tust du denn, du hast
eigentlich ein so ein schönes Leben, hast den ganzen Tag nichts zu tun! Du bist daheim bei
den Kindern. Und trotzdem hängen da zum Beispiel Spinnweben.‘ Also nur so ein blödes
Beispiel. Und jetzt ist es oft so, wenn ich dann sage, ‚Ma, heute hast du, das sieht man, so
schön geputzt schon!‘, dann sagt er oft, ‚Ma, verarsch mich nicht!‘ Wenn er eh nicht, aber,Oder er bettelt manchmal und sagt, ‚Warum sagst du nichts? Siehst du nicht, was ich heute
schon zusammengeräumt habe?‘ Dann sage ich immer, ‚Ja, schon, aber früher war dir das
eigentlich auch wurscht‘. Und er hat dann auch selber gesagt, er sieht jetzt eigentlich auch
einmal, was eine Hausfrau wirklich Arbeit hat. Weil, also er hat auch eine andere Sicht kennen
gelernt. Und ihm tut es halt gut, wenn man ihn ab und zu lobt. Weil er hat jetzt ja eigentlich
nichts mehr, wofür man ihn loben kann. Hat ja keine Arbeit mehr. Erlebt nichts mehr. Kann
nichts mehr erzählen. Und da braucht er halt manchmal so ein bisserl eine Bestätigung." (Int.
15: 134f.)
So wie Theresa erfolgreich in ihre neue Rolle gefunden hat und nun sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Familie (Kinder, Erwerb, Finanzen) die Hauptverantwortung trägt, erzählen
auch andere Interviewpartner/innen von einem geschlechterspezifischen Rollenwechsel, der
sich im Zuge der Demenzerkrankung einstellte. Erkennbar ist dabei immer wieder, wie traditionell die Partnerschaften gelebt werden: Männer sind für die Finanzen zuständig, Frauen für
die Küche. Sissi verweist darauf, dass das vor allem ein Generationenphänomen sei. Auch in
ihrer Ehe habe ihr Mann die Finanzen verwaltet und sie davon ferngehalten, obwohl sie ihn in
112
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
weiser Voraussicht darum gebeten hatte, ihr "das" zu erklären. Als er aufgrund seiner Erkrankung schließlich nicht mehr in der Lage war, die Finanzen weiterhin zu verwalten, sei das für
sie "natürlich schwer gewesen", sich hier neu einzuarbeiten:
Sissi: "Früher ist es so gewesen, dass die Männer alles gemacht haben, das ganze Finanzielle. Und wenn ich irgendwas machen wollte, hab ich gesagt: 'Erklär mir das bitte auch, weil
könnt ja mal sein, dass mit dir was ist und ich muss das auch wissen!‘ – 'Ah, das brauchst du
nicht wissen! Frauen brauchen das nicht wissen!‘ So, das war halt die Erziehung damals. Und
das ist halt natürlich schwer gewesen dann für mich plötzlich. Gut, Gott sei Dank hab ich eben
dann Söhne, die auch eben dann da sind, und teilweise haben wir auch Freunde, die dann
sagen, ‚Du, das und das‘." (Int. 17: 83)
Interessanterweise gibt Sissi diesen Bereich der Finanzen aber wiederum an die Söhne ab
und bleibt ihrer (Geschlechter)-Rolle damit langfristig treu – so wie auch Arnold, der umgekehrt
das Kochen übernehmen musste, als seine Frau – eigentlich "die Chefin" in der Küche – dazu
nicht mehr in der Lage war. Da sie in Folge der Demenz körperliche Abläufe nicht mehr koordinieren konnte (sie nahm ihre linke Körperseite nicht mehr wahr), hätten sie zunächst gemeinsam gekocht und Arnold war der Ausführende – denn die Rezepte hatte seine Frau noch
im Kopf! Als aber die 24h-Betreuerin ins Haus kommt, gibt er das neu erlernte Kochen und
Waschen aber wieder an eine Frau ab:
Arnold: "Und dann hab ich schon gesehen, dass meine Frau Probleme kriegt mit dem Kochen,
dass sie also die Einzelteile zu einem Ganzen nicht mehr zusammenfügen konnte. Und das
hat ein Problem gebracht, weil sie war ja da im Grunde genommen die Chefin. Und sie hat ja
gewusst, wie es geht und so weiter, und ich war ja eher der Nichtwissende. Aber da haben
wir uns so arrangiert, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Also sie hatte das Rezept im
Kopf, und ich hab es dann umgesetzt. (…) da hatte ich also einiges dann an Kochen gelernt.
Vorher hatte ich mich in der Küche überhaupt nicht ausgekannt. Die Putzfrau, die hat mir dann
auch beigebracht, wie man die Maschinen betätigt. Die Waschmaschine, wieviel Waschpulver, ich musste alles von der Pike auf lernen. Dann habe immer ich gekocht, bis dann die 24Stunden-Pflege kam." (Int. 14: 60)
4.9.2
Kontinuitäten
Genauso, wie die Demenzerkrankung eines Familienmitgliedes Veränderungen im Familiensystem mit sich bringt, bleiben andere Konstellationen erhalten oder intensivieren sich aufgrund der neuen Situation sogar, im positiven wie im negativen Sinn: So können sich enge
Beziehungen vertiefen oder aber bestehende Konflikte an Brisanz gewinnen. Hierzu gibt es
viele, und vor allem viele verschiedene Beispiele. Manchmal geht es um komplexe Zusammenhänge des Familiengefüges, die ausführlich von den Interviewpartner/innen erläutert werden, ein andermal erwähnen sie nur kurz, dass diese oder jene Beziehung aufgrund der Situation "enger" geworden sei.
113
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.9.2.1 Positive (Intensivierung von) Beziehungen
Ein paarmal wird in den Interviews auf die Frage, ob sich das Familienklima oder die Familienbeziehungen verändert hätten, darauf verwiesen, dass eigentlich alles gleich positiv geblieben wäre oder sich sogar weiter zum Besseren entwickelt hätte. Bei Lisa ist das zum Beispiel
die Beziehung zu ihrem Ehemann, dessen Mutter sie lange Zeit zu Hause gepflegt haben,
bevor sie kürzlich in ein Pflegeheim kam. Durch das ganze Interview ist auffallend, dass Lisa
in der "Wir-Form" spricht, wenn es um die Beschreibung ihrer Situation geht (statt in der "IchForm"), und sie betont damit, dass sie die Belastungen gemeinsam mit ihrem Partner wahrgenommen aber auch "gemeistert" hat, wie sie sagt. Schon das kurze untere Zitat zeigt, dass sie
durchgehend Wörter des partnerschaftlich-Gemeinsamen verwendet ("wir", "gemeinsam",
"gegenseitig"), und sie sagt auch, dass sie die gesamte Situation als Paar "mehr verbunden"
habe:
Int.: "Was hat das alles mit eurer Familie gemacht?
Lisa: Na ja, also wir waren schon sehr, - mehr oder weniger genervt. Sicher. Ständig genervt
eigentlich. Einmal war es besser, einmal weniger gut. (…)
Int.: Und so Partnerschaft? Das ist ja SEINE Mutter?
Lisa: Ja. (zögert) Also es hat eigentlich nicht zu Konflikten geführt, muss ich sagen. Also dass
man jetzt irgendwie so 'du machst das' oder 'ich will das nicht' oder 'es ist DEINE Mutter'. Also
das war nicht. Aber es hat uns gemeinsam natürlich belastet. Aber auf der anderen Seite
eigentlich auch mehr verbunden dadurch. Also es war jetzt nicht negativ, dass wir deswegen
einen Ehekonflikt gehabt hätten. Sondern es war halt dann, - also vor allem als es vorangeschritten ist halt, einfach, was wir gemeinsam halt meistern müssen. Und wo wir uns auch
schon gegenseitig entlastet haben oft. Je nachdem, wie der andere drauf ist, haben wir gesagt: 'Okay, dann mache ich das heute, bleib' da, du bist heute nicht so gut drauf', ja?" (Int.
01: 52ff.)
Was bei Lisa die Partnerbeziehung ist, ist bei anderen die Eltern-Kind-Beziehung: Curt und
Sissi haben erlebt, dass ihre erwachsenen Kinder präsenter sind, seit der andere Elternteil an
Demenz erkrankt ist. Während Sissi sagt, ihre Kinder würden jetzt noch öfter vorbeikommen
(sie wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft), meint Curt, ihre Kinder würden nach wie vor
vorbeikommen, das Verhältnis zu ihnen sei "immer gleich" (positiv) gewesen:
Int.: "Vielleicht jetzt nochmal zu dem größeren System Familie: Hat sich zwischen Ihnen und
Ihren Kindern irgendwas verändert?
Sissi: Nein. Außer dass sie sich vielleicht jetzt noch mehr kümmern und noch öfter kommen
halt." (Int. 17: 184f.)
Int.: "Wie ist das, wie hat die Krankheit Ihrer Frau die Familie verändert, fällt Ihnen dazu was
ein? Gab es da eine Veränderung? Gibt es da neue Entwicklungen?
Curt: Mein Gott, die sind eigentlich, ‚Hallo Mama!‘ Sie kommen her, ‚Hallo Mama, wie geht es
dir?‘ Ja, und so. Nein, eigentlich nicht. Die waren immer, die Beziehung, die ich mit meinen
und sie mit meinen Kindern hatte, war immer gleich. Also die sind ja schon lange aus dem
Haus auch aus,- Und ja. Auch die Enkel, die kommen immer dann, wenn die (Name Enkelkind)
da ist, ‚Oma, wie geht es dir? Ich hab dich lieb!‘ und so. (lacht) Ja, ja, ja." (Int. 12: 200f.)
4.9.2.2 Schwierige Familienbeziehungen, v.a. unter Geschwistern
Im Zusammenhang mit dem Familiensystem wurden schwierige Familienkonstellationen häufiger thematisiert als positive, die weiterhin bestehen oder sich im Licht der Erkrankung anders
zeigen oder sich intensivieren.
114
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Ist ein Elternteil erkrankt, wurde von den erwachsenen Kindern mitunter erwähnt, dass
ihre Partnerschaft von der neuen Situation belastet sei. Marie zum Beispiel sagt, ihre Partnerschaft habe "natürlich darunter gelitten" und Gitti, die ihren Schwiegervater fast rund um
die Uhr pflegt, meint, ihr Mann und sie hätten sich "viel auseinandergelebt", es sei mitunter
"grenzwertig". Bei Annika ist wiederum zu erkennen, dass die Demenzerkrankung ihrer Mutter
zwar die Partnerschaft belastet, weil ihr Mann es anstrengend findet, sie jedes zweite Wochenende zu ihrer Mutter zu begleiten. Allerdings ist dies keine neue Situation für sie, sie hat
schon länger erkannt, dass ihre Interessen auseinandergehen, Unternehmungen macht sie
meist mit Freundinnen. Sie hat bereits an eine Trennung gedacht und schließt diese nicht ganz
aus ("ich könnte mich ja auch anders entscheiden, jetzt von der Partnerschaft her"). Dem
Thema Partnerschaft wurde in den Interviews allerdings nicht sehr viel Raum von den pflegenden Angehörigen gegeben – vor allem, wenn man es mit einem anderen Thema vergleicht,
das weitaus häufiger im Zusammenhang mit weitergeführten Konflikten genannt wurde: die
schwierigen Beziehungen unter Geschwistern, die sich nach der Erkrankung eines gemeinsamen Elternteils in negativen Aspekten intensivieren.
Das erste Fallbeispiel für einen Geschwisterkonflikt, der in der Betreuungs- oder Pflegesituation unter neuen Vorzeichen in Erscheinung tritt ist das von Lisa. Sie beschreibt die Situation
aus der Sicht der Schwiegertochter, sie pflegt gemeinsam mit ihrem Mann seine Mutter, die
noch einen weiteren Sohn hat – der aber kaum präsent ist. Sie erzählt, dass es zwischen den
beiden Brüdern bereits vorher "immer irgendwie ein bisschen eine Konfliktgeschichte" gegeben habe, die sich mit der Pflegebedürftigkeit der Mutter verschärft. Während sich Lisa und
ihre Familie der Kräfte zehrenden Pflege widmen, hält sich Lisas Schwager fern: Er sieht sich
nicht in der Verantwortung, weil nicht er, sondern Lisas Mann und Familie vor vielen Jahren
das Haus der Eltern übernommen haben, verbunden mit der Abmachung, dass sie im Bedarfsfall die Eltern pflegen:
Int.: "Du hast vorhin erwähnt, dass sie noch einen Sohn hat. Was ist mit dem?
Lisa: Hmhm! (bedeutungsvoll) Also kurz gesagt, der fühlt sich absolut nicht zuständig. Was
im Endeffekt auch kurz, bevor sie ins Heim gekommen ist, zu einem gewaltigen Crash geführt
hat, zwischen ihm und mir. Ja, und seitdem ist Funkstille." (Int. 01: 100f.)
Zum erwähnten "Crash" kommt es, weil Lisa ihren Schwager einmal – aus ihrer Sicht –
"scherzhaft" darauf anspricht, dass er ruhig auch mal pflegerisch für seine Mutter in Aktion
treten könnte. Der Bruder entrüstet sich lautstark und ruft ihr in Erinnerung, dass er nicht für
die Pflege zuständig sei, vermutlich verbunden mit einem Gefühl der Benachteiligung im Zusammenhang mit der Überschreibung des Hauses:
Lisa: "… und ich (…) habe einfach nur so schmissig so, - also eigentlich so scherzhaft gesagt
'Na, und ihr übernehmt jetzt die nächste Nachtschicht, oder?' (lacht ein bisschen). Und daraufhin ist er mich komplett angeflogen und hat gesagt, - also was ich mir einbilde?! Und wir
haben damals das Haus übernommen und haben uns verpflichtet, dass wir die Pflege übernehmen, und das geht ihn überhaupt nichts an." (Int. 01: 107ff.)
Der Kontakt ist seither abgebrochen, nur über gemeinsame Bekannte hat Lisa erfahren, dass
der Bruder die Entscheidung fürs Pflegeheim nicht gutheißt und bei seiner Überzeugung bleibt,
dass sein Bruder mit Familie "24 Stunden am Tag" für die Mutter sorgen solle, eben, weil sie
das Haus inklusive dem Pflegeversprechen übernommen haben:
Lisa: "(…) Wo sich dann im Nachhinein aus Kommentaren von Bekannten herausgestellt hat,
dass er das eigentlich absolut nicht eingesehen hat, ja? Es hat aber uns gegenüber nichts
erwähnt. Weil er offensichtlich der Meinung ist, es steht im Vertrag, und deswegen haben wir
115
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
jetzt da 24 Stunden am Tag bis zu ihrem Tod das alleine zu machen, ja, egal, wie es ihr geht
und wie es uns geht sowieso, ja?! Also um jeden Preis." (Int. 01: 125)
Lisa äußert sich nicht weiter zum früheren Verhältnis der Brüder untereinander, aber es könnte
sein, dass eine empfundene Benachteiligung des Schwagers gegenüber seinem Bruder darin
mündet, dass er sich nicht um seine Mutter kümmert. Was das Haus betrifft, meint Lisa zwar,
der Bruder sei damals ausgezahlt worden und "man könnte jetzt eigentlich nicht sagen, er ist
da jetzt leer ausgegangen", trotzdem könnte seine unverhältnismäßige Reaktion eine Verletzung andeuten, die schon länger besteht.
Gittis Geschichte ist der von Lisa sehr ähnlich. Auch sie pflegt einen Schwiegerelternteil, den
Vater ihres Mannes, und auch hier erwarten die sechs Geschwister ihres Mannes allesamt,
dass seine Familie die Pflege übernimmt, weil sie das Haus der Schwiegereltern bekommen
hatten ("ihr habt das Haus gekriegt und ihr müsst das machen"). In Gittis Familie ist es aber
sie, die fast allein pflegt (nicht in Gemeinschaft mit ihrem Mann, wie das bei Lisa der Fall ist)
und die auch dann nicht von ihrem Mann nicht unterstützt wird, als sie eine Heimunterbringung
vorschlägt. Vielmehr gibt er dem Wunsch seiner Geschwister nach, die sagen "das könnt ihr
nicht machen":
Int.: "Wie ist das mit den anderen, also mit sechs Geschwistern Ihres Mannes? Sie haben
gesagt, die wollten jetzt zuerst ein bisschen helfen, als er dann wieder zu Hause war, haben
sie aber nicht so gemacht. Ich habe das schon öfter gehört, dass Geschwister dann reinreden.
Wie ist das bei Ihnen?
Gitti: Nein, nur als er im Heim war. ‚Das hat er nicht verdient, und das könnt ihr nicht machen
(…) Ihr habt das Haus gekriegt und ihr müsst das machen. Ja. Obwohl man sagen muss, es
ist ganz ein altes Haus, wo noch Ziegel selbst gemacht wurden, weil (mein Mann) und ich
haben schon sehr viel richten müssen. Und es ist auch noch viel zu richten. Es ist jetzt nicht
so wertvoll, aber ja. Leider haben wir das genommen, sagen wir so." (Int. 09: 74f.)
Vermutlich kann sich ihr Mann als jüngstes unter den sieben Kindern auch deshalb nicht gegen
sie durchsetzen, weil er seit jeher eine untergeordnete Rolle im Familiengefüge einnimmt, und
diese Kontinuität setzt sich fort. Gitti erzählt, dass der Schwiegervater seinen jüngsten Sohn
weniger ernst genommen habe als seine anderen sechs Kinder ("wenn die was gesagt haben,
das war was wert"). Die Meinung ihres Mannes sei "nie richtig" gewesen in den Augen seines
Vaters. Diese untergeordnete Position gibt der Sohn an seine Frau Gitti weiter, die die Pflege
nur "aus Liebe zu (ihrem) Mann", wie sie selbst sagt, weiterhin übernimmt, obwohl sie das
mittlerweile bereut. Die Position, es zuerst dem Vater und nun den Geschwistern nicht recht
machen zu können, zeigt sich in einem weiteren Beispiel: Gitti sagt, dass es einen Bruder ihres
Mannes gibt, der ihnen sogar vorwirft, sich am Pflegegeld zu "bereichern". Was er im Zusammenhang mit den Finanzen konkret erwartet, wird nicht deutlich, denn dass der Schwiegervater ins Heim kommt, wollen die Geschwister ja genauso wenig. Gitti schmerzt diese Aussage
sehr, denn sie meint, dass sie vielleicht jetzt erwerbstätig wäre und sie als Familie mehr Geld
hätten, hätte sie den Schwiegervater (und vorher die Schwiegermutter) nicht schon viele Jahre
lang gepflegt:
Gitti: "Ein Sohn von ihm (=dem Schwiegervater), der hat uns das Leben schon ziemlich schwer
gemacht. Vor allem (für mich) als Schwägerin. Er redet mit uns gar nichts. Im Gegenteil, also
die können nur schimpfen, und das ist schon auch schwierig. (…) Oder die Aussage war, wir
bereichern uns am Schwiegervater. Obwohl sie keine Ahnung haben, wieviel er selber
braucht, (…) Solche Aussagen, was ganz schlimm ist eigentlich für einen selber. Weil eigentlich wir eh mehr hätten, wenn ich normal hätte können arbeiten gehen. Und nicht auf das alles
verzichten müsste. Ja. Und die sind ganz arg." (Int. 09: 103)
116
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Jedenfalls wird auch in ihrer Erzählung deutlich, dass sich Konstellationen im Familiensystem
fortsetzen, wenn es um die Pflegeübernahme geht: Der Sohn, der in der Großfamilie nie viel
zu sagen hatte, muss dem Wunsch seiner Geschwister entsprechen, dass er die Pflege übernimmt – beziehungsweise seine Frau.
Noch eine weitere Geschichte illustriert die Kontinuität eines Geschwisterkonflikts, der wiederum so gelagert ist, dass zwei Geschwister zerstritten sind und sowohl die Pflegebedürftige,
als auch das dritte der drei Kinder, nämlich die Interviewpartnerin, die Leidtragenden sind.
Elisabeth stellt die Situation so vor, dass es "quasi so ein alter Familienkonflikt (sei), der da
jetzt halt so richtig wieder aufpoppt". Es sei eine "Spezialgeschichte", eine "Erbschaftsgeschichte" zwischen ihren beiden Brüdern, die sie nicht weiter erläutert, aber die wohl so tiefe
Wunden gerissen hat, dass ihre beiden Brüder "sich bis aufs Blut hassen". Die Leidtragende
sei nun ihre Mutter, weil sie bei ihrer beginnenden Demenz nicht die Unterstützung erhält, die
sie benötigt. Die Mutter lebt im selben Ort wie ihre beiden Söhne, mit einem teilt sie sogar das
Haus. Der Brüderkonflikt und die aus Elisabeths Sicht zu geringe Unterstützung führt nun dazu,
dass Elisabeth sich hauptverantwortlich für die Pflege ihrer Mutter fühlt und regelmäßig vorbeikommt – obwohl sie viele hundert Kilometer weit entfernt wohnt. Elisabeth meint, dass es
"Resets" brauche, so dass die alten Konflikte der Mutter zuliebe beigelegt werden, aber ihre
Brüder seien "stur":
Int.: "Wie ist das zwischen Ihren Brüdern und Ihnen? Wer macht da was, wie geht das?
Elisabeth: Das ist eben eine Spezialgeschichte. Nein, das ist halt eben also quasi so ein alter
Familienkonflikt, der da jetzt halt so richtig wieder aufpoppt. Also solange es meiner Mutter
gut gegangen ist und wir nicht viel miteinander zu tun gehabt haben und so weiter. Und jetzt
ist halt das Bedürfnis meiner Mutter da, dass da quasi auf sie geschaut wird und dass zumindest die Grundbedürfnisse eben abgedeckt werden. Also, dass man halt schaut, was braucht
sie da und hin und her und das eben auch raufbringt und so weiter. Und, ja, und das hat sich
dann als ziemlich kompliziert und schwierig herausgestellt, weil meine zwei Brüder sich nicht
sehr gut verstehen.
Int.: Untereinander die beiden Brüder?
Elisabeth: Untereinander, genau. Erbschaftsgeschichte halt und Dings und beide stur. Und
der eine quasi in der Opferrolle, der andere in der Täterrolle. Und ich irgendwo dazwischen
und meine Mutter auch irgendwo dazwischen natürlich. Und jetzt halt irgendwie so: Gut, jetzt
braucht es "Resets" von euch beiden. Und mit dem Konflikt so quasi im Hinterkopf ist es,
gestaltet sich das alles relativ schwierig, weil die zwei da eben nicht wirklich eine große Empathie zeigen können was das betrifft, jetzt eben die Erkrankung der Mutter. Weil es ihnen, so
wie ich das sehe, ihre Befindlichkeiten nimmt da in den Vordergrund zu stellen als eben die
Hilfe, die meine Mutter benötigt. Was nicht viel ist eigentlich. Aber doch. Und ich halt von
(Ortsname) aus eigentlich alles versuche zu organisieren. Und abzuschätzen, wie das jetzt
funktioniert mit der Mutter, was sie braucht." (Int. 02: 55ff.)
Diese Fallgeschichte zeigt, dass alte Kränkungen im Geschwisterkonflikt, die mit der pflegebedürftigen Person gar nichts zu tun haben müssen, deren Versorgung beeinflussen. Aus
Sicht der Interviewpartnerin resultiert der Brüderkonflikt in einer unzureichenden Betreuung
der Mutter, die eine dritte Person, hier die weit wegwohnende Schwester, aufzufangen versucht.
In den bisher vorgestellten Fallgeschichten zum Thema Geschwisterkonflikt ging es darum,
dass sich die Geschwister untereinander die Betreuungs- oder Pflegeverantwortung "zuschieben" wollen, wobei die nicht pflegenden Geschwister eine gewisse Erwartungshaltung an sie
herantragen und zum Beispiel eine Heimunterbringung zu verhindern suchen. In der Familie
117
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
von Zita nun ist der Fall anders gelagert: Zwei der drei Geschwister (sie und einer der Brüder)
streiten sich darum, wer die Mutter bei sich zu Hause aufnehmen und pflegen darf. An anderer
Stelle ist die Situation schon ausführlich dargestellt worden. Es geht darum, dass die demente
Mutter derzeit noch mit Zitas Bruder zusammenwohnt, gemeinsam mit ihrem Mann (Zitas Vater) in dem Haus, wo die Kinder aufgewachsen sind. Zita aber möchte ihre Mutter zu sich und
ihrer sechsköpfigen Familie holen (ohne den Vater), weil sie meint, dass ihr Bruder und seine
neue Lebensgefährtin sich nicht ausreichend um die Mutter kümmern. Der Bruder versucht
das zu unterbinden und hat sie bereits einmal mit einer Schusswaffe bedroht. Sie hat rechtliche
Schritte eingeleitet, es läuft nun ein Pflegschaftsverfahren, auch weil sie ihrem Bruder vorwirft,
über seine neue Partnerin elterliches Vermögen veruntreut zu haben, indem er der Partnerin
das gemeinsame Elternhaus und Sparbücher der Mutter übertragen hat. Vor allem diese Entdeckung habe die Situation "völlig zum Eskalieren gebracht". Danach gefragt, warum ihr älterer Bruder den Kontakt zwischen ihr und der Mutter einzuschränken versucht, weist Zita darauf
hin, dass dies tieferliegende Gründe habe, die sie zunächst nicht genauer erläutert:
Zita. "Das ist eine Familiensituation, die mit der Demenz meiner Mutter eigentlich, glaub ich,
gar nichts zu tun hat, das hat eher was mit meinem Bruder zu tun, der hat versucht dann zu
unterbinden, dass sie weiter kommt, aus welchen Gründen auch immer." (Int. 10: 15)
Auch dem zweiten Bruder steht sie kritisch gegenüber. Die Beziehung zu ihm beschreibt sie
damit, dass er "in erster Linie abwesend" sei, der Kontakt ist abgebrochen. Er habe sich nicht
gemeldet, als sie ihn kontaktiert hatte, weil es ihrem Vater gesundheitlich plötzlich sehr
schlecht ging:
Int.: "Wie ist das, Sie haben NOCH einen Bruder, oder?
Zita: Ja.
Int.: Wo ist der in der Konstellation?
Zita: Pah (klingt abfällig). Der ist in erster Linie abwesend, muss man sagen. (…) Mit dem
mittleren Bruder, von dem ich jetzt gerade rede, seit einem halben Jahr, muss man sagen,
habe ich mit dem keinen Kontakt. Er hat den Kontakt völlig abgebrochen, reagiert nicht. Mein
Vater ist im Februar einmal so schlecht beieinander gewesen, dass wir eigentlich gedacht
haben, er würde sterben. Ich habe diesen zweiten Bruder kontaktiert, der hat in keinster Weise
reagiert. Also ich weiß nicht einmal, ob der ausgewandert ist, verschollen, meine Kontakte
einfach blockiert hat und meine Nachrichten gar nicht kriegt, da habe ich bis jetzt noch nicht
die Zeit gehabt, mit da drum zu kümmern, da einfach mal bei seiner Wohnung vorbei zu fahren
und zu schauen, was eigentlich los ist. Also der glänzt im Moment durch vollkommene Abwesenheit." (Int. 10: 24ff.)
Interessanterweise entspricht die Konstellation fast deckungsgleich der von Elisabeth: Auch
sie hat zwei Brüder, von denen einer mit der Mutter in einem Haus lebt. Und auch Elisabeth
wirft ihren Brüdern eine gewisse Passivität und mangelnde Empathie für die vor (wie weiter
oben erläutert). Dass sich zwei Brüder nicht genügend um die Eltern kümmern und deshalb
die Schwester einspringt, um die Mutter besser zu versorgen, ist in beiden Geschichten ein
wichtiges Narrativ. Es liegt die Vermutung nahe, dass Geschlecht eine Rolle spielt, ein Aspekt,
der auch von beiden Frauen angesprochen wird, von Zita stärker als von Elisabeth. Beide
Frauen beschreiben ihre starke Bindung zur Mutter, während die Väter und Brüder in einem
negativen Licht erscheinen und man deshalb die Mutter aus diesen Zusammenhängen lösen
möchte. Zita spricht sogar von einer "genetischen Komponente", wenn sie die Männer in ihrer
Familie beschreibt. Ihren Vater beschreibt sie als einen Mann der "keinen Kontakt mit uns
Kindern herstellen konnte" und ein cholerisches Temperament habe. Schon ihr Großvater und
ihr Urgroßvater hätten diese Züge aufgewiesen, wie sie von ihrer Taufpatin weiß:
118
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Zita: "Also ich glaube, dass es bei uns in dieser männlichen Linie eine genetische Komponente
gibt, weil mein Bruder hat im Zuge dieser Geschichte, die da aufgekommen ist, eine völlige
Eskalation hingelegt. (…) und das ist soweit eskaliert, weil ich mich halt nicht einschüchtern
hab lassen von ihm, dass er, nachdem er zuerst herumgeschrien hat, dann handgreiflich geworden ist, im Endeffekt meinen Mann und mich mit einer geladenen Schusswaffe bedroht
hat. Also wirklich weit im pathologischen Bereich. Also das heißt, er hat so eine jähzornige,
unberechenbare Komponente, mein Vater hat eine bipolare Störung, die seit (überlegt), wahrscheinlich relativ zeitgleich mit der Demenz meiner Mutter ein bisserl verzögert diagnostiziert
worden ist, vielleicht vor sechs Jahren oder so. (…) Also herumgeschimpft hat mein Vater
immer, er war immer jähzornig und cholerisch, aber nicht unflätig. Und das ist mit dieser bipolaren Störung und ich glaube einer Frontalhirn-Demenz, soweit ich das beurteilen kann, sehr
einhergegangen. Also, mein Vater ist ein Akademiker, der ist (Berufsbezeichnung), der hatte
Lokalverbot in den beiden Gasthäusern dann in dem Ort, wo sie wohnen, weil er sich dort so
aufgeführt hat. Und meinen Großvater und meinen Urgroßvater kannte ich persönlich nicht,
aber meine Taufpatin, die die sehr gut kannte, hat erzählt, dass die diese aufbrausende, cholerische Komponente ebenfalls hatten und dass die jeweiligen Ehefrauen immer wieder bei
ihnen zu Hause gesessen sind und geweint haben, weil der Mann zu Hause getobt hat." (Int.
10: 29)
Was in diesem Zitat anklingt, führt sie an anderer Stelle weiter aus: Ihr Bruder, mit dem sie
diesen eskalierten Streit hat, habe die "kontrollierende, rachsüchtige Komponente (ihres) Vaters übernommen". Er möchte seine Schwester verletzen und stellt sich deshalb gegen die
Besuchswochenenden und gegen ihr generelles Vorhaben, die Mutter ganz zu sich zu holen
("weil er genau weiß, wenn er meine Mutter nicht zu mir kommen lässt, tut er mir damit weh").
Schließlich kommt sie zum Kern, der dem Konflikt aus Zitas Perspektive zugrunde liegt und
eben diesen Geschlechteraspekt eines schon seit Kinderagen belasteten Familiensystems in
sich trägt: Sie meint, dass ihr Bruder eifersüchtig auf sie sei, weil sie das "gewünschte" Mädchen der Mutter war/ist und daher ihm (und seinem Bruder) von der Mutter emotional vorgezogen wird:
Zita: "Ich weiß aber, dass meine Mutter sich in Wirklichkeit immer ein Mädchen gewünscht
hat. So, dann kam ein zweiter Bub nach, und dann kam ich als Mädchen. Und vielleicht gibt
es in meinem Bruder den Anteil, der glaubt, ich bin jetzt sozusagen die Richtige und Ersehnte
und immer schon Gewünschte und er ist irgendwie nicht richtig. So." (Int. 10: 29)
Die vom Bruder empfundene Eifersucht nährt Zita quasi damit, dass sie die emotionale Teilung
auf Geschlechterebene (Mutter + Zita, Vater + Söhne) in der neuen Familiensituation nun auch
räumlich herbeiführen möchte: Sie löst die Mutter aus dem Elternhaus und auch aus der Partnerschaft mit ihrem Mann (ihr Vater sei zu "verwurzelt" in seinem Haus, um zu übersiedeln).
So wird auch in dieser Geschichte ein (sehr tief liegender) Geschwisterkonflikt, dem eine empfundene Benachteiligung zugrunde liegt, in der neuen Situation fortgeführt. Ging es bei den
obigen Beispielen um eine finanzielle Benachteiligung (Hauserbschaft), geht es hier um eine
emotionale Benachteiligung (die bevorzugte Tochter vs. beide Brüder).
Dass es bei den hier zitierten Erzählpersonen zu Konflikten unter Geschwistern kommt, bedeutet freilich nicht, dass das überall der Fall ist. Zwei Interviewpartner, Gregor und Anton,
betonen, dass sie gut mit ihren Geschwistern zurechtkommen. Beide rücken diese positive
Grundstimmung in die thematische Nähe, dass die Aufteilung der Zuständigkeiten klar geregelt
ist und man sich gegenseitig unterstützt, und außerdem "über alles reden kann". Im Fall von
Gregor ist es seine (einzige) Schwester, mit der er sich gut versteht und dankbar ist, dass sie
"die finanziellen Dinge" übernimmt:
Int.: "Wie ist das zwischen Ihrer Schwester und Ihnen?
119
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Gregor: Ja, das passt, das Verhältnis passt, das ist in Ordnung alles. Wir können auch über
alles reden, wir können alles machen. Sie hat zum Beispiel, da haben wir es wieder aufgeteilt,
sie hat die finanziellen Sachen übernommen, meine Frau hat das Medizinische wieder, und
ich habe die ganze Organisation." (Int. 07: 39f.)
Im Fall von Anton ist die Schwester zwar diejenige, die weniger bei ihrem Vater vor Ort ist,
aber doch zur Stelle ist, wenn behördlich-medizinische Dinge zu klären sind. Sie mache dies
aufgrund ihres Berufs "auf jeden Fall besser" als er. Dass er seiner Schwester zugesteht, insgesamt weniger in die Pflege involviert zu sein, sieht er – und vor allem seine Schwester – in
einem größeren familiensystemischen Zusammenhang, der interessant ist: Sie habe für den
"Nachwuchs gesorgt" (er ist kinderlos), habe damit "schon genug zu tun", und deshalb ist die
etwas ungleiche Aufteilung in punkto Pflege für ihn in Ordnung:
Int.: "Wie ist das zwischen Ihnen und Ihrer Schwester? Hat sich da was geändert? Oder wie
ist es generell zwischen Ihnen beiden?
Anton: Nein, geändert hat sich eigentlich in der Beziehung nichts. Meine Schwester sagt, sie
hat prinzipiell – ja, das klingt jetzt – also von meiner Schwester aus gesehen, hat sie gesagt,
sie hat für Nachwuchs gesorgt, sie hat den Neffen, nicht? Sie plagt sich mit dem Nachwuchs,
weil der tut auch nicht immer so, wie sie will. (…) Sie hat gesagt, sie hat da genug zu tun, und
ich kümmere mich halt mehr um den Papa. Aber wenn es hart auf hart geht, ist sie da. Das
muss ich auch sagen, ja." (Int. 05: 58f.)
Dass er einleitend sagt, es habe sich zwischen ihm und seiner Schwester in der Beziehung
eigentlich nichts geändert, deutet auf die Kontinuität einer guten Beziehung hin. Die Geschwister haben ein gutes Verhältnis zueinander und haben eine gute "Kooperationsbasis", wie er im
Interview immer wieder sagt.
Insofern gibt es durchaus positive Geschwisterbeziehungen, die im Fall der Pflege so weiterbestehen und damit ebenso Kontinuität zeigen wie konflikthafte Konstellationen. Deutlich wird
aber eben auch, dass gerade problematische Konstellationen unter Geschwistern im Fall kritischer Lebensereignisse, wozu eine einsetzende Demenzerkrankung der Eltern sicherlich
zählt, neu in Erscheinung treten ("aufpoppen", wie eine Interviewpartnerin es formulierte) oder
an Brisanz sogar zunehmen.
4.10 Reflexion
Dieses Kapitel enthält retrospektive Gedanken der Interviewteilnehmer/innen, die sie vor allem
am Ende des Interviews geäußert haben, als sie von der Interviewerin gefragt wurden, ob sie
Ratschläge für andere Betroffene hätten oder ob es sonst noch etwas gebe, das ihnen "wichtig" sei. Die Antworten dazu werden in zwei Unterkapiteln zusammengestellt, welche (1) die
geäußerten Ratschläge beinhalten und (2) das teils sehr unterschiedliche Verständnis einer
demenziellen Erkrankung beinhalten.
4.10.1 Ratschläge für andere Betroffene
Wir haben alle Interviewpartner/innen gefragt, ob sie "Tipps" für andere hätten, die in die gleiche Situation kommen würden, wie sie selbst, dass also ein Familienmitglied an Demenz erkrankt. Manche fokussieren dabei auf sich selbst und nennen Strategien, die eigene Situation
besser zu bewältigen. Andere (aber weniger) fokussieren auf die erkrankte Person und wie
man ihrer Erfahrung nach am besten mit ihr umgeht. Ganz deutlich wird jedenfalls, dass ein
Großteil der Antworten darauf hinweist, dass Dinge früher erledigt werden sollten, vor allem,
wenn es um das Einholen von Unterstützung in beraterischer oder pflegerischer Hinsicht geht.
120
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
4.10.1.1 Unterstützung: "Nur ja nicht glauben, man schafft es allein!"
Die meisten Antworten versammeln sich mit sehr ähnlichen Formulierungen in der Kategorie,
dass man "nur ja nicht glauben sollte, man schafft es allein", wie Lisa es formuliert. Sie selbst
habe "eigentlich erst im Nachhinein" – das heißt, nach Wechsel des Pflegearrangements auf
Heimunterbringung – bemerkt, wie belastend die mehrere Jahre andauernde Pflege der
Schwiegermutter zu Hause für sie war:
Int.: "Ich habe nur noch eine Frage, nämlich, ob du einen Tipp hast für Personen, die in diese
Situation kommen oder am Anfang in der Situation sind?
Lisa: Na, auf jeden Fall, - (zögert) nur ja nicht glauben, man schafft es allein. Also das ist
einmal wichtig. Und auch das nicht selbstverständlich nehmen. Ich habe das eigentlich erst
im Nachhinein oft gemerkt, wie belastend das eigentlich ist. Und ich glaube, das muss man
sich auch schon eingestehen, also, dass es einfach eine Belastung ist und dass es einfach
auch nicht normal und nicht selbstverständlich ist." (Int. 01: 248)
Sehr ähnlich antwortet Annemarie, die neben dem Rat, sich "so früh wie möglich auswärtige
Hilfen (zu) holen" ihre Beobachtung aus der von ihr besuchten Selbsthilfegruppe pflegender
Angehöriger nennt: "Da warten auch manche Leute zu lange, bis sie selber schon ganz fertig
sind":
Annemarie: "Da fällt mir ganz sofort was ein. Ganz viele Hilfen holen. So früh wie möglich
auswärtige Hilfen holen. Da warten auch manche Leute zu lange zu. Dass sie selber so lang
pflegen, dass sie selber schon ganz fertig sind. Aber dass sie rechtzeitig Hilfe holen und professionelle Hilfe, das sag ich halt. Das fällt mir wirklich ein, und das wär ein großer Punkt. Und
den haben manche – das sage ich jetzt vom Stammtisch – sie sagen, ‚nein, die Oma möchte
das nicht, oder der Opa möchte das nicht‘. Das stimmt nicht. Die können nicht mehr entscheiden. Und wenn die da sind, die haben so eine Freude, und das tut ihnen so gut. Und für die
Angehörigen ist es eine Entlastung. Das fällt mir sofort ein. Frühzeitig professionelle Hilfe holen. Das fällt mir sofort ein. Das haben wir immer gemacht, dass wir Hilfe geholt haben. Und
zwar frühzeitig auch." (Int. 04: 86)
Annemaries Ansicht, dass ein zu viel an alleiniger, familialer Pflege ohne Unterstützung krank
machen könne, hat sich im Fall von Sissi bewahrheitet: Nachdem sie lange Zeit ihren schwer
dementen Partner gepflegt hat, wird sie mit einem schweren Leberabszess ins Krankenhaus
eingeliefert und erholt sich danach nur langsam von einer Operation. Sie glaubt, dass alles
weniger dramatisch gekommen wäre, hätte sie "früher auf (sich) gehört", denn wahrscheinlich
waren bereits psychosomatische Symptome einer Überlastung spürbar. Vermutlich auf sich
selbst bezogen, und damit recht selbstkritisch, resümiert sie, man solle nicht so "stur" sein und
früher Hilfe annehmen. Auf Nachfrage konkretisiert sie, dass diese Hilfe eine stundenweise
Beaufsichtigung ihres Mannes hätte sein können, damit sie einmal hätte das Haus verlassen
können:
Sissi: "(antwortet sehr rasch) Früher Hilfe annehmen! Früher Hilfe annehmen und nicht so stur
sein und glauben, man schafft alles alleine. Ja, weil das,- Irgendwann haben alle recht gehabt,
die gesagt haben, ‚Du, irgendwann fällt dir das irgendwann am Kopf‘. Und wenn ich früher auf
mich gehört hätte und früher auf meine Beschwerden und früher reagiert hätte, wäre das alles
nicht so schlimm ausgegangen. Was Gott sei Dank im Grund genommen positiv ausgegangen
ist. Aber es hätte schief ausgehen können. Weil ein so ein Leberabszess (Anm.: den sie hatte!)
ist nicht so ohne.
Int.: War dann ein Warnsignal von Ihrem Körper?
Sissi: Ja, ja, genau. Also früher Hilfe annehmen und früher reagieren.
Int.: Von wem Hilfe? Also, was hätten Sie sich da selbst empfohlen?
Sissi: Eben vielleicht, also dass ich schon früher, wie er noch ein bisserl besser auch beieinander war, dass ich gesagt habe, ‚Du, pass auf, ich gehe heute einmal weg, und es kommt
wer da zu dir‘. Das habe ich also zweimal versucht, das ist schiefgegangen." (Int. 17: 211ff.)
121
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Ebenfalls mit Blick auf die eigene Gesundheit und genauso selbstkritisch antwortet Patrizia,
die lange ihren dementen Mann betreut hat, bevor sie ihn kürzlich in ein Heim gegeben hat.
Auch sie zeigte körperliche Symptome, und ihre Formulierung, dass man "nicht warten muss
bis zum letzten Blutstropfen" macht auf bildlicher Ebene sehr deutlich, dass seelische Schmerzen körperlich werden können. Ihr Umfeld war schon länger der Meinung, sie könne ihren
Mann nicht mehr alleine pflegen, aber sie selbst hörte erst spät auf ihre körperlichen Symptome:20
Int.: "Gibt es noch einen Tipp, den Sie jemandem geben könnten, der,Patrizia: Ja! Man bringt denjenigen früher in ein Heim, weil man nicht warten muss bis zum
letzten Blutstropfen. Das ist nicht gut. Und alle, die in irgendeiner Weise involviert waren, hatten mir gesagt, wenn er fertig ist mit der Alterspsychiatrie, und das ist auch eine gute Einrichtung, danach muss er ins Heim. Und ich konnte das halt nicht. Und mein Sohn hat dann gesagt: ‚Weißt du, ich möchte, dass du endlich mal das tust, was du möchtest.' Und ich wusste
gar nicht mehr, wie das geht." (Int. 13: 150f.)
Noch ein Zitat im Kontext von Selbstschutz durch externe Hilfe ist das von Anton. Auch er hat
den Ratschlag parat, dass man "so schnell wie möglich Unterstützung bekommt in pflegerischer Hinsicht", denn man müsse "sein eigenes Leben leben". Er setzt dies in den Kontext der
Erwerbstätigkeit, die er nicht einfach aufgeben könne, um seinen Vater vollständig allein zu
pflegen:
Anton: "Ja. Naja, Tipp. (…) Ich würde sagen, schauen, wenn es nicht mehr anders geht, dass
man so schnell wie möglich Unterstützung bekommt in pflegerischer Hinsicht. (…) Und ich
würde sagen, wenn man merkt, es geht nicht mehr anders, ja nicht auf die Idee kommen, dass
man selber alles checken kann. Man muss sein eigenes Leben leben. Ich kann auch jetzt nicht
einfach von der Arbeit kündigen. Weil, ich weiß dann nachher auch nicht, ob und wie ich wieder einen Job kriege. Das ist heutzutage nicht so leicht. Ich kann nicht,- ich meine, vielleicht
können es manche, die sagen, finanziell haben sie jetzt kein Problem, dass sie sagen, sie
kündigen von der Arbeit und versorgen ihre Eltern selber. Aber man muss auch ein eigenes
Leben leben." (Int. 05: 134)
Der Tipp, sich selbst abzugrenzen, kommt in der "extremsten" Form von Gitti. Sie gibt den Rat,
sich gar nicht erst in der Pflege eines Angehörigen zu engagieren. Fast wie die Warnung vor
einer Suchtkrankheit formuliert sie: "Fangt nie an! Man rutscht da so rein, und dann kommt
man nicht mehr heraus". Damit wird abermals deutlich, wie unerträglich sie ihre jetzige Situation als pflegende Angehörige des Schwiegervaters findet:
Int.: "Wenn Sie einen Tipp hätten für jemanden, der so in Ihre Situation jetzt kommen würde,
was würden Sie dem sagen?
Gitti: Naja, das, was ich immer sage: Macht das ja nie! Fangt nie an! Man rutscht da so hinein,
und dann kommt man nicht mehr heraus. Und erst wenn es zu spät ist, kommt man drauf, was
man da eigentlich geopfert hat. Also ich sage zu jedem, der in der Situation ist, wo das anfängt,
sag ich: ‚Tut das ja nie‘. Ich würde es auch nicht mehr machen. Ich bin mittendrinnen, und ich
kann,- ja, es ist halt schwierig, wenn jemand so alt ist, obwohl wir schon seit fünf Jahren sagen,
ja, wer weiß, wie lange noch?! Und die Ärzte haben vor 15 Jahren schon gesagt, wir müssen
halt rechnen, dass er nicht mehr so lange wird mit seinem Herzen und so weiter. Aber, ja, es
kann noch zehn Jahre dahingehen. Ich meine, er ist 96. Aber trotzdem, für seine Verhältnisse,
was er eigentlich alles hat, ist es schon ein Phänomen, sagt unser Hausarzt immer. Aber ich
sage zu jedem: ‚Macht das nicht‘." (Int. 09: 161f.)
20
Sie spricht ihre körperlichen Symptome hier nicht konkret an, berichtet aber an anderer Stelle, dass sie lange
unter einer schweren Grippe und Folgesymptomen gelitten hat, die erst langsam wieder abklingen, nachdem sie
ihren Mann in ein Heim gegeben hat.
122
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Bis hierhin ist festzuhalten, dass in den Formulierungen das Wort "früher" sehr dominant
ist, von fast allen Interviewpartner/innen wird es verwendet: "früher Hilfe annehmen und nicht
so stur sein" (Sissi), "man bringt denjenigen früher in ein Heim" (Patrizia), "so früh wie möglich
auswärtige Hilfe holen" oder "früher Hilfe annehmen und früher reagieren" (Sissi). Verbunden
ist dies sicherlich mit der Einsicht, dass man selbst zu spät gehandelt hat, dass man sich zu
spät Unterstützung organisiert hat. Dabei ist dieses quasi Bereuen sogar bei einer Interviewpartnerin vorhanden, die selbst in der Sozialberatung arbeitet, und bei der man vielleicht
vermuten würde, dass sie über genügend Reflexion und Zugangsmöglichkeiten verfügt, um
entsprechende Angebote zu nutzen. Stattdessen sagt sie, dass sie es versäumt habe, rechtzeitig psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Parallel zur Demenzerkrankung ihres
damals noch recht jungen Mannes haben ihre Kinder psychische Auffälligkeiten entwickelt,
und sie meint heute, dass "manche Situationen vielleicht gar nicht so gekommen wären", hätten sie als Familie früher eine Beratung in Anspruch genommen:
Theresa: "Ja, also ich würde auf jeden Fall,- ich würde viel früher eine Beratung in Anspruch
nehmen. Weil für mich war das immer so, ‚Nein, das brauch ich nicht!‘ Auch, was meine Kinder
angeht. Also auch diese psychologische Beratung oder diese Betreuung. Das hab ich immer
so lang weggeschoben. Ich hab immer gesagt, ‚Nein, das schaffen wir schon, ich kenne mich
aus, das machen wir schon!‘ Da hätten wir einfach, -da hätten wir viel früher was machen
sollen. Weil man einfach,-,- Manche Situationen, die wären vielleicht gar nicht so gekommen.
Das hätte gar nicht so weit kommen müssen, weil man schon hätte vorher das abfangen können." (Int. 15: 154)
Liegt in den bisher vorgestellten Zitaten der Fokus auf der Erleichterung der eigenen Situation durch praktische Unterstützung in beraterisch-pflegerischer Hinsicht, gibt es auch Äußerungen, welche den Kranken und die Krankheit in den Mittelpunkt stellen: Der Rat lautet,
dass man sich früher Hilfe und Information holen soll, damit man mit dem Kranken besser umgehen kann.
Der oben zitierte Anton führt seine Ausführungen damit fort, dass eine Überforderung in der
Pflege dazu führen könne, dass man seine Eltern, die man pflegt, "anfängt zu hassen, wenn
sie einem zu viel Zeit in Anspruch nehmen". Bei ihm sei das zwar nie der Fall gewesen, aber
er kann sich bildhaft vorstellen, indem man nämlich die Pflege hinsichtlich der Körperpflege
vernachlässigt:
Anton: "…dass man sich Unterstützung holt. Und das funktioniert dann insgesamt besser.
Weil wenn der Papa dann nur mehr ein Pflegefall ist, dann ist man erstens einmal irgendwann
ausgebrannt und zweitens, ich kann mir vorstellen, bei mir war es nie so weit, dass man dann
seinen Vater oder seine Mutti anfängt zu hassen, wenn sie einem zu viel Zeit einfach in Anspruch nehmen. Dass man sagt, ‚Nein, du brauchst jetzt nicht schon wieder die Hose, ich hab
dich gerade gewickelt, du brauchst dich nicht schon wieder umziehen.‘ Das kann dann nicht
lang gutgehen. Bevor man sich fertig macht, Unterstützung holen. Ja, und auch alle Möglichkeiten, die einem das Gesetz anbietet, als Unterstützung holen. Rechtzeitig erkundigen, Landesförderung für Versorgung, also als Unterstützung." (Int. 05: 144)
Diese Gefahr möglicher Unbeherrschtheit seitens der Pflegenden spricht auch Arnold an. Er
gibt den Tipp, dass man sich "kompetente Stellen sucht, die einen über den Verlauf einer
Krankheit genauer informieren". Sonst könne man als Pflegende/r "unwillig" werden, wie er
sich ausdrückt. Vermutlich hat es diesen Punkt bei ihm zu Beginn der Krankheit seiner Frau
gegeben, die an einer frontotemporalen Demenz litt. Diese Form der Demenz äußert sich in
diesem speziellen Fall darin, dass der Körper nur noch einseitig wahrgenommen wird. Seine
Frau kleidete sich zum Beispiel nur noch auf einer Seite an und verließ das Haus mit nur einem
123
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Schuh statt mit zwei. Er habe das als "Nachlässigkeit" empfunden, und vermutlich war das
eine Situation, in der er "unwillig" wurde:
Arnold: "Dass jemand aus dem Haus geht nur mit einem Schuh. Also diese Nachlässigkeit
oder so. Man nimmt das ja nicht wahr, dass das Ausdruck einer Erkrankung ist. Diesen Rat
könnte ich geben, diese kompetenten Stellen zu suchen, die einen über den Verlauf einer
Krankheit genauer informieren. Was zu erwarten ist und so. Wie man damit umgeht. So muss
man die Erfahrung selbst erst machen.
Int.: Was kann man da falsch machen?
Arnold: Also wenn ich zurück,- Für mich, dass ich, wie soll ich das sagen, unwillig werde.
Int.: Unwillig?
Arnold: Ja. (Pause) Das ist das Einzige." (Int. 14: 150ff.)
Arnold schätzt sich glücklich, diese Form der Unterstützung der von ihm so bezeichneten
"kompetenten Stellen" erhalten zu haben, und zwar vom behandelnden Arzt, der ihm "eine
große Hilfe" war. Er habe ihm den Blick dafür geöffnet, dass seine Frau sich nicht aus "Böswilligkeit" anders verhält als zuvor. Bevor er diese Erkenntnis hatte, habe er jedoch schon
"vielleicht manchmal falsch gehandelt", so denkt er heute:
Arnold: "Da denke ich mir, dass ich damals in dieser Eingangsphase vielleicht manchmal
falsch gehandelt habe. Man muss sich mit der Krankheit stärker auseinandersetzen. Mit den
Formen und so weiter, was sich ergibt und so. Denn das Wissen um die Entwicklungen bei so
einer Krankheit, das hat man ja nicht. Und das nimmt man ja auch nicht wahr, solange nicht
die Notwendigkeit vorhanden ist. Und das dauert, bis man selbst das wahrnimmt. Am Anfang
nimmt das ja nahezu den Charakter an, dass das böswillig geschieht oder so. Weil man einfach die Erscheinungsformen der Krankheit nicht kennt. Und da war schon eine große Hilfe
auch der gute Kontakt zu unserem zuständigen Oberarzt." (Int. 14: 147f.)
Auch für Gregor ist das Verstehen der Krankheit sehr wichtig. Er erteilt den Ratschlag, sich
Informationen zu holen, um dem an Demenz erkrankten Familienmitglied "richtig zu helfen".
Seine Informationsquelle ist ein Stammtisch für pflegende Angehörige, den er regelmäßig besucht. Der dortige Austausch mit anderen Betroffenen und Fachpersonal motiviert ihn zum
Beispiel dazu, Tipps zum Umgang mit dem Erkrankten zu Hause auszuprobieren, man könne
mit verschiedenen Verhaltensweisen "experimentieren":
Int.: "Ich würde Sie gerne noch fragen, ob Sie einen Tipp haben für Personen, die erfahren,
dass ihr Vater oder ein Angehöriger demenzkrank ist.
Gregor: Einen Tipp, ja. Entweder irgendwo hingehen, so wie wir, wir haben den Stammtisch.
Oder einfach mit anderen Leuten austauschen, denen es ähnlich oder genauso geht auch.
Und einfach reden. Viel reden darüber, das ist ganz wichtig. Damit man das versteht, was da
jetzt passiert mit dem Menschen. Weil wenn man das nicht versteht, wenn man das nicht weiß,
kann man auch nicht richtig helfen. Also wichtig ist Information und viel reden mit den Leuten
darüber, die betroffen sind. Oder Fachpersonal. Und da muss ich sagen ist der Stammtisch
eine ganz eine wunderbare Sache. Einfach Informationen einholen. Und experimentieren. Daheim das selber umsetzen. Aber ich sage, die Information und das Austauschen mit anderen,
das ist, glaub ich, das Wichtigste." (Int. 07: 120f.)
Ein letztes Beispiel dieser Kategorie ist von Interviewpartner Felix. Er empfiehlt einen rechtzeitigen Austausch mit der an Demenz erkrankten Person, so lange sie noch gesund ist oder
eine Kommunikation noch möglich ist. In seinem Fall ist das seine Ehefrau. Obwohl er recht
unschlüssig ist, ob er einen guten Rat geben kann, ist sein Zitat so zu verstehen, dass er es
bereut, nicht ein Gespräch mit seiner Partnerin geführt zu haben, in dem geklärt worden wäre,
was sie sich wünscht, sollte sie pflegebedürftig werden – oder generell: was man sich in einer
Partnerschaft einander mitteilt, bevor der Ernstfall eintritt und man sich nicht mehr richtig äu124
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
ßern kann ("wenn es so weit ist, was zu machen wäre"). Er bleibt vage, was er mit wem besprochen hätte (meint er seine Frau oder seine Kinder?) und nimmt seinen Rat auch wieder
ein stückweit zurück, wenn er sagt, dass es "wenn es soweit ist, doch anders (käme)".
Felix: "Einen guten Rat an mich selber?! Ja, Man weiß nie, was einem bevorsteht in dem Sinn,
deswegen, du kannst es nie sagen. Also ich weiß nicht, ob ich anders gehandelt hätte. Oder
einen guten Rat,- Vielleicht früher doch schon vielleicht einmal ein Gespräch geführt, wenn es
soweit ist, was zu machen wäre. Oder,- Ja, aber das sind alles so theoretische Sachen. Man
kann vorher immer planen und planen, und dann, wenn es soweit ist, kommt es doch anders.
Also, ich glaube, man kann das immer nur in dieser Situation entscheiden. Und da kann man
auch gar keinen Tipp geben in dem Sinn und sagen, was gescheiter früher gewesen wäre
oder nicht." (Int. 16: 113)
4.10.1.2 "Ebenen schaffen, damit es dem Menschen gutgeht"
Vereinzelt wurden Ratschläge mit Blick auf die zu betreuende Person gegeben. Die Interviewpartner/innen nannten Beispiele, was getan werden könnte, damit es "dem Menschen
halbwegs gutgeht", wie Elisabeth es formuliert. Marie und Annika wurden konkret und nannten
als lohnende Beschäftigung für ihre/n Angehörige/n das gemeinsame Anschauen von Fotos
oder das Erzählen lassen von früher. Auf die Frage, welche "Tipps" sie für Personen hätten,
deren Angehörige/r an Demenz erkrankt, gaben sie die folgenden Antworten:
Elisabeth: "(überlegt) Offen bleiben. (kurze Pause) Sehr einfühlsam werden. Ja, also das ist
wirklich so, und vor allem: keine Vorurteile zulassen. Ja. Weil, die gibt es. Die haben wir alle
irgendwo da hinten abgespeichert. Und die Situation eben wirklich versuchen, so offen wie
möglich zu überblicken. Und so schnell wie möglich eigentlich versuchen, auch Ebenen zu
schaffen, damit es dem Menschen halbwegs gutgeht." (Int. 02: 211)
Marie: "Also eben die Idee, dass man halt so ein Album hat mit Fotos, das ist glaub ich super.
Das man halt immer auch hinlegt. Nicht immer zwingen, dass er es sich anschaut, aber halt,
dass es immer in der Nähe ist. Dass man es immer durchblättern kann. Also so ein bisschen
so das Besinnen auf die Erinnerungen. Weil, ich glaube am Ende geht es darum, was du für
Erinnerungen hast. Und es sollte um die Erinnerungen gehen, die schön sind." (Int. 08: 95)
Annika: "Ich denke, man soll – ich hab das jetzt nämlich vor Kurzem gelesen und das machen
wir, - also zumindest ich mach es oft, wenn ich bei der Mama bin, dass ich sie frage: 'Was war
damals?‘ Oder ‚was war mit diesen Personen?‘ Wenn jetzt zum Beispiel jemand stirbt, den sie
halt gut gekannt hat, dass sie das gerne dann erzählt. Dass sie doch noch was weiß sozusagen. Also da merk ich, dass,- Da ist sie, ja, da kann sie erzählen, und da kennt sie sich aus.
Also dass man ihnen eben von früher viel mehr,- Oder fragt, oder dass sie das halt erzählen
können. Und ich glaub, dadurch merkt man dann schon, dass sie doch vieles noch weiß,
obwohl sie selber ja oft sagt: 'Na, ich weiß nichts mehr‘. Aber da kommt dann wieder dieses,
dass man über das auch dann spricht oder sie fragt. Nicht, dass man sagt, ‚Naja, kannst eh
nichts fragen, weil sie es nicht weiß‘. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man mit den Betroffenen auch wirklich viel redet. Ich meine, viel redet, aber doch, ja, das, was sie noch wissen, dass man das,- Wenn es auch dann öfter ist. Weil es kommt ja dann öfter die Frage, wer
war das? Oder wer ist gestorben? Das geht ja dann oft drei, vier Stunden, bis sie das dann
wirklich alles erzählt hat von der Person, was sie halt noch weiß." (Int. 11: 170)
4.10.1.3 Die Situation annehmen
Fünf Personen haben den Ratschlag gegeben, der im weitesten Sinn als "die Situation annehmen" interpretiert werden kann, auch wenn sich die einzelnen Strategien voneinander unterscheiden: Es geht darum, die Dinge "mit Humor zu nehmen", einen "entspannten Zugang" zu
haben, Druck vom sozialen Umfeld nicht so ernst zu nehmen, genauso wie aggressive Verhaltensweisen der erkrankten Person nicht persönlich zu nehmen und "das Beste draus zu
machen" – so einige Formulierungen der Interviewpartner/innen.
125
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Lisa verbindet ihren Rat mit Blick auf den Einfluss vom sozialen Umfeld, wenn sie sagt, man
dürfe "Leute, die damit nichts zu tun haben, nicht so ernst nehmen" und "sich nicht verunsichern lassen". Sie bezieht sich auf ihre Entscheidung, die Schwiegermutter in ein Heim gegeben zu haben und deutet damit an, dass es – vermuteterweise oder aus eigener Erfahrung? –
Menschen gibt, die diese Entscheidung für ein Heim nicht gutheißen könnten ("das ist ein
Verbrechen, warum gebt ihr die ins Heim?!"):
Lisa: "Und auch, weißt du, Leute, die damit nichts zu tun haben, die können das auch nicht
nachvollziehen oft. Aber das darf man dann auch nicht so ernst nehmen. Weil, du hast immer
wieder Leute, die sagen: 'Das ist ein Verbrechen, warum gebt ihr die ins Heim? Das geht
nicht!' Und da denke ich mir, okay, ich kann dazu stehen. Das ist eine Entscheidung, die haben
wir nicht aus reinem Egoismus getroffen, sondern das hat sehr wohl Hand und Fuß und einen
Sinn. Und das ist das Beste so. Also dass man sich da nicht verunsichern lässt." (Int. 01: 250)
Cornelia, die sich, wie weiter oben erläutert, von negativen Gefühlen fernhalten möchte, empfiehlt entsprechend einen "bisschen entspannteren Zugang" und "teilweise Dinge einfach mit
Humor" zu nehmen:
Int.: "Hast du irgendeinen Tipp für Familien, die in so einer Situation sind?
Cornelia: Ich würde sagen, am Anfang, also wenn es beginnt, dass man das Ganze, - natürlich
muss man es ernst nehmen. Aber wenn man zu dem Ganzen einen Zugang hat, einen bisschen entspannteren Zugang von der Art, man kann nicht wirklich viel dagegen machen, es ist
natürlich, dass das vielen Leuten so geht, wenn sie alt werden. Und teilweise einfach Dinge
mit Humor nehmen. Am Anfang war das für uns sicher viel einfacher. Ich meine, natürlich
wussten wir, was sich da jetzt entwickelt. Aber trotzdem: Wenn man das einfach, - wenn man
die Sachen, die sie sagt, nicht so ernst nimmt. Vor allem, teilweise ist das dann für sie auch
nicht so angenehm, wenn man dann über alles diskutieren muss, was sie jetzt plötzlich sagt.
Dass man dann über Sachen teilweise nur lacht und es vergisst wieder." (Int. 03: 112f.)
Cornelias Strategie, nicht jedes Wort ihrer dementen Großmutter ernst zu nehmen, ist ein
Selbstschutz, den auch Lena anwendet und anderen empfiehlt. Ihr Vater war ihr gegenüber
aggressiv. Sie möchte diese Kränkungen vermeiden, indem sie versucht, sie "nicht persönlich
zu nehmen":
Lena: "Es nicht persönlich nehmen. Also das ist glaub ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Dass man die Vergesslichkeit nicht persönlich nimmt, dass man auch die Aggressivität nicht
persönlich nimmt. Das ist wichtig." (Int. 06: 129)
Auch Curt plädiert dafür, "es nicht so tragisch (zu) nehmen". Sein Zitat zeigt, dass er die Situation, dass seine Frau an Demenz erkrankt ist, annehmen kann und mit Eifer dabei ist, das
Beste daraus zu machen ("nur nicht nachlassen!"):
Curt: "Naja, er soll es nicht so tragisch nehmen und die Sache nehmen, wie sie ist und versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, so wie ich auch. Also jedenfalls nicht nachlassen. Also
das würde ich dem sagen. Nur nicht nachlassen! Nicht beim Fenster rausschauen und den
Herrgott einen guten Mann sein lassen. Das ist schlecht. Das würde ich als schlecht empfinden, ja. Und, naja, man muss es entgegennehmen. Man kann nicht sagen: 'Um Gottes Willen,
jetzt hat sie den Alzheimer! Was soll ich jetzt machen? Soll ich vielleicht gleich den,- soll ich
mich vielleicht gleich umbringen, oder was?‘"(Int. 12: 268)
Patrizias Rat bezieht sich auch auf das Annehmen der Situation, dabei ist sie aber auch bereit,
Trauriges zuzulassen und ist weniger um eine positive Deutung ihrer Situation bemüht als
Cornelia und Curt. Sie gibt den Rat, sich geistig darauf einzustellen, dass man bei fortschreitender Demenz "unter Umständen irgendwann vergessen wird" und dass man auch dies "akzeptiert". Sie selbst schmerzt der Gedanke sehr, dass ihr Ehemann sie vergessen wird, aber
126
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
sie kann den Fakt des nicht Dauerhaften annehmen ("dass es irgendwann anders sein muss")
und stellt sich darauf ein, auch mit Hilfe von Ratgeberliteratur:
Patrizia: "Was wichtig ist, ist, dass man sich darauf geistig einstellt, dass man unter Umständen irgendwann vergessen wird. Er wird irgendwann vergessen (ihr kommen die Tränen,
Pause). Und das muss man akzeptieren.
Int.: Ja, aber es ist schwer natürlich, gerade wenn das so,Patrizia: Aber man muss es üben.
Int.: Kann man das üben?
Patrizia: Doch, man kann. Ja, man kann das üben.
Int.: Wie geht das praktisch? Nehmen Sie sich das vor, oder wie,Patrizia: Also, ich stell mir das vor. Und außerdem war ich dieses ganze dreiviertel Jahr, das
wir noch zusammen hatten, war ich mir immer mehr und mehr bewusst, dass es nicht dauern
wird. Dass es irgendwann anders sein muss. Dass er irgendwann wirklich ins Heim geht. Und
ich kann nur sagen: Kurt Tepperwein21 anhören, dann geht es. (beide lachen). Kann ich also
wirklich als große Empfehlung mitgeben." (Int. 13: 154ff.)
4.10.2 Gedanken über die Krankheit
Die Erfahrung, einen an Demenz erkrankten Angehörigen zu pflegen, führt bei vielen dazu,
sich mit der Krankheit auf sachlicher, emotionaler und auch spirituell-religiöser Ebene auseinanderzusetzen. Man fragt sich, wie eine Demenzkrankheit erlebt wird, ob man selbst einmal
von dieser Krankheit betroffen sein könnte und wie man sich auf so einen Fall vorbereiten
könnte. Kann man einer Demenzerkrankung vielleicht vorbeugen? Welche anderen Vorkehrungen sind wertvoll, sollte man einmal an Demenz erkranken oder überhaupt pflegebedürftig
werden? Der Interviewleitfaden enthielt diesbezüglich keine konkreten Fragen, so dass nicht
alle Interviewpartner/innen ihre Gedanken dazu geäußert haben. Diejenigen, die das aber taten, sollen hier zu Wort kommen.
Interessant ist zum Beispiel die unterschiedliche Auffassung darüber, wie eine Demenzerkrankung die Persönlichkeit beeinflusst. Annemarie wurde bereits weiter oben zitiert in ihrer von
der Methode der Validation inspirierten Vorstellung, dass die Demenz das Verhalten der Person insofern beeinflusst, als "einfach alles heraufkommt, was sie erlebt haben". Schwierige
Situationen oder Aggressivität seien mit der biografischen Vergangenheit erklärbar und somit
für die pflegenden Angehörigen leichter erträglich, so die Idee.
Gänzlich voneinander abweichende Auffassungen darüber, was die "Seele" betrifft, haben der 79-jährige Arnold und die 37-jährige Marie. Während Marie bei ihrem Vater und ihrer
ebenfalls an Demenz erkrankten Tante nur noch eine "Hülle" sah, der die Seele fehlte, steht
für Arnold fest, dass seine Frau eine nicht demente Seele hatte. Deshalb hat er auch weiterhin
mit ihr geredet, als sie schon lange nicht mehr antworten konnte:
Marie: "Also ich habe es bei zwei Leuten mitbekommen, erstens dieser geistige Verfall, du
bist eigentlich kein richtiger Mensch mehr. Der Geist oder die Seele, das, was dich ausgemacht hat, ist komplett weg. Du steckst in einer Hülle drinnen, du bekommst nichts mehr mit,
du weißt nicht, was vorgeht." (Int. 08: 25)
Arnold: "Da hatte ich eben einen Vortrag gehört von einer (Professorin), eben auch in dieser
Alzheimergruppe. Das ist eine Theologin, eine protestantische Theologin. Die hat gesagt, ‚Es
21 Deutscher Unternehmer und Heilpraktiker, der sich mit Lebensthemen und Esoterik auseinandersetzt und darüber Bücher schreibt.
127
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
wird der Geist dement, aber es wird die Seele nicht dement.‘ Ja, und das war für mich eigentlich die Richtschnur. Das war für mich auch nicht so wichtig, ob ich jetzt eine Antwort kriege,
wenn ich mit meiner Frau rede. Ich habe einfach geredet mit ihr." (Int. 14: 164)
Bei beiden formt die Vorstellung das, was man für sich selbst im Fall der Fälle wünschen
würde. Arnold wünscht sich, dass jemand für ihn sorgen würde, so, wie er für seine Frau da
war:
Arnold: "Im Grunde genommen bleibt der Wunsch übrig, dass man sich selbst für sein eigenes
Leben so etwas wünscht. Wenn man in so eine Krankheitssituation käme. Dass da einfach
jemand da ist." (Int. 14: 164)
Für Marie hingegen ist die Vorstellung, selbst an Demenz zu erkranken, sehr bedrohlich. Die
negativen und belastenden Erfahrungen mit der Demenzerkrankung ihres Vaters haben sie so
geprägt, dass für sie feststeht, dass sie im Falle eigener Betroffenheit keine Last für ihre Familie sein möchte. Sie wünscht sich die rechtliche Freiheit, dann selbst über ein Weiterleben
entscheiden zu können. Dabei fürchtet sie eine genetische Disposition und meint, dass eine
Erkrankung in ihrem Fall sogar "recht wahrscheinlich" sei:
Marie: "Wenn ich sowas auch bekomme, was natürlich recht wahrscheinlich ist, ich meine,
Tante, Oma, Vater, ich möchte nicht so lange damit leben. Einfach, weil ich es mitbekommen
habe, wie es für die,- ich möchte keine Last sein für meinen Mann oder für mein Kind. Also
das ist glaub ich die erste Sache, so diese Last. Ich möchte das nicht. Bewusst nicht. Ich
glaube auch, dass, wenn wir alt sind, in Österreich Euthanasie erlaubt sein wird. So traurig es
klingt, weil man einfach mit der Überalterung umgehen muss. Ich bin auch für Euthanasie.
Also ich finde, jeder sollte entscheiden können, wann und wie er stirbt." (Int. 08: 45)
Ebenso wie Marie hat sich Theresa bereits Gedanken gemacht über eine mögliche Pflegebedürftigkeit im Alter. Zwar geht es bei ihr nicht speziell um das Thema Demenz, aber auch sie
möchte anderen Personen, besonders ihren Kindern, nicht zur Last fallen. Das sieht sie anders
als ihr (durch die Demenz bereits jetzt eingeschränkter) Ehemann, den sie zitiert mit "die Kinder werden ja wohl auf uns schauen". Sie hingegen lehnt das prinzipiell ab und möchte ihre
Kinder nicht in die Situation bringen, selbst entscheiden zu müssen, wann die Pflege der eigenen Eltern zu anstrengend ist ("jetzt ist Schluss"). Vermutlich sowohl wegen ihrer eigenen Situation als auch aus den Erfahrungen, die sie im Berufsalltag als Pflegeberaterin sammelt,
nimmt sie an, dass sich ihre Kinder überfordern würden, und dem möchte sie vorbeugen. Bereits jetzt schaut sie sich Wohnungen im Betreuten Wohnen an:
Theresa: "Das ist so, wenn mein Mann jetzt sagt, puh, nein, das kann er sich überhaupt nicht
vorstellen (=betreutes Wohnen), die Kinder werden ja wohl auf uns schauen. Also das ist für
mich,- Nein, will ich nicht, überhaupt nicht. Also nicht, weil ich sie nicht gernhabe, aber einfach
weil ich gesehen habe, dass das,- Ich war immer stark. Man kann sich immer so einreden,
‚Na, das schaffen wir alles, das geht alles, das ist alles okay‘. Aber innerlich schaut es ja
anders aus. Und ich weiß genau, dass das viele Angehörige einfach nicht sagen können. ‚So,
jetzt ist Schluss, ich kann nicht, ich brauche jetzt Urlaub oder ich mag nichts mehr hören‘. Und
deswegen hab ich für mich das einfach schon,- ich glaube, seit einem Jahr ist das für mich
ganz fix, dass ich,- Ich schau mir immer wieder mal so betreubares Wohnen an, wo ich mir
denke: 'Na schau, voll nette Wohnungen‘." (Int. 15: 43)
Dass sie im Bedarfsfall einmal nicht von ihren Kindern gepflegt werden möchte, hat vielleicht
auch noch einen anderen Grund, denn sie spricht an einer anderen Stelle des Interviews von
einem "einschneidenden" Erlebnis. Zwar geht es "nur" um Vanilleeis, aber das Beispiel zeigt
ihr, dass ihr Sohn sie in ihren persönlichen Vorlieben falsch eingeschätzt hat. So leitet sie wohl
für sich ab, dass innerfamiliale Pflege nicht unbedingt heißen muss, dass man besonders gut
versorgt wird, weil man sich bestens kennt:
128
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Theresa: "Für mich war so einschneidend, als mein mittlerer Bub im Kindergarten war, und er
hätte sollen am Muttertag die Mama beschreiben und zeichnen. Was macht meine Mama
aus? Mein Bub hat mich gezeichnet und hat der Kindergärtnerin gesagt, sie soll aufschreiben:
'Meine Mama schminkt sich jeden Tag und sie isst am liebsten Vanilleeis‘. Und die Kindergärtnerin hat gesagt: Naja, ich meine, das macht eh fast ein jeder‘. Und ich hab' dann gesagt,
na, ich finde das voll schockierend, denn ich hasse Vanilleeis. Also ich kann kein Vanilleeis
essen. Und dann hab ich mir gedacht, jetzt stell ich mir vor, ich komm ins Pflegeheim vielleicht,
mein Sohn meint, er tut der Mama was Gutes, sagt der Schwester drüben: 'Gebt meiner Mama
bitte jeden Tag nach dem Essen ein Vanilleeis, weil das hat sie so gern‘. Und ich spuck die
jeden Tag an und schmeiß vielleicht das Eis runter und werde dann vielleicht noch ruhiggestellt. Und alles nur, weil man irgendetwas Falsches bei mir gesehen hat." (Int. 15: 155)
Theresa nutzt diese Erfahrung jetzt, um ihren Kindern nun schon beizeiten mitzuteilen, was ihr
wichtig ist, damit sie das auch wissen, falls sie sich einmal nicht mehr artikulieren könnte ("ich
möchte jeden Tag gebadet werden, das wissen meine Kinder"). Trotzdem resümiert sie für
sich, dass sie sich eben nicht auf irgendjemand anderen als auf sich selbst verlassen kann –
sie nimmt die Vorkehrungen deshalb "selbst in die Hand":
Int.: "Und Sie haben ja gesagt, Sie setzen sich auch da schon selbst mit sich auseinander,
was Sie mal möchten?
Theresa: Mhm. Ich möchte jeden Tag gebadet werden, das wissen meine Kinder. Das will ich
einfach. Ob sich das dann ausgeht oder nicht. (…) Und dadurch, dass ich mir eigentlich gedacht habe, auf die eigenen Kinder kann man sich verlassen, die kennen einen und dann
kommt sowas raus, weiß ich nicht, ob das dann geschickt ist, dass man sich wirklich auf jemanden verlässt dann. Man muss das einfach selber mehr in die Hand nehmen. Und da gibt
es kein ‚zu früh‘." (Int. 15: 156f.)
Der letzte Satz ihres Zitats enthält wiederum den Hinweis, dass es wichtig sei, Dinge rechtzeitig zu regeln ("da gibt es kein 'zu früh'"), ein wiederkehrendes Thema in der Reflexion.
In manchen Interviews finden sich Unsicherheit oder auch eine gewisse Hilflosigkeit, was die
Krankheit betrifft. So wie in der medizinischen Forschung noch viele offene Fragen bestehen,
beschäftigen sich die Angehörigen damit, wo die Krankheit ihren Ursprung hat, oder ob es
vielleicht doch Heilungschancen gibt. Vor allem zum Ende des Interviews, als die Erzählpersonen gefragt wurden, ob es noch etwas gibt, was wichtig ist, werden diese Gedanken geäußert:
Int.: "Gibt es noch was, was Ihnen wichtig ist zu sagen?
Gregor: Schade, dass man nicht weiß, wo es herkommt. Das ist schade, ja. (Pause)." (Int. 07:
126f.)
Int.: "Jetzt möchte ich Sie noch fragen, ob es für Sie noch was Wichtiges gibt, was wir noch
nicht besprochen haben?
Felix: Ja, eigentlich, die Frage wäre nur, ob Sie ähnliche Fälle haben und ob Sie da was Positives irgendwo rauskitzeln können und sagen können, ja, es gibt irgendwo einen Hoffnungsoder es gibt irgendwas, wo man sagen kann, da kann man vielleicht noch ein bisserl ansetzen
oder was anderes machen?" (Int. 13: 118f.)
Annika hat sich ausführlich mit dem Thema Demenz beschäftigt, auch, weil sie Angst hat,
selbst einmal daran zu erkranken ("hoffentlich passiert mir das nicht"). Sie hat gelesen, dass
die Einsicht und Benennung, etwas zu "vergessen" bereits gefährlich sein kann, weil sie die
Entwicklung einer Demenz begünstigt. Ihre Mutter hätte dieses Wort tatsächlich oft verwendet,
und so versucht Annika nun selbst, bewusst auf diese Formulierung zu verzichten.
129
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Annika: "Wo ich mir oft denke, ‚Jetzt hab ich das auch vergessen!‘ Man soll aber nicht sagen,
vergessen, sondern, glaube ich, ich habe nicht daran gedacht oder so irgendwie. Das habe
ich auch schon gelesen. Man soll nicht sagen: 'Ich hab es wieder vergessen‘. Weil das dann
wieder im Unterbewusstsein, dieses Vergessen, hängenbleibt. (…) Wo ich mir denke, bei der
Mama war es nämlich auch, dass sie oft gesagt hat: 'Ah, jetzt hab ich das schon wieder vergessen!‘" (Int. 11: 180ff.)
Annika hat sich außerdem Gedanken dazu gemacht, dass vielleicht "zurückgehaltene Emotionen" eine Demenzerkrankung begünstigen könnten. Ihre Mütter hätte vieles verdrängt, und
Annika erkennt einen Zusammenhang:
Annika: "Ich weiß jetzt nicht, wie das Buch heißt, über Demenz und unter,- Der schreibt auch,
dass, - Es wird ja auch viel geforscht. Woher das kommt oder was die Ursachen sind. Weiß
man ja nicht. Also dass schon sehr viel mit Emotionen zusammenhängt. Also, alles was emotional behaftet ist, merkt man sich leichter als das Andere, nicht. Und ich denke mir, wenn man
Emotionen irgendwie zurückgehalten hat, dass man sie gar nicht ausgedrückt oder vielleicht
gar nicht ausdrücken kann, viele können Emotionen gar nicht ausdrücken, oder? Da ist schon
eine Blockade, die vielleicht dann auch irgendwann hier sich manifestiert. Ich glaube schon,
dass das, dass Emotionen sehr vieles, auch körperliche Beschwerden oder so und Krankheiten verursachen. (…) Und die Mama war schon eine, die sehr viel zurückgehalten hat. Schon
immer. Also, das habe, damit habe ich mich auch schon eine Zeit sehr beschäftigt. Ich glaube,
bei ihr ist schon sehr vieles ver,- Wie soll ich sagen, nicht ausgedrückt, verdrängt. Nicht? Mit
niemandem darüber gesprochen, wie es ihr gegangen ist. Alles irgendwo unter den Teppich
zu kehren und seine Emotionen,- Ja, das gibt es gar nicht in dem Sinn. Und es wurde auch
zu Hause nie darüber gesprochen, wie es einem wirklich geht oder was man fühlt oder empfindet oder so. Und ich glaube, dass da schon eben ein Zusammenhang ist." (Int. 11: 188)
130
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
5 Zusammenfassung
Zur Studie
Zurzeit leben in Österreich etwa 130.000 Personen, die an einer Form von Demenz erkrankt
sind, die Tendenz ist steigend, vor allem wegen des kontinuierlichen Altersanstiegs in der Bevölkerung (Höfler et al. 2015). Weil damit immer mehr Menschen von diesem Thema betroffen
sind und die Pflege häufig innerfamilial stattfindet, ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema "Demenz und Familie" von wesentlicher Bedeutung. Denn was bedeutet
die Erkrankung im Familienkontext? Wie gehen alle Betroffenen damit um? Wo liegen
Herausforderungen, was entlastet? In der qualitativen Studie wurden österreichweit 17 Familienangehörige von Demenzpatient/innen interviewt, welche die Pflege hauptverantwortlich oder mit anderweitiger Unterstützung übernommen haben. Sie leben in verschiedenen
Regionen Österreichs, sind zwischen 17 und 85 Jahre alt und pflegen einen Elternteil, Schwiegerelternteil, Großelternteil oder ihr/e Partner/in.
Unterschiedliche Pflegearrangements
Acht der 17 Interviewpartner/innen wohnen mit der an Demenz erkrankten Person in einem
gemeinsamen Haus bzw. Haushalt. Die Betreuung in der Familie findet zum Teil unter Einbeziehung einer 24h-Betreuung, mobiler Dienste und/oder informeller Hilfen statt. Die anderen
neun Angehörigen wohnen nicht mit der zu betreuenden Person zusammen, entweder können
sie noch allein leben oder werden anderweitig betreut (z.B. im Pflegeheim).
Dabei sagt die Entfernung, in der Personen zu ihrem/ihrer erkrankten Angehörigen leben,
nicht unbedingt etwas darüber aus, inwieweit sie sich selbst als hauptverantwortlich für die
Betreuung wahrnehmen.
Pflege im Familienverband
Die ausschließliche Pflege im Familienverband funktioniert vor allem dort zufriedenstellend,
wo ausreichende Ressourcen z.B. in Form familiärer Unterstützung zur Verfügung stehen und
sich die Personen mit ihrer Rolle als pflegende Angehörige identifizieren. "Ausschließliche
Pflege" ist nicht so zu verstehen, dass keinerlei Unterstützung von außen in Anspruch
genommen wird, sondern dass diese nur punktuell genutzt wird (z.B. mobile Dienste, informelle Unterstützung durch Verwandte, Kurzzeitpflege u. ä.). Diese punktuelle Unterstützung
wird durchgängig als unverzichtbare Ergänzung erlebt, eine Einschränkung oder gar ein
gänzlicher Verzicht auf entsprechende Möglichkeiten – z.B. aus finanziellen Gründen oder weil
die betreute Person dies ablehnt – stellen einen hohen Belastungsfaktor für die pflegenden
Angehörigen dar.
24h-Betreuung
Die Inanspruchnahme einer 24h-Betreuung ist im Wesentlichen auf drei Gründe zurückzuführen: (1) eine allein lebende Person kann nicht mehr alleine gelassen werden, (2) die alleinige Betreuung ist (z.B. aufgrund einer Erkrankung der Betreuungsperson) nicht mehr zu bewältigen und (3) andere Betreuungsalternativen – insbesondere ein Pflegeheim – werden von
der erkrankten Person oder deren Angehörigen abgelehnt. Als positive Aspekte der 24hBetreuung werden die damit verbundene Entlastung, die Professionalität der Fachkräfte sowie
die sich entwickelnde familienähnliche Beziehung zur Betreuungsperson angeführt. Zu den
negativen Erfahrungen zählen die Schwierigkeit, "den/die Richtige/n" zu finden, mangelnde
131
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Akzeptanz durch die erkrankte Person, fragwürdige Betreuungsqualität sowie – wenn der/die
Angehörige ebenfalls im Haushalt lebt – vor allem die Notwendigkeit, sich mit einer fremden
Person 24 Stunden am Tag arrangieren zu müssen.
Heimbetreuung
Der Betreuung im Heim ist in allen drei Fällen eine langjährige familiäre Pflege vorausgegangen. Die Übersiedelung erfolgte insbesondere bei zwei Personen erst zu einem Zeitpunkt, als
die Kapazitäten der Angehörigen bereits deutlich überschritten waren. Die Gründe für eine
Übersiedelung ins Pflegeheim sind folgende: (1) die familiäre Betreuung ist nicht mehr zu bewältigen bzw. zu verantworten, (2) die betreute Person lehnt den betreuenden Angehörigen
ab oder (3) finanzielle und organisatorische Gründe (z.B. fehlende Räumlichkeiten für 24hKraft). Positiv hervorgehoben wird von den Angehörigen, dass die Unterbringung eine Entlastung für die Familie darstellt (z.B. was die eigene psychisch-körperliche Gesundheit angeht,
aber auch die neuen zeitlichen Ressourcen), zudem wird die gute Betreuungsqualität betont.
Kritisiert wird hingegen der Zeitmangel im Pflegeheim, der einer intensiven individuellen Betreuung entgegensteht. Auch Eingewöhnungsprobleme zählen zu den erwähnten problematischen Aspekten.
Gründe gegen alternative Arrangements
Alternative Betreuungsangebote werden manchmal aus finanziellen oder organisatorischen Gründen nicht gewählt. So erfordert etwa die 24h-Betreuung die Verfügbarkeit entsprechender Räumlichkeiten für die Betreuungskraft und ist nur ab einem gewissen Einkommen (Pension, Pflegegeld) leistbar. Häufiger jedoch werden bestimmte Alternativen von den
Angehörigen oder den an Demenz erkrankten Personen abgelehnt. Dies trifft insbesondere auf Pflegeheime zu. Auch die Erwartungen des sozialen Umfeldes spielen mitunter
eine Rolle.
Finanzierbarkeit der Pflege
Die innerfamiliale Betreuung stellt prinzipiell die kostengünstigste Variante dar. Diese lässt
sich allerdings vorwiegend dann umsetzen, wenn entweder der Pflegeaufwand noch relativ
gering ist oder aber zeitliche und fachliche Ressourcen der Betreuungspersonen in ausreichendem Maße vorhanden sind. Zu berücksichtigen ist hier allerdings auch, dass die kostengünstige Variante der familialen Betreuung auch umgekehrt aufgrund geringer Geldmittel gewählt wird.. Mit Fortschreiten der Erkrankung besteht im Rahmen der familialen Betreuung
häufig das Problem, das zunehmend Hilfe zugekauft werden muss, um Betreuungslücken
im Tagesverlauf zu schließen. Der mit der Demenz verbundene Betreuungsbedarf, der häufig
eine 24h-Anwesenheit erforderlich macht, wird nicht immer durch das zugewiesene Pflegegeld
abgebildet, welches stärker auf körperliche Pflegebedürftigkeit fokussiert. Was die 24h-Betreuung betrifft, so zählt diese zu jenen Betreuungsformen, die "man sich leisten können
muss". Angehörige stoßen dabei durchaus an die Grenzen des Machbaren. Im Gegensatz
zur 24h-Betreuung springt das Sozialamt bei der Unterbringung im Pflegeheim ein, wenn
diese für den/die Betroffene/n nicht leistbar ist. Allerdings wirkt sich die Übersiedelung mitunter
gravierend auf die Einkommenssituation des Partners oder der Partnerin aus, da die Geldmittel (Pension) der erkrankten Person durch die Übersiedelung ins Heim zur Gänze wegfallen. Weitreichende Auswirkungen auf die Familie sind – sofern nicht vorab eine entsprechende Absicherung stattgefunden hat – auch vor allem dann sehr wahrscheinlich, wenn die
Demenzerkrankung sehr früh auftritt und die Erwerbsfähigkeit massiv beeinträchtigt.
132
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Strukturelle Schwierigkeiten und Hürden
An Demenz erkrankte Personen, insbesondere aber deren Angehörige, sind mitunter mit bürokratischen Hürden konfrontiert, die nicht einfach zu überwinden sind. Beklagt werden
lange Wartezeiten, aber auch mangelnde Unterstützung etwa beim Ausfüllen von Formularen. Nicht selten wird aufgrund von Überforderung mit den bürokratischen Anforderungen
auf Förderungen verzichtet. Neben der Vorgangsweise bei der Pflegegeldeinstufung wird
auch ein Mangel an Informationen zu Förderungen, aber auch zur Krankheit selbst und dem
Umgang damit berichtet. Der Wunsch nach konkreten Ansprechpersonen, die für Fragen
zur Verfügung stehen, geht aus den Aussagen klar hervor. Unterstützungs- und vor allem Informationsbedarf besteht auch in Hinblick auf rechtliche Aspekte: So erfuhr ein Angehöriger
erst von der Möglichkeit einer Vorsorgevollmacht für seinen dementen Vater, als eine wichtige
Operation durch das Fehlen einer solchen beinahe nicht durchgeführt werden konnte.
Emotional Schwieriges
Die Einschätzungen der pflegenden Angehörigen dazu, was sie "momentan als besonders
schwierig" empfinden, sind thematisch vielfältig. Die als schwierig empfundenen Zusammenhänge sind vielfältig und sind oft eine Mischung aus Gefühlen der Empathie (Sorge, Verständnis) und eigenen negativen Gefühlen und Einschränkungen (Angebundensein, genervt sein,
Überforderung, schlechtes Gewissen) darstellen. Sie lassen sich in drei Kategorien darstellen:
Die Angehörigen berichten (1) von Einschränkungen in ihrem eigenen psychosozialen Wohlbefinden, (2) Problematiken auf der Beziehungsebene und (3) von Schwierigkeiten andere
Personen betreffend. Die Themen, die im Bereich des eigenen Wohlbefindens angesprochen
werden, sind Anstrengung, Überforderung, räumliches "Angebundensein" und die Gefährdung
der Verwirklichung eigener Lebenspläne (z.B. selbstständige Erwerbsarbeit, Familienplanung). Themen der Beziehungsebene umfassen: die schwierige Kommunikation (beiderseits!), Sorgen um die erkrankte Person und Wesensveränderungen im Laufe der Erkrankung
(z.B. vergessen werden, Aggressivität). Von Schwierigkeiten andere Personen betreffend wird
berichtet, wo es um das Zusammenleben mit einer fremden Betreuungsperson geht (24hKraft) oder wo die Krankheit die bisherigen Sozialkontakte einschränkt, weil der Kranke sich
damit überfordert fühlt.
Emotional Entlastendes
Als entlastend identifiziert wurden (1) der Zusammenhalt im Kreis der Helfenden (meist der
Familie, "dass man nicht alleine ist"), (2) Austausch im Freundes- und Bekanntenkreis (inkl.
Selbsthilfegruppen), (3) Diagnose und Verstehen der Krankheit ("die Diagnose war eine
Erleichterung"), (4) Ablenkung und (5) ein auf sich selbst Besinnen (Erkennen der eigenen
Stärke, evtl. unterstützt durch Literatur, Psychotherapie). Der Austausch mit Nicht-Familienmitgliedern erfüllt dabei vor allem zwei Funktionen: Innerhalb der besuchten Selbsthilfegruppen steht der Informationsaustausch im Zentrum (weniger die emotionale Entlastung) und der
Freundeskreis dient in erster Linie der "Ablenkung"; das Reden über konkrete Inhalte oder
Probleme wird gegenüber nicht-Betroffenen eher ausgeklammert (man redet "nicht so wirklich
ausführlich"). Die Interviewpartner/innen unterscheiden sich darin, ob auf die Frage nach
Entlastung andere Personen genannt werden oder ob man eher Kraft aus sich selbst
schöpft, sich mit sich selbst auseinandersetzt (eventuell mit professioneller Hilfe), in die Natur
geht oder sich Hobbies widmet. Gut zu erkennen ist also, dass manche eher sozial (d.h. auf
andere Menschen) ausgerichtet sind und andere eher im Fokus auf sich selbst zur Ruhe kommen wollen. Die Familienkonstellation (d.h. zum Beispiel die generelle Präsenz von anderen
133
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Familienmitgliedern) scheint dafür nicht entscheidend zu sein, sondern wie man deren
Präsenz wahrnimmt.
Warum man Verantwortung übernimmt
Die Entscheidung zur Übernahme von Verantwortung im Pflegesetting (entweder aktiv pflegerisch oder organisatorisch) ist verschieden motiviert, oft gibt es mehrere Gründe nebeneinander (und nicht nur einen Grund). Am häufigsten wurde eine ethisch-normativ verspürte Verpflichtung artikuliert. Es sei "selbstverständlich", hilfebedürftigen Familienangehörigen aktiv
zur Seite zu stehen. Ob diese Aufgabe gern erfüllt wird, steht auf einem anderen Blatt; manche
Interviewpartner/innen betonen die damit verbundene Last, andere sagen, die Pflege innerhalb
der Familie sei "etwas Schönes" oder "ganz was Großes". Auch eine verspürte emotionale
Verbundenheit ist entscheidend für die Übernahme von Verantwortung, wobei in den dazugehörenden Fallgeschichten diese Verantwortung sogar aktiv eingefordert wurde, weil die
Pflegetätigkeit eines anderen Familienmitglieds als nicht ausreichend wahrgenommen wurde
("ich krieg' es nicht übers Herz, da zuzuschauen"). Eine weitere gängige Formulierung ist, dass
man der Person als Pflegende/r "etwas zurückgeben" möchte, zum Beispiel, weil die im selben Haus wohnende (Schwieger-)mutter früher die Kinder (mit)versorgt hatte. Das Zurückgeben wird vor allem im Sinne intergenerationaler Solidarität erwähnt, aber auch von pflegenden
Partner/innen wurden Aussagen gemacht, die darauf hindeuten, dass die Übernahme der
Pflege in einer Partnerschaft durchaus mit rückblickenden Überlegungen im Sinne einer emotionalen "Bilanz" (wie war unsere Ehe?) verbunden sein kann ("meine Frau ist auch immer für
mich da gewesen"). Schließlich kann auch ein empfundenes Pflichtgefühl gegenüber Dritten
die Person dazu bewegen, die Pflege auf jeden Fall zu übernehmen, zum Beispiel weil man
den Partner nicht enttäuschen möchte (Pflege seiner Mutter) oder das bisherige Familiensetting erhalten möchte.
Grenzen der Verantwortung
Die Grenzen der eigenen Pflegetätigkeit ziehen die Angehörigen an unterschiedlichen Stellen,
vom Verzicht auf regelmäßigen Kontakt, Rückzug aus Gesprächen bis hin zum Wechsel des
Betreuungsarrangements, damit man z.B. nicht mehr alleine verantwortlich ist. Es wurden unterschiedliche Gründe genannt. Neben eher sachlich-strukturellen Gründen (z.B. eigene Erwerbstätigkeit und Notwendigkeit dauernder Präsenz – "was ist, wenn was passiert?"), die ein
anderes Betreuungsarrangement erfordern und damit die eigene Pflegetätigkeit einschränken,
sind (1) die eigene psychosoziale Gesundheit und (2) Zusammenhänge der Beziehungsebene zwischen der pflegenden und der erkrankten Person von Bedeutung. So kann die eigene psychische oder körperliche Anstrengung (z.B. "ständig genervt sein", aber auch: den
Partner nach einem Sturz nicht mehr alleine aufheben können) nach sich ziehen, dass nach
einem Heimplatz Ausschau gehalten wird. In Hinblick auf die Beziehungsebene können z.B.
alte Konflikte und Verletzungen oder auch der Schmerz, dass man vergessen wird, dazu führen, dass die Betreuungs- und Pflegetätigkeit eingeschränkt wird. So zeigt sich insgesamt,
dass die Definition der eigenen Grenzen durchaus mit der Persönlichkeit der hilfebedürftigen
Person und der Beziehungsqualität in Verbindung gebracht wird ("je nachdem, wie das Verhältnis ist").
Veränderungen im Familiensystem: Neue Rollen und Rollenumkehr
Nach Veränderungen im Familiensystem gefragt, die sie mit der Erkrankung ihres/ihrer Familienangehörigen in Verbindung bringen, erzählen die Interviewpartner/innen in verschiedener
Hinsicht von einem neuen Rollengefüge: Erstens kann das die Generationenbeziehungen
134
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
betreffen. Nach und nach wird die erkrankte Person ihren Status als selbstverantwortliche,
erwachsene Person einbüßen. Besonders in Paarbeziehungen wird das schmerzlich erlebt,
ein partnerschaftlicher Umgang auf Augenhöhe ist kaum möglich, eher wird die Person "wie
ein weiteres Kind" wahrgenommen. Umgekehrt zeigte sich, dass Kinder von an Demenz erkrankten Eltern nun die erwachsenere Rolle übernehmen, wenn es etwa um Entscheidungen
oder Fürsorge geht; die Verhältnisse kehren sich um. Besonders für jüngere Kinder kann diese
Rollenumkehr schwierig sein, weil sie die Krankheit noch gar nicht voll erfassen können und
ihre Eltern als Vorbild, nicht als hilfebedürftige Person wahrnehmen können/möchten. Auch
von Rollenwechseln im Geschlechterkontext wurde berichtet, und zwar hauptsächlich von
Angehörigen im Paarkontext. Erkennbar war in der Stichprobe eine deutlich traditionelle Aufgabenteilung, so dass die Erkrankung nach sich zieht, dass pflegende Männer das Kochen
neu erlernen müssen (weil die Frau es nicht mehr kann) und pflegende Frauen sich in den
Bereich der Familien-Finanzen einarbeiten müssen oder eine Erwerbsarbeit aufnehmen, weil
diese Bereiche vorher ihrem Partner zugeordnet waren. "So wie ich früher war, das ist jetzt
er", sagt etwa eine Frau, deren Partner recht jung an Demenz erkrankte und der nun den
Haushalt führt, während sie das Familieneinkommen sichert.
Kontinuitäten im Familiensystem: Positives und Schwieriges
Eine Demenzerkrankung zieht nicht immer und auf jeder Ebene Veränderungen nach sich.
Vielmehr zeigen einige Fallbeispiele, dass eine Demenzerkrankung bestehende Konstellationen nicht grundlegend verändert, sondern sie weiterbestehen oder sich durch die neue Situation in neuem Licht zeigen oder sich intensivieren. Das betrifft positive wie negative FamilienKonstellationen. So können sich enge Beziehungen unter den Helfenden vertiefen (z.B.
positivere Paarbeziehung, weil man sich als "Team" sieht, erwachsene Kinder kommen öfter
zu Besuch) oder aber bestehende Konflikte an Brisanz gewinnen. Hier wurden vor allem
schwierige Beziehungen unter Geschwistern thematisiert, anhaltende oder durch die neue Situation wieder "aufpoppende" Konflikte unter den erwachsenen Kindern von dementen
Eltern waren in den Interviews recht dominant. Es geht um erlebte Benachteiligungen im
emotionalen und finanziellen Bereich (Eifersucht auf bevorzugte Geschwister, Erbschaft,
Hausüberschreibung), die sich darin äußerten, dass entweder um die Pflege gestritten wurde
(wer darf die Eltern zu sich holen?) oder ganz im Gegenteil die Pflegeverantwortung abgelehnt
wurde ("ihr habt das Haus gekriegt und ihr müsst das machen").
Ratschläge für andere Betroffene
Die meisten Ratschläge für andere betroffenen Angehörigen finden sich zum Thema, dass
externe Hilfe essenziell sei ("nur ja nicht glauben sollte, man schafft es allein"). Einige Personen berichten, dass sie selbst schon psychosomatische Krankheiten entwickelt hätten und
erkennen in der Rückschau, dass sie zu spät Unterstützung geholt hätten. Sie raten deshalb
zu einem früheren Handeln. Auch in anderen Zusammenhängen ist das Wort "früher" sehr
dominant in den Ratschlägen: "früher Hilfe annehmen und nicht so stur sein", "man bringt
denjenigen früher in ein Heim", "so früh wie möglich auswärtige Hilfe holen" oder "früher Hilfe
annehmen und früher reagieren". Ein frühes Agieren diene nicht nur der eigenen Gesundheit, sondern auch dem Wohl der erkrankten Person, das ist ein weiterer Fokus: Der Rat
lautet, dass man sich früher Hilfe und Information holen soll, damit man mit der erkrankten
Person besser umgehen kann, ihr Verhalten besser einordnen kann (z.B. Aggressivität) und
"Ebenen schafft, damit es dem Menschen gutgeht". Außerdem wurden Ratschläge formuliert,
die im weitesten Sinn als "die Situation annehmen" interpretiert werden können, auch wenn
135
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
sich die einzelnen Strategien voneinander unterscheiden: Es geht darum, die Dinge "mit Humor zu nehmen", einen "entspannten Zugang" zu haben, Druck vom sozialen Umfeld nicht so
ernst zu nehmen, genauso wie aggressive Verhaltensweisen der erkrankten Person nicht persönlich genommen werden sollten und "das Beste draus zu machen" – so einige Formulierungen der Interviewpartner/innen.
Gedanken über die Krankheit
In den Interviews finden sich an verschiedenen Stellen Hinweise darauf, wie die pflegenden
Angehörigen die Krankheit Demenz reflektieren. Es bestehen recht unterschiedliche Auffassungen darüber, inwieweit eine Demenzerkrankung die Persönlichkeit beeinflusst.
Die Aussagen reichen von der Überzeugung, der Mensch sei nur noch eine "Hülle" ("der Geist
oder die Seele, das, was dich ausgemacht hat, ist komplett weg") bis hin zur Vorstellung, dass
gerade das Wesentliche des Menschen noch übriggeblieben sei ("es wird der Geist dement,
aber es wird die Seele nicht dement"). Einige Interviewpartner/innen nehmen die Erkrankung
ihres/ihrer Angehörigen auch zum Anlass, sich über die eigene Zukunft Gedanken zu machen,
was eine mögliche Pflegebedürftigkeit im Alter betrifft. Auch hier ist der Hinweis, man selbst
wolle Dinge rechtzeitig regeln (z.B. Platz im Betreuten Wohnen organisieren; Angehörigen
mitteilen, was man für Essensvorlieben hat) ein wiederkehrendes Thema in der Reflexion. In
manchen Interviews finden sich Unsicherheit oder auch eine gewisse Hilflosigkeit, was
die Krankheit betrifft. So wie in der medizinischen Forschung noch viele offene Fragen bestehen, beschäftigen sich die Angehörigen damit, wo die Krankheit ihren Ursprung hat, oder
ob es vielleicht doch noch Heilungschancen gibt.
136
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
6 Literatur
Barkholdt, Corinna; Lasch, Vera (2004): Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit.. Expertise für
die Sachverständigenkommission für den 5. Altenbericht der Bundesregierung. Dortmund, Kassel.
Beach, D. L. (1997): Family Caregiving. The positive impact on adolescent relationships. In: The Gerontologist 37 (2), S. 233–238. DOI: 10.1093/geront/37.2.233.
Beiglböck, Wolfgang; Feselmayer, Senta; Honemann, Elisabeth (Hg.) (2000): Handbuch der klinischpsychologischen Behandlung. Wien: Springer.
Bruder, Jens (1988): Filiale Reife. Ein wichtiges Konzept für die Versorgung kranker, insbesondere dementer alter Menschen. In: Zeitschrift für Gerontopsychologie und -psychiatrie (1), S. 95–101.
Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) (Hg.) (2002): Vierter Bericht
zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Risiken, Lebensqualität und
Versorgung Hochaltriger – unter besonderer Berücksichtigung dementieller Erkrankungen. Vierter
Altenbericht. Berlin.
Celdrán, Montserrat; Villar, Feliciano; Triadó, Carme (2014): Thinking about my grandparent. How dementia influences adolescent grandchildren's perceptions of their grandparents. In: Journal of Aging Studies 29, S. 1–8. DOI: 10.1016/j.jaging.2013.12.004.
Celdrán, Montserrat; Triadó, Carme; Villar, Feliciano (2009): Learning from the disease. Lessons drawn
from adolescents having a grandparent suffering dementia. In: International Journal of Aging &
Human development 68 (3), S. 243–259. DOI: 10.2190/AG.68.3.d.
Conde-Sala, Josep Lluís; Garre-Olmo, Josep; Turró-Garriga, Oriol; Vilalta-Franch, Joan; López-Pousa,
Secundino (2010): Differential features of burden between spouse and adult-child caregivers of
patients with Alzheimer's disease. An exploratory comparative design. In: International Journal of
Nursing Studies 47 (10), S. 1262–1273. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2010.03.001.
Costa, Giuliana; Ranci, Costanzo (2010): Disability and Caregiving. A step toward social vulnerability?
In: Costanzo Ranci (Hg.): Social vulnerability in Europe. The new configuration of social risks. Basingstoke: Palgrave Macmillan, S. 159–185.
Deutsche Alzheimergesellschaft e.V (2011): Die Lewy-Körperchen-Demenz. Das Wichtigste 14. Berlin
(Das Wichtigste - Informationsblätter). Online verfügbar unter www.alz.ch/index.php/demenzformen-und-ursachen.html?file=tl_files/PDFs/PDF-D-Infoblatt/IB_163_A_31_Lewy_Koerper_Demenz_.pdf, zuletzt geprüft am 27.11.2018.
Dosch, Erna; Riegraf, Birgit (2017): Wie Männer pflegen. Dissertation, Universität Vechta. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-22704-3, zuletzt geprüft am 27.11.2018.
Ecarius, Jutta (Hg.) (2007): Handbuch Familie. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Ehrhardt, Thorsten; Plattner, Anita (1999): Verhaltenstherapie bei Morbus Alzheimer. Göttingen: Hogrefe Verlag für Psychologie.
Franke, Luitgard (2011): Demenz in der Ehe. Eine Beziehung auf der Kippe. In: Geronymus (29), S. 1–
3. Online verfügbar unter http://www.alexianer-muenster.de/fileadmin/user_upload/alexianer-muenster.de/Unsere_Angebote/Hilfen_bei_psychischen_Erkrankungen/Zentren/Gerontopsychiatrisches_Zentrum/Beratung/Geronymus/Geronymus_Archiv/Geronymus_29.pdf, zuletzt geprüft am
27.11.2018.
Franke, Luitgard (2006): Demenz in der Ehe. Über die verwirrende Gleichzeitigkeit von Ehe- und Pflegebeziehung. Eine Studie zur psychosozialen Beratung für Ehepartner von Menschen mit Demenz.
Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag (Mabuse-Verlag Wissenschaft, 101).
Geiger, Arno (2012): Der alte König in seinem Exil. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (dtv, 14154).
Graß, Hildegard; Walentich, Gabriele; Rothschild, Markus A.; Ritz-Timme, Stefanie: Gewalt gegen alte
Menschen in Pflegesituationen. In: Rechtsmedizin 17 (6), S. 367–371. DOI: 10.1007/s00194-0070465-8.
Geiger, Arno (2012): Der alte König in seinem Exil. München: Dt. Taschenbuch-Verlag (dtv, 14154).
Hamill, Sharon Boland (2012): Caring for grandparents with Alzheimer’s Disease. In: Journal of Family
Issues 33 (9), S. 1195–1217. DOI: 10.1177/0192513X12444858.
137
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Höfler, Sabine; Bengough, Theresa; Winkler, Petra; Griebler, Robert (2014): Österreichischer Demenzbericht 2014. Bundesministerium für Gesundheit und Sozialministerium. Wien.
Klott, Stefanie (2012): Wenn Söhne pflegen… In: Informationsdienst Altersfragen 39 (4), S. 12–17.
Kurz, Alexander; Freter, Hans-Jürgen; Saxl, Susanna; Nickel, Ellen (2016): Demenz. Das Wichtigste.
Ein kompakter Ratgeber. Ratgeber für Angehörige und Profis. 2. Aufl. Online verfügbar unter
https://www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/alz/broschueren/das_wichtigste_ueber_alzheimer_
und_demenzen.pdf, zuletzt geprüft am 27.11.2018.
Langehennig, Manfred (2012): Genderkonstruierte Angehörigenpflege. Wenn Männer "männlich" pflegen. In: Informationsdienst Altersfragen 39 (4), S. 5–11.
Maier, Wolfgang; Barnikol, Utako (2014): Neurokognitive Störungen im DSM-5. Durchgreifende Änderungen in der Demenzdiagnostik. In: Der Nervenarzt 85 (5), S. 564–570. DOI: 10.1007/s00115013-3984-4.
Neu, Hedwig (2016): Desorientiert mit Würde. In: Leidfaden 5 (4), S. 34–35. DOI:
10.13109/leid.2016.5.4.34.
Philipp-Metzen, H. Elisabeth (2008): Die Enkelgeneration im ambulanten Pflegesetting bei Demenz.
Ergebnisse
einer
lebensweltorientierten
Studie.
Online
verfügbar
unter
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-91139-7.
Ranci, Costanzo (Hg.) (2010): Social vulnerability in Europe. The new configuration of social risks. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Rosowski, Martin (2012): Männer und Pflege. Eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit. In: Informationsdienst Altersfragen 39 (4), S. 19–22.
Rothgang, Heinz; Kalwitzki, Thomas; Müller, Rolf; Runte, Rebecca; Unger, Rainer: Schwerpunktthema
Pflegebedürftigkeitsbegriff. November 2016 (Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, 42).
Schneider, Julie A.; Arvanitakis, Zoe; Bang, Woojeong; Bennett, David A. (2007): Mixed brain pathologies account for most dementia cases in community-dwelling older persons. In: Neurology 69 (24),
S. 2197–2204. DOI: 10.1212/01.wnl.0000271090.28148.24.
Schweizerische Alzheimervereinigung (Hg.) (2007): Häufige Demenzerkrankungen: Alzheimer-Krankheit und vaskuläre Demenz. Online verfügbar unter www.alz.ch/index.php/demenzformen-und-ursachen.html?file=tl_files/PDFs/PDF-D-Infoblatt/163_A_05_IB_Haeufige_Demenzformen_d.pdf,
zuletzt geprüft am 07.11.2018.
Seidl, Elisabeth (2007): Pflegende Angehörige im Mittelpunkt. Studien und Konzepte zur Unterstützung
pflegender Angehöriger demenzkranker Menschen. Wien: Böhlau.
Szinovacz, Maximiliane E. (2003): Caring for a demented relative at home. Effects on parent–adolescent
relationships and family dynamics. In: Journal of Aging Studies 17 (4), S. 445–472. DOI:
10.1016/S0890-4065(03)00063-X.
Walther, Guy (2007): Freiheitsentziehende Maßnahmen in Altenpflegeheimen – rechtliche Grundlagen
und Alternativen der Pflege. In: Ethik Med 19 (4), S. 289–300. DOI: 10.1007/s00481-007-0535-1.
Weyerer, Siegfried (2005): Altersdemenz. Hg. v. Robert Koch Institut. Berlin (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 28).
Witt, Karsten; Deuschl, Günther; Bartsch, Thorsten (2013): Frontotemporale Demenzen. In: Der
Nervenarzt 84 (1), S. 20–32. DOI: 10.1007/s00115-012-3477-x.
Wright, Lore K. (1998). In: Sexuality and Disability 16 (3), S. 167–179. DOI: 10.1023/A:1023042924997.
138
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
7 Kurzbiografien der Autorinnen
Dr. Sabine Buchebner-Ferstl (Projektleitung)
Psychologin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an
der Universität Wien. Forschungsschwerpunkte: Elternbildung, Entwicklungspsychologie, Bildungsverläufe und Arbeitsteilung in der Familie.
Kontakt: sabine.buchebner-ferstl@oif.ac.at
Dr. Christine Geserick
Soziologin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an
der Universität Wien. Forschungsschwerpunkte: Qualitative Forschungsmethoden, Statuspassage Jugend und Familien- und Geschlechterverhältnisse aus sozialhistorischer Perspektive.
Kontakt: christine.geserick@oif.ac.at
Bei der Erstellung dieses Berichts haben sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖIF
mitgewirkt.
139
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Zuletzt erschienene Forschungsberichte des ÖIF
Kostenfrei erhältlich über die Homepage www.oif.ac.at/publikationen/forschungsberichte/
Kapella, Olaf; Rille-Pfeiffer, Christiane; Schmidt, Eva-Maria (2018): Evaluierung des BundesKinder- und Jugendhilfegesetzes (B-KJHG) 2013. Zusammenfassender Bericht aller Module und Beurteilung. Forschungsbericht Nr. 29/2018.
Kapella, Olaf; Rille-Pfeiffer, Christiane; Wernhart, Georg; Baierl, Andreas; Halbauer, Stefan
(2018): 2. Teilbericht der Evaluierung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes (BKJHG). Endbericht der Module 4, 6 und 7. Forschungsbericht Nr. 28/2018.
Kapella, Olaf; Baierl, Andreas; Geserick, Christine; Kaindl, Markus; Wernhart, Georg (2018):
1. Teilbericht der Evaluierung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes (B-KJHG).
Endbericht der Module 2, 3 und 5. Forschungsbericht Nr. 27/2018.
Neuwirth, Norbert; Kaindl, Markus (2018): Kosten-Nutzen-Analyse der Elementarbildungsausgaben in Österreich. Der gesamtwirtschaftliche Effekt des Ausbaus der Kinderbetreuungsplätze im Zeitraum 2005 bis 2016. Forschungsbericht Nr. 26/2018.
Wernhart, Georg; Dörfler, Sonja; Halbauer, Stefan; Mazal, Wolfgang; Neuwirth, Norbert
(2018): Familienzeit – Wie die Erwerbsarbeit den Takt vorgibt. Perspektiven zu einer
Neugestaltung der Arbeitszeit. Forschungsbericht Nr. 25/2018.
Kaindl, Markus; Kapella, Olaf (2016): Betreuung in den Schulferien in NÖ. Individuelle Lösungen – Wahrnehmungen – Wünsche. Forschungsbericht Nr. 24/2016.
Buchebner-Ferstl, Sabine; Kapella, Olaf; Rille-Pfeiffer, Christiane (2016): Psychosoziale Unterstützungsleistungen der österreichischen Familienpolitik. Wirkungsanalyse der familienpolitischen Leistungen des Bundes – Modul V. Forschungsbericht Nr. 23/2016.
Neuwirth, Norbert (2016): Was sind uns unsere Kinder wert? Eine Kostenschätzung zum weiteren Ausbau im Elementarbildungsbereich. Forschungsbericht Nr. 22/2016.
Buchebner-Ferstl, Sabine; Kapella, Olaf; Kaindl, Markus; Stolavetz, Christina; Baierl, Andreas
(2016): Erziehung – nicht genügend? Österreichische Eltern auf dem Erziehungsprüfstand. Forschungsbericht Nr. 21/2016.
Buchebner-Ferstl, Sabine; Kaindl, Markus; Rille-Pfeiffer, Christiane (2016): Bildungsentscheidungen in der Familie beim Übergang von der Volksschule in die weiterführende Schule.
Forschungsbericht Nr. 20/2016.
Dörfler, Sonja; Wernhart, Georg (2016): Die Arbeit von Männern und Frauen. Eine Entwicklungsgeschichte der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung in Frankreich, Schweden
und Österreich. Forschungsbericht Nr. 19/2016.
Buchebner-Ferstl, Sabine; Geserick, Christine (2016): Vorgeburtliche Beziehungsförderung.
Dokumentation von Erfahrungen mit der Methode der Bindungsanalyse. Forschungsbericht Nr. 18/2016.
Geserick, Christine; Kaindl, Markus; Kapella, Olaf (2015): Wie erleben Kinder ihre außerhäusliche Betreuung? Empirische Erhebung unter 8- bis 10-Jährigen und ihren Eltern in Österreich. Forschungsbericht Nr. 17/2015.
140
�ÖIF Forschungsbericht Nr. 30 | Demenz und Familie | Februar 2019
Das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien (ÖIF) wird vom
Bundeskanzleramt über die Familie & Beruf Management GmbH (FBG) und von den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol,
Vorarlberg und Wien unterstützt.
141
�
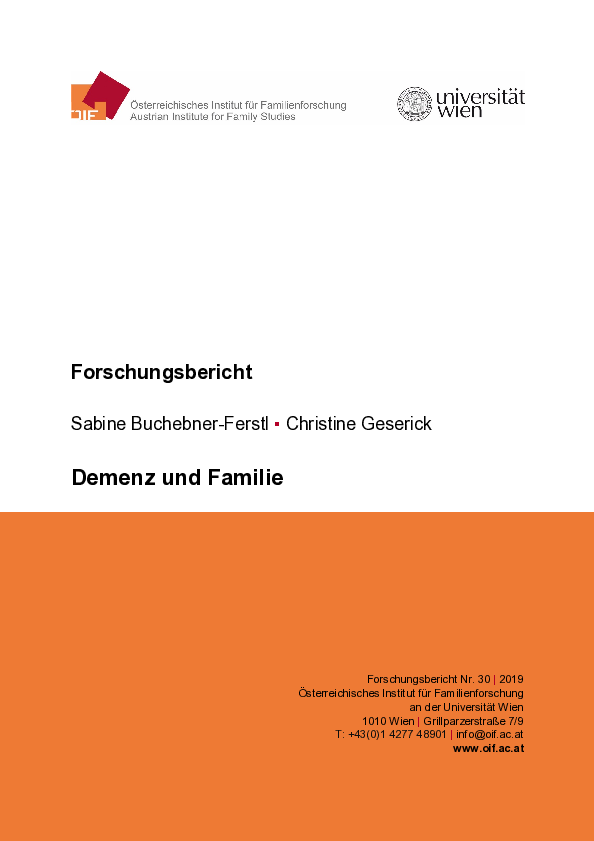
 Sabine Buchebner-Ferstl
Sabine Buchebner-Ferstl