Wolfgang U. Eckart 2014: Medizin und Krieg. Deutschland 1914–
1924. Paderborn: Ferdinand Schöningh, geb., 564 S., 49,90 €, ISBN
978-3-506-75677-0.
Livia Prüll und Philipp Rauh (Hg.) 2014: Krieg und medikale Kultur.
Patientenschicksale und ärztliches Handeln in der Zeit der Weltkriege, 1914–1945. Göttingen: Wallstein 2014, brosch., 283 S., 24,90
€, ISBN 978-3-8353-1431-3.
Astrid Stölzle 2013: Kriegskrankenpflege im Ersten Weltkrieg.
Das Pflegepersonal der freiwilligen Krankenpflege in den Etappen des Deutschen Kaiserreiches [= Jahrbuch Medizin, Gesellschaft
und Geschichte, Beiheft 49]. Stuttgart: Franz Steiner, brosch., 227 S.,
42,00 €, ISBN 978-3-515-10481-4.
Emily Mayhew 2014: Wounded. The Long Journey Home from the
Great War. London: Vintage, brosch., 275 S., 8,99 £, ISBN 978-0-09958418-6.
2014 jährte sich der Beginn des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal. Die
Historikerzunft beging das Jubiläum mit zahlreichen Konferenzen, Monographien und Ausstellungen zum globalen militärischen Konflikt, der sich mit
seiner vernichtenden Gewalt tief in die Erinnerung des 20. Jahrhunderts eingegraben hat. In ihrem 2015 herausgegebenen Band Zeitalter der Gewalt
wandten sich beispielsweise Michael Geyer, Helmut Lethen und Lutz Musner
überzeugend gegen die ubiquitäre Formel des Ersten Weltkrieges als ,,Urkatastrophe‘‘, die in eine sozial und politisch vermeintlich festgefügte Ordnung
der Welt eingebrochen sei. Stattdessen argumentieren sie für eine Deutung des
Krieges als einem explosiven Moment der Krise, der mit zerstörerischen
Mitteln eine sich verändernde Welt neu zu fügen begonnen habe. Fieberhafte
203
.
REZENSIONEN /REVIEWS
N.T.M. 23 (2015) 203–226
0036-6978/15/030203-24
DOI 10.1007/s00048-015-0133-0
Ó 2015 SPRINGER BASEL
�REZENSIONEN /REVIEWS
Aktivitäten ließen sich auch in der deutschen Medizingeschichte beobachten,
die aufgrund der langjährigen Fokussierung auf die Medizin im Nationalsozialismus dem Ersten Weltkrieg erst seit den 1990er Jahren größere
Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Im Jubiläumsjahr nun thematisierten wissenschaftliche Veranstaltungen, Dokumentationen in Print und Fernsehen
sowie eine Vielzahl von Publikationen die enormen Herausforderungen, die
der Große Krieg mit seinen Millionen von Verwundeten, Versehrten und
Kranken für die medizinische Versorgung bedeutet hat. Die Frage stellt sich
deshalb: Hat das Jubiläumsjahr die medizinhistorische Diskussion befruchtet?
Im Folgenden möchte ich vier Neuerscheinungen zur Medizingeschichte des
Ersten Weltkrieges vorstellen und vergleichend miteinander diskutieren,
aktuelle Forschungsfragen und -ansätze beleuchten und Desiderata für die
Zukunft aufzeigen. Wohin könnte sich die Forschungsfront, um im Wortfeld
zu bleiben, hundert Jahre nach Kriegsausbruch bewegen?
Das mit Abstand voluminöseste Buch hat im Jubiläumsjahr der Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang Eckart vorgelegt. Medizinische Themen
im Kontext von Krieg und Kolonialimperialismus begleiten Eckart seit
Jahrzehnten. Aufgrund seiner langjährigen Expertise, ausgewiesen durch
hervorragende Publikationen wie etwa 2012 zur Medizin in der NS-Diktatur,
durfte man auf sein Epos Medizin und Krieg. Deutschland 1914–1924
besonders gespannt sein. Wie Eckart in Vorwort und Einleitung betont, ist sein
Buch nicht als enge militärmedizinische Studie angelegt, die sich der kriegsbedingten Fortentwicklung der Medizin widmet (worunter Eckart ,,ältere
Forschungsansätze‘‘ subsumiert). Er will vielmehr eine ,,medizinische Gesellschaftsgeschichte des Weltkrieges‘‘ (9) schreiben, die sich einer Sozial- und
Erfahrungsgeschichte verpflichtet fühlt, und zu weiteren Forschungen in
diesem Bereich anregen. Medizingeschichtliche Fragen nach den Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung, nach dem Leiden und Sterben in
der Heimat, stehen Eckart zufolge auch hundert Jahre nach Beginn des
Völkerringens weitgehend am Anfang.
Das rund 450 Seiten starke Buch gliedert sich in fünf Hauptkapitel. Nach
einem Einführungskapitel, in dem Eckart die ,,nervöse‘‘ Gesellschaft der
Vorkriegszeit, den patriotischen Furor der überwiegend nationalkonservativen
Ärzteschaft zu Beginn des Konflikts sowie deren Wahrnehmung des Krieges
als einzigartiges Erfahrungsfeld für den medizinischen Erkenntnisgewinn
umreißt, wird die eigentliche Kriegszeit in drei Hauptkapiteln behandelt. Trotz
Eckarts Bekenntnis zu einer medizinischen Gesellschaftsgeschichte des
Weltkrieges räumt er dabei militärmedizinischen Themen viel Platz ein, wobei
traditionelle Erkenntnisinteressen im Vordergrund stehen, etwa die Profilierung von Einzeldisziplinen, die institutionellen Entwicklungen im
Sanitätswesen (beispielsweise in der Kriegskrankenpflege) oder die Fortschritte in Therapie und Prophylaxe. Zu Beginn von Kapitel 3 (,,Im Krieg‘‘)
rücken allerdings auch erfahrungsgeschichtliche Perspektiven auf
204
�REZENSIONEN /REVIEWS
Verwundung, Krankheit und Tod in den Blick. So spürt Eckart anhand von
Feldpostbriefen dem Erleben von Verwundung und Krankheit von Soldaten
nach, skizziert Lebensbedingungen und Ängste der Schwestern in der Etappe
oder schildert anhand literarischer Texte die frontnahen Verbandsplätze als
Orte des Grauens. Das ,,Soziotop‘‘ der Etappen- und Heimatlazarette als
,,konkreter Lebensraum einer Gruppe von verwundeten Kriegern und pflegenden Zivilisten‘‘ (123) hingegen bleibt unscharf. Basierend auf seinem 2013
publizierten Band über Lazarettpostkarten erläutert er an dieser Stelle zwar
versiert die generelle Verwendung von Bildpostkarten im Krieg und die Inszenierung und Motivik von Lazarettpostkarten. Zur eigentlichen
Krankenpflege, den Beziehungen zwischen Schwestern und Soldaten, der
Zusammenarbeit unter den Pflegenden oder dem Alltag der Lazarette erfährt
der Leser jedoch kaum etwas. Der zweite Teil von Kapitel 3 ist dann den
Entwicklungen in der Psychiatrie, Neurologie und Hirnforschung sowie der
Bakteriologie und Hygiene gewidmet. Im Hinblick auf die somatisch-neurogenen Erkrankungsbilder, die bei 10 bis 15 Prozent aller in den Lazaretten
erfassten Soldaten beobachtet wurden, referiert Eckart den leidlich bekannten
psychiatrischen Fachdiskurs zur ,,Kriegsneurose‘‘, der sich wiederum in
äußerst brutalen Therapien wie der sogenannten Kaufmann-Methode niederschlug. Für die Bakteriologie und Hygiene verweist Eckart auf das
Laboratorium als neues institutionelles Element der Militärmedizin und
behandelt, wie schon in einem seiner früheren Aufsätze, exemplarisch die
Weil’sche Krankheit, den Wundstarrkrampf und das Fleckfieber. Letzteres
herrschte vor allem an der Ostfront, in Südosteuropa und auf dem Balkan und
forderte besonders viele Todesopfer in den Kriegsgefangenenlagern des Inund Auslandes, gerade auch beim Sanitätspersonal. Für manchen Arzt kam die
Abkommandierung in ein Kriegsgefangenenlager deshalb einem Todesurteil
gleich. Für die Medikalisierung der Soldaten erwiesen sich die strikten Entlausungsmaßnahmen in der Armee als nachhaltige Erfahrung, wurden doch
Millionen von deutschen Soldaten mittels Ganzkörperrasuren und Entlausungsbädern saniert, um den Überträger des Fleckfiebers zu eliminieren.
Die anvisierte ,,medizinische Gesellschaftsgeschichte‘‘ des Weltkrieges
löst Eckart vor allem mit Kapitel 4 (,,Heimatfronten‘‘) ein, das den Krieg als
Mobilisierungs- und Transformationsfaktor beschreibt, der die Gesundheitsverhältnisse der Kriegsgesellschaft tiefgreifend veränderte. In sozial- und
geschlechtergeschichtlicher Herangehensweise belegt Eckart auf der Basis
differenzierter Zahlenreihen die ,,Funktionalisierung‘‘ des weiblichen Körpers
im Krieg, die einher ging mit seiner Militarisierung und systematischen
Indienstnahme. Frauen mussten während des Krieges nicht nur stets zur
Reproduktion bereit sein, um die Volkskraft Deutschlands zu erhalten, sie
sprangen zugleich in die Lücke der Männer im industriellen Produktionsprozess und opferten sich in der Krankenpflege auf. Folgen dieser
Mehrfachbelastung und der Ernährungskrise waren unter anderem ein
205
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
kontinuierlicher Mortalitätsanstieg während des Krieges, körperliche Überbelastungen, die Zunahme der Tuberkuloseanfälligkeit und der Amenorrhoe,
problematische Schwangerschaften und Fehlgeburten. Auch Geschlechtskrankheiten nahmen zu, da manche Kriegerfrau aufgrund der großen
materiellen Not heimlich der gelegentlichen oder regelmäßigen Prostitution
nachging. Hart traf der Krieg insbesondere die Kinder, deren gesundheitliche
Situation sich trotz der Schaffung von Kleinkinderfürsorgestellen, Kriegskindergärten und Kinder- und Schulspeisungen katastrophal verschlechterte. Die
Mangelernährung aufgrund der dramatischen Versorgungsengpässe, die
psychischen Belastungen und die steigende Kinderarbeit führten dazu, dass
Kinder ein verzögertes Wachstum aufwiesen, an Tuberkulose, Ruhr, Diphterie
oder Rachitis erkrankten oder starben. Doch nicht nur Kinder litten massiv,
auch Insassen von geschlossenen Anstalten wie psychiatrischen Heil- und
Pflegeanstalten wurden – oftmals wissentlich – unterversorgt, was zu einem
überdurchschnittlichen Anstaltssterben führte. Nach Eckart lässt sich darüber
streiten, ,,ob hier bereits von stiller ,Euthanasie’ oder von Krankenmord zu
sprechen ist‘‘ (286).
Unter dem Titel ,,ferne Schauplätze‘‘ geht Eckart in Kapitel 5 erneut auf die
Militärmedizin ein, wobei er die Balkan- und Kolonialfronten in den Blick
rückt und der desolaten gesundheitlichen Situation in Kriegsgefangenenlagern
nachgeht. Eindrücklich zeigt er, wie sich in den frontnahen deutschen
Kriegsgefangenenlagern ein gewalttätiges System der extremen Zwangsarbeit
unter schlechtesten Lebensbedingungen zu etablieren vermochte, das der in
der Haager Landkriegsordnung geforderten ,,menschlichen‘‘ Behandlung
Kriegsgefangener Hohn sprach. Ein Schlusskapitel schließlich zeichnet die
Folgen des Krieges in medizinischer und gesundheitspolitischer Hinsicht bis
Mitte der 1920er Jahre nach. Diese Öffnung des Untersuchungszeitraums ist
in gesamtgesellschaftlicher Perspektive unerlässlich, sahen sich Medizin und
Gesundheitspflege doch unmittelbar nach dem Krieg bis circa 1924 angesichts
drängender Probleme der Sozialversicherung und Invalidenfürsorge sowie den
in der Bevölkerung um sich greifenden Krankheiten (Spanische Grippe,
Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten) sowie der Hungerkrise mit starken
Regelungsbedürfnissen und Erwartungen nach schnellen Interventionen
konfrontiert. Letztere konnten unter anderem dank ausländischer Hilfeleistungen wie etwa den amerikanischen Quäkerspeisungen für hungernde Kinder
zumindest partiell eingelöst werden.
Eckarts Medizin und Krieg kann zweifellos als Summe einer Forscherkarriere bezeichnet werden. Es bietet eine unglaubliche Fülle von Fakten,
Themen und Informationen, die jedem Neueinsteiger in die Medizingeschichte des Ersten Weltkriegs eine willkommene Orientierung ermöglicht
und als Nachschlagewerk beste Dienste leisten wird. Das Buch vermag indes
aufgrund seiner heterogenen Organisation kein Masternarrativ einer medizinischen Gesellschaftsgeschichte des Krieges zu entwickeln. Eckarts Plädoyer,
206
�REZENSIONEN /REVIEWS
die ,,gesellschaftliche Komplexität des Krieges‘‘ medizingeschichtlich genauer
zu durchleuchten, sollte für zukünftige Studien aber sehr ernst genommen
werden.
Bezüglich der Militärmedizin bleibt Eckart über weite Strecken althergebrachten Themen und traditionellen Ansätzen einer Militärmedizin ,,von
oben‘‘ verpflichtet. Ein willkommenes Ausbrechen aus diesen Pfaden bietet der
Sammelband Krieg und medikale Kultur. Patientenschicksale und ärztliches
Handeln im Zeitalter der Weltkriege 1914–1945. Herausgegeben von Livia
Prüll und Philipp Rauh, spiegelt der Band die Ergebnisse eines gleichnamigen
DFG-Projekts, das auf der Basis von bislang nicht systematisch ausgewerteten
Krankenakten und Sektionsprotokollen des Freiburger Bundesarchiv-Militärarchivs die alltägliche Behandlungspraxis der Truppenärzte im Ersten und
Zweiten Weltkrieg am Beispiel der seelischen Krankheiten sowie der Herzund Kreislauferkrankungen untersucht. Statt auf Fachdiskurse und therapeutische Konzepte zu fokussieren, gehen die Autorinnen und Autoren des
Bandes in alltags- und mentalitätsgeschichtlicher Perspektive auf die konkreten Handlungsspielräume der Ärzte im Feld und ihren Umgang mit
Patienten ein. Inwiefern wurden zeitgenössisch gängige Theorien und
Behandlungsschemata im therapeutischen Alltag implementiert? Wirkten
sich ideologische und militärische Denkmuster auf den Umgang der Truppenärzte mit kranken Soldaten aus? Und lässt sich, so die übergeordnete
Fragestellung, vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg eine ,,Radikalisierung‘‘ in
der therapeutischen Praxis beobachten?
Für den Ersten Weltkrieg präsentieren Petra Peckl und Philipp Rauh
erstaunliche Resultate: Der auf der Grundlage normativer Quellen und
fachärztlicher Publikationen bislang in der Forschung stark gemachte Imperativ der möglichst schnellen Wiederherstellung von Front- und
Arbeitsverwendungsfähigkeit der Soldaten bewahrheitete sich im Behandlungsalltag der Kriegsneurotiker und erschöpften Soldaten nicht. Während
Fachpsychiater wie Max Nonne und hochrangige Internisten wie Wilhelm His
psychisch kranke und herzkranke Soldaten als minderwertig stigmatisierten,
aktive Zwangstherapien wie die Kaufmann-Methode anregten (im Falle der
Kriegsneurotiker), vor vorschnellen Diagnosen (im Falle der Herz-Kreislauferkrankungen) warnten und Folgeschäden ausblendeten, ließen sich frontnahe
Militärärzte nicht von diesen rigiden Forderungen und dem ideologisch aufgeladenen Leistungsdenken beeinflussen. Unter Anwendung einfacher
Therapieformen wie Ruhe, Erholung, kräftigender Kost sowie der Verabreichung von Beruhigungsmitteln richteten sich die meisten Truppenärzte
durchaus am Wohl ihrer Patienten aus, gestanden ihnen längere Zeit für die
Regeneration und auch Ansprüche auf Renten zu. Zwischen behandelndem
Arzt und krankem Soldat bestand, wie Rauh betont, ein Konsens darüber, dass
das Leiden von den Strapazen des Krieges herrührte und nicht auf endogene,
dem Patienten anzulastende Ursachen zurückzuführen war.
207
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
Nach 1918 wurden, wie Livia Prüll genau darlegt, die ärztlichen Aktivitäten während des Weltkrieges glorifiziert, zugleich aber auch die mangelnde
Effektivität der Medizin moniert. Daraus zog man im NS-Staat Konsequenzen:
Nicht nur wurde mit der Gründung der Militärärztlichen Akademie 1934 die
Forderung nach einem effektiveren Sanitätswesen aufgestellt, der zivile Arzt
wurde nun auch zunehmend zum Gesundheitsoffizier umkodiert, der die
Interessen der Volksgemeinschaft vor das Individualwohl zu stellen hatte und
die Rassen- und Erblehre in den Behandlungsalltag einfließen lassen sollte.
Peter Steinkamp kann in seinem Aufsatz zum ärztlichen Handeln und den
Patientenschicksalen im Zweiten Weltkrieg zeigen, dass sich die Truppenärzte
tatsächlich vollständig dem ideologisch und militärisch bedingten Leistungsund Effizienzdenken unterordneten und der Behandlungsalltag geprägt war
von einer Abwertung der Patienten, von Verdachtsmomenten der Degeneration und Abartigkeit, der Vernachlässigung der Leiden in Diagnostik und
Therapie bei den herzkranken und härtesten Therapien bei psychisch kranken
Soldaten.
Der gut strukturierte, stringent argumentierende Sammelband offenbart
damit für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eine zunehmende ,,Radikalisierung‘‘ und ,,Brutalisierung‘‘ (28) der deutschen Militärmedizin, die im
Hinblick auf die Lehrmeinungen und Methoden in der Militärpsychiatrie bis in
die 1970er-Jahre Spuren hinterließ, wie Philipp Rauh in einem gelungenen
Ausblick auf die Nachkriegszeit darlegt. Kritisch ist anzumerken, dass der
Band den im Titel angesprochenen Patientenschicksalen und einer Perspektive
auf die Patienten als handelnde Subjekte in der Bewältigung ihrer Krankheiten
kaum Platz einräumt. Das kranke Individuum mittels Krankenakten und
Sektionsprotokollen zum Sprechen zu bringen, erweist sich zwangsläufig als
schwieriges Unterfangen – was im Übrigen auch bereits in der Einleitung
konstatiert wird. Für die alltäglichen Handlungsspielräume der Truppenärzte
und die militärmedizinische Perspektive ,,von unten‘‘ erweist sich der Band
aber als ungemein anregend.
Während bei Prüll und Rauh das Alltagshandeln der frontnahen Truppenärzte im Fokus steht, sind es in Astrid Stölzles’ Kriegskrankenpflege im
Ersten Weltkrieg die Angehörigen der freiwilligen Krankenpflege, die in den
Lazaretten und Lazarettzügen der Etappe gearbeitet haben. Das Buch, eine
leicht überarbeitete Version von Stölzles an der Universität Stuttgart abgeschlossener Dissertation, schließt eine wichtige Forschungslücke, fand das
Pflegepersonal der Lazarette in der deutschen Medizingeschichte im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Raum doch bislang kaum Aufmerksamkeit.
Eine alltags- und mentalitätsgeschichtliche Studie, die die Handlungsfelder der
Schwestern und männlichen Pfleger, ihre Beziehungen zu den Patienten, die
Zusammenarbeit mit Ärzten und Mitpflegenden sowie ihre persönlichen
Kriegswahrnehmungen anvisierte, fehlte bislang gänzlich. Für ihre Analyse
stützt sich Stölzle primär auf Egodokumente (Briefe, Tagebücher, Memoiren
208
�REZENSIONEN /REVIEWS
und Berichte), verfasst von Akteuren der freiwilligen Krankenpflege wie RotKreuz-Schwestern, Angehörigen der Ritterorden und der konfessionellen
Pflegeorden und -vereine. Ziviles Krankenpflegepersonal ergänzte im Ersten
Weltkrieg erstmals in umfassender Weise den militärischen Sanitätsdienst.
Die Schwestern und Pfleger der freiwilligen Krankenpflege hatten, wie
Stölzle in einem Einführungskapitel zur Struktur und Organisation der
Krankenpflege zeigt, bereits 1907 mit einer Dienstverordnung konkrete
Anweisungen erhalten und wurden während des Krieges von einem Kaiserlichen Kommissar geleitet. In den folgenden zwei Kapiteln, dem eigentlichen
Herzstück des Buches, stellt die Autorin die Aufgabenfelder der Schwestern
und Pfleger in der Etappe vor und erörtert die Lebensbedingungen in Lazaretten an östlichen und westlichen Kriegsschauplätzen. Stölzle beschreibt die
Seuchenpflege, die Verwundetenpflege und die pflegefremden Tätigkeiten wie
etwa die Arbeit in Wäscherei und Küche, die als besonders unbeliebt galten, in
gesonderten Abschnitten. Für die Seuchenstationen oder Seuchenabteilungen
erfahren wir, dass sowohl die strikten Vorgaben zur Trennung der Patienten
nach Infektionskrankheiten als auch die rigiden Desinfektions- und Hygienevorschriften oftmals nicht eingehalten wurden, insbesondere wenn die
Lazarette überlastet waren oder wenn Epidemien auftraten. Mischinfektionen
häuften sich deshalb. Das Auftreten von Neuinfektionen und das Sterben von
Seuchenkranken mangels adäquater Versorgung wurde von Pflegenden als
sehr bedrückend empfunden und dem Versagen von Ärzten und Verwaltung
angelastet. Immer wieder erkrankten auch Schwestern und Pfleger an Infektionskrankheiten wie Typhus, Ruhr, Cholera oder Fleckfieber, wobei letzteres
vor allem das männliche Pflegepersonal betraf, da Frauen – zumindest offiziell
– nicht auf Fleckfieberstationen arbeiten durften. Verwundetenstationen von
Kriegslazaretten boten an Gefechtstagen mit den in endloser Zahl eintreffenden verschmutzten, verstümmelten, durch Kopf- und Bauchschüsse
schwer verletzten Soldaten ein erschreckendes Bild und verlangten den Pflegenden alle Kräfte ab. Schwestern und Pfleger mussten hier aufgrund des
Einsatzes der Ärzte in den Operationssälen oft selbst entscheiden, welche
Medikamente gegeben wurden, ob ein Verbandwechsel nötig war oder die
eitrigen Wunden ausgespült werden sollten. Eine reguläre Grundpflege der
Soldaten (Waschen, Lagern, Essenreichen), das Säubern von Böden oder die
Sterbebegleitung fielen in solchen Situationen meist weg und die Pflegenden
arbeiteten bis zu 24 Stunden durch. Fehlte es an Morphium, spritzten sie
zuweilen Kochsalzlösungen, um einen Placebo-Effekt zu erzielen. Der harte
Einsatz und die begrenzten Möglichkeiten zur Linderung des Leidens, vor
allem von sehr jungen Männern und Vätern, zehrte an den freiwilligen
Hilfskräften und führte zu häufiger Niedergeschlagenheit, Erschöpfungszuständen und ,,nervöser Überreizung‘‘. Um die Schwestern, die in der
Öffentlichkeit im Gegensatz zu den männlichen Pflegern als Engel stilisiert
wurden, zum Durchhalten zu animieren, verlieh man ihnen Medaillen, hob die
209
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
Gehälter an und organisierte Lazarettbesuche des Kaisers und hochrangiger
Generäle. Kraft für den harten Arbeitsalltag, der auch Spannungen in der
Zusammenarbeit mit Militärärzten mit sich brachte, tankten Schwestern und
Pfleger bei gemeinsamen Spaziergängen, beim Schreiben von Briefen an die
Mutterhäuser oder Familienmitglieder, bei bunten Abenden oder Gebets- und
Singstunden. Zum Durchhalten motivierte aber auch der Respekt und die
Zuneigung für die Frontsoldaten, die als aufopfernde Helden betrachtet
wurden, die ihr Leben auch für die Pflegenden aufs Spiel setzten. Die Patienten
selbst sahen in den Schwestern nicht nur die Pflegende, sondern auch die
Kameradin, Betschwester und Mutter, der man die Erlebnisse der Front
ebenso anvertrauen konnte wie familiäre Sorgen und finanzielle Nöte. Die
freundschaftlichen, emotionalen Beziehungen zwischen Patienten und Pflegenden belegen nicht zuletzt wiederholte Danksagungen in Soldatenbriefen.
Stölzles fundierte Arbeit zum Pflegealltag in der Etappe bringt uns nicht
nur die bei Eckart thematisierten, jedoch wenig konkretisierten ,,Soziotope‘‘
der Lazarette näher, sie kann mit ihrer Studie auch die im Sammelband von
Prüll und Rauh eher randständige Patientenperspektive bereichern. Die
langfristigen Folgen des psychisch und physisch strapazierenden Kriegseinsatzes für die Angehörigen der freiwilligen Krankenpflege in der
Nachkriegszeit bleiben allerdings – wie Stölzle selbst notiert – ein Desiderat
der Forschung.
Für den Lesefluss eher hinderlich ist es, dass Stölzles Narrativ auf einer
aggregierten, die Individuen egalisierenden Ebene verbleibt und auch kaum
mit Zitaten aufgelockert wird. Der Fokus liegt zudem auf einzelnen Orten und
Lokalitäten der Pflege in der Etappe und vermittelt somit einen statischen,
segregierten Blick auf Verwundung, Tod und den Alltag der Pflegenden – ein
Blick, der den konstanten Fluss von verletzten und kranken Soldaten, aber
auch von Ärzten und Pflegern zwischen der vordersten Front und der Heimat
nicht einfangen kann.
Eine solche medizinische Bewegungsgeschichte, die der Verwundung der
Soldaten und ihrer Versorgung und Betreuung auf verschiedensten Stationen,
vom Niemandsland in Flandern bis in die Spitäler Londons nachgeht, leistet
Emily Mayhew mit Wounded. The Long Journey Home from the Great War.
Das auf die Shortlist des Wellcome Trust Buchpreises gewählte Buch Mayhews repräsentiert im wahrsten Sinne des Wortes A New History of the
Western Front, wie der Untertitel der 2013 erschienenen gebundenen Ausgabe
lautete. Denn nicht nur ist die von Mayhew eingeführte Bewegungsgeschichte,
die die Interdependenz, Vernetzung und Fluidität von militärischer und heimatlicher Kriegsfront stark macht, analytisch äußerst fruchtbar; sie verbindet
zudem diesen Zugang mit einem spektakulären Narrativ, welches das
persönliche Erleben und Erfahren von verwundeten Soldaten, ihrer Pflege und
Versorgung aus größter Nähe darstellt.
210
�REZENSIONEN /REVIEWS
Mayhew beschäftigt sich in 13 Kapiteln mit 32 sorgfältig ausgewählten
Individuen. Es sind Porträts von verwundeten Soldaten aus allen vier Kriegsjahren, von den bislang von der Forschung vernachlässigten
Krankenbahrenträgern, die als erste mit den Verwundeten im Niemandsland
zu tun hatten, sowie von Stabsärzten, Chirurgen, Schwestern, Krankenwärtern, Seelsorgern und freiwilligen Helfern. Ergänzend wendet sich
Mayhew spezifischen Orten der Pflege und Versorgung wie Spitalzügen,
Eisenbahnstationen und Ambulanzen zu.
Individuelle ,,Patientenschicksale‘‘ ebenso wie Erfahrungswelten von
Truppenärzten, Schwestern, Geistlichen und Hilfskräften werden von Mayhew sicht-, hör- und fühlbar gemacht, in einer zuweilen fast unerträglichen
Intensität. Ergänzt werden die zu Kurzgeschichten geronnenen Schicksale
durch Fotos von Hauptpersonen und Bilder der Stationen, welche Verwundete
auf ihrem Weg in die Heimat passierten.
Mayhew konzentriert sich auf die Westfront und schreibt vorwiegend
über Granat- und Schussverletzungen. Um ein vollständigeres Bild zu erhalten, wäre eine medizinische Bewegungsgeschichte auch für die Erschöpfungsund psychischen Krankheiten zu schreiben und Schauplätze wie die Ostfront
und außereuropäische Arenen, in welchen Epidemien den Krieg durchgängig
begleiteten, ebenso in den Blick zu nehmen. Moniert werden muss auch, dass
sie mit ihrer neuen, die Kriegs- und Heimatfront verschmelzenden Geschichte
letztlich auf Dreiviertel des Weges stehen bleibt, erfährt man doch nicht, was
die Verwundeten nach ihrer Entlassung aus der institutionalisierten Betreuung erlebten, als sie in den Kreis ihrer Familie, zu ihren Frauen, Kindern,
Verwandten und Freunden zurückkehrten.
Auch wenn Mayhew das Erfahren und Erleben des eigensinnigen Subjekts
in einmaliger Prägnanz hervorzuheben vermag, hätte Carlo Ginzburg, der
Doyen der italienischen Mikrogeschichte, an Mayhews Buch wohl keine
Freude. Der Grund dafür liegt in Mayhews Erzählweise. Die Hindernisse, die
sich der mikrohistorischen Forschung in Form von Lücken und Verzerrungen
der Quellen entgegenstellen, sind nach Ginzburg in das historische Narrativ
einzuflechten. Mayhew dagegen liefert sämtliche Quellenbeschreibungen erst
in einem vom Haupttext separierten Anhang und geht kaum auf quellenkritische Fragen ein. Damit bleibt die Frage offen, ob sie Lücken der
Überlieferung zu einer fast zu glatten Oberfläche poliert hat. Klar ist, dass sie
mit ihrer Erzählung die Leser in eine besonders enge, intime Beziehung zu den
beteiligten Personen treten lässt und damit Leseeindrücke von geradezu filmischer Qualität schafft. Die Bilder und Szenen lassen einen nicht mehr los:
die zerrissenen, von Blasen überzogenen Hände des Krankenbahrenträgers
Ernest Douglas; die stumpfen Amputationssägen im Operationssaal des
Chirurgen Normand Prichard; der zur grotesken Fratze verkommene, einbandagierte Kopf John Glubbs, dem eine Granate den Kiefer wegriss und der
auf der wochenlangen Zug- und Schiffsreise in die Heimat vergeblich versucht,
211
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
sich verständlich zu machen, um Essen und Trinken zu erhalten; oder Elisabeth Boon, die einen Soldaten im Sterbezelt eines Lazaretts ein letztes Mal
aufschreien hört, weil das an seinem Kopfkissen befestigte Lavendelsäckchen
herunterfällt und er seinen eigenen verfaulenden Körper riecht.
Welche Anregungen für zukünftige Medizingeschichten des Großen
Krieges können aus den hier besprochenen Publikationen gezogen werden?
Zum einen könnte die deutsche Medizingeschichtsschreibung von mehr Mut
zu Nähe profitieren – mehr Mut zu persönlich, intim und untypisch erzählten
Schicksalen und Erfahrungswelten der Patienten und des medizinischen
Personals. Dabei wäre nicht nur die Frage zu stellen, wie einzelne Individuen
unmittelbar mit Verwundung, Vergiftung, Krankheit und Tod umgegangen
sind, sondern auch wie Verwundung, Krankheit und das Miterleben von
Leiden und Sterben Menschen langfristig transformierte, wie sie den Krieg
nach dem Krieg mit Leib und Seele verarbeiteten, wie sie resilient wurden oder
an genau dieser Adaptionsaufgabe zerbrachen.
Zum andern könnten sich neue Horizonte öffnen, wenn das in medizingeschichtlichen Arbeiten weithin verbreitete Denken in Dichotomien und
stabilen Settings aufgebrochen würde. Dies betrifft zunächst die häufige
Trennung von Kriegs- und Heimatfront. Sie sollte durch eine Analyse der
Vernetzungen, Interdependenzen und effektiven Bewegungen zwischen
Schützengräben und den heimatlichen Arenen sowie der Betonung von
instabilen, sich kontinuierlich neu formierenden medizinischen Alltagen systematisch unterlaufen werden. Basierend auf dieser die Kriegs- und
Heimatfront verschmelzenden Betrachtungsweise könnte auch von einer
Trennung von Militärmedizin und medizinischer Gesellschaftsgeschichte des
Krieges abgesehen werden. Statt diese Zugänge gegeneinander auszuspielen
oder unabhängig voneinander zu verfolgen, wären vielmehr die Überschneidungen zwischen der gegenwärtig besonders stark gemachten Militärmedizin
,,von unten‘‘ und einer sozial- und erfahrungsgeschichtlich orientierten
medizinischen Gesellschaftsgeschichte des Krieges zu betonen. Damit die
gesellschaftliche Komplexität des Krieges medizingeschichtlich erfasst werden
kann, wie dies Eckart zurecht fordert, ist ein Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung in Deutschland ebenso wie der Gesellschaften der besetzten
Gebiete unabdingbar, seien sie nun in West- und Osteuropa oder auf den
fernen Kriegsschauplätzen beheimatet. Hier, ebenso wie bei einem Fokus auf
die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, verbinden sich militärmedizinische
und gesamtgesellschaftliche Ebenen zwangsläufig miteinander.
Eine die militärische und gesellschaftliche Ebene integrierende Medizingeschichte des Ersten Weltkrieges könnte dabei nicht nur wie bisher
Anregungen aus der Sozial-, Geschlechter-, Mentalitäts- und Alltagsgeschichte aufnehmen, sondern auch neuere, in der kulturhistorischen
Forschung stark gemachte Ansätze und Perspektiven. So wären etwa MenschTier-Verhältnisse in den Schützengräben, in den Lazaretten und im eigenen
212
�REZENSIONEN /REVIEWS
Heim als Mikrokosmen in den Blick zu rücken, die zur Bewältigung von
Verwundung, Krankheit und psychischen Belastungen oder zur Verarbeitung
von Sterben und Tod bedeutsam waren. Interessant wäre für das Gesundheitsverhalten im Krieg auch ein Blick auf das Handeln mit Dingen (Amulette,
Medaillons etc.) im Kontext alltäglicher Rituale oder Formen des Aberglaubens und der Spiritualität bei Truppenärzten und Pflegenden, bei Soldaten,
aber auch bei Familienangehörigen und Freunden von Verletzten, Vermissten,
Kranken und Toten.
,,Im Westen Nichts Neues‘‘ – anders als die titelgebende Notiz des Heeresberichtes, mit der Erich Maria Remarque seinen Schlüsselroman zum
Ersten Weltkrieg beendet, gilt für die Medizingeschichte hundert Jahre später:
Es gibt und wird auch in Zukunft noch viel Neues und Anregendes zu
berichten geben.
Silvia Berger Ziauddin (Zürich)
Ruth Oldenziel und Mikael Hård 2013: Consumers, Tinkerers,
Rebels. The People who Shaped Europe [Making Europe: Technology and Transformations 1850–2000, 1]. Basingstoke u. a.: Palgrave
Macmillan, geb., 416 S., 65,00 £, ISBN 978-0-23030801-5.
Martin Kohlrausch und Helmuth Trischler 2014: Building Europe
on Expertise. Innovators, Organisers, Networkers [Making Europe:
Technology and Transformations 1850–2000, 2]. Basingstoke u. a.:
Palgrave Macmillan, geb., 390 S., 60,00 £, ISBN 978-0-23030801-5.
Wolfram Kaiser und Johan W. Schot 2014: Writing the Rules for
Europe. Experts, Cartels and International Organizations [Making
Europe: Technology and Transformations 1850–2000, 4]. Basingstoke
u. a.: Palgrave Macmillan, geb., 396 S., 60,00 £, ISBN 978-0-230308077.
,,Who, indeed, built Europe? Entrepreneurs and engineers? Politicians and
scientists? Consumers and activists?‘‘ Mit diesen programmatischen Fragen
stellt sich die von Johan Schot und Philip Scranton herausgegebene, auf insgesamt sechs Bände angelegte Making Europe-Reihe auf ihrer Homepage vor;
eine Buchreihe, die mit dem Anspruch antritt, eine neue Geschichte Europas
zu präsentieren (http://www.makingeurope.eu). Ihre zentrale These lautet,
dass der Technik für die europäische Integration und mithin für den Prozess
des Making Europe eine zentrale Rolle zukam. Genau diese Rolle der Technik
soll aus transnationaler Perspektive untersucht werden, wobei hier selbstverständlich ein breiter Technikbegriff zugrunde liegt, der – wie die
213
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
Herausgeber betonen – ,,people and values, ideas, skills and knowledge‘‘
umfasst (Einführung zur Serie, jeweils X). Explizit möchte diese ,,New
European History‘‘ nicht nur die Fachöffentlichkeit, sondern eine möglichst
breite Leserschaft erreichen.
Der Untertitel der Reihe – ,,Technology and Transformations 1850-2000‘‘ –
steckt den Zeitraum ab, der in den Blick genommen wird. Etwa Mitte des 19.
Jahrhunderts formierte sich ein Prozess beschleunigter Globalisierung, für den
neue Verkehrs- und Kommunikationsnetze eine zentrale Rolle spielten. Es geht
also um Veränderungen der materiellen Welt, die – so die Herausgeber – auch
über kriegerische und politische Zäsuren hinweg inter- und transnationale
Kooperation, Austausch, Wissenstransfer und Regelsetzungen ermöglichten
und erzwangen und damit auch einen wesentlichen Grundstein für die formalpolitische Integration Europas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts legten.
Diesen Entwicklungen gehen die sechs Bände der Reihe nach, wobei in der Regel
zwei Autoren/innen – nur in einem Fall sind es drei – jeweils unterschiedliche
Akteure und/oder technische Integrationsfelder aus einer explizit eben nicht
nationalstaatlichen Perspektive in den Blick nehmen. Auf diese Weise entstehen
unterschiedliche, sich ergänzende, aber durchaus auch partiell sich überlappende Narrative zum Einfluss von Technik, technisch-wissenschaftlicher
Experten und Organisationen auf die Herstellung Europas im ,,langen‘‘ 20.
Jahrhundert.
Zurück geht das Projekt auf das seit 1998 bestehende internationale
technikhistorische Forschungsnetzwerk ,,Tensions of Europe‘‘ (http://www.
tensionsofeurope.eu) sowie das eng mit diesem verknüpfte Inventing Europe
Programm, das seit 2007 von der European Science Foundation getragen wird.
Der Fokus lag dabei von Beginn an auf der Frage, welche Rolle Technik
respektive technische Artefakte und Systeme im Zusammenspiel mit zahlreichen individuellen, institutionellen und korporativen Akteuren wie
Ingenieuren und Architekten, Verkehrsplanern und Politikern, Konsumenten
und Nutzern, Vereinen und Kartellen für die Geschichte Europas spielten und
weiterhin spielen. Die einzelnen Bände der Making Europe-Reihe basieren
dabei nicht zuletzt auch auf anderen Veröffentlichungen, die aus diesen
Netzwerken hervorgegangen sind, und präsentieren in der Regel eher Synthesen des aktuellen Forschungsstands als unmittelbar quellengestützte
Forschung.
Bezüglich der Ausstattung der Reihe ist der Verlag sehr zu loben, denn die
großformatigen gebundenen Bände bereiten mit ihrem hochwertigen Papier
und den vielen ausführlich kommentierten Abbildungen auch ein ästhetisches
Vergnügen. Alle Bände werden über ein Personen- und Sachregister gut
erschlossen; es ist aber angesichts der mannigfachen, oft kryptischen Kürzel
für die Vielzahl der erwähnten Institutionen zu bedauern, dass nur der Band
von Kaiser und Schot mit einem Abkürzungsverzeichnis versehen ist.
214
�REZENSIONEN /REVIEWS
Im Folgenden sollen die drei zuerst erschienenen Bände der Reihe vorgestellt werden. Bereits 2013 erschien der von Ruth Oldenziel und Mikael
Hård verfasste erste Band, der gleich den Anspruch formuliert, ,,a new view of
history‘‘, eine Gegenerzählung zu etablierten (technik-)historischen Narrativen, schreiben zu wollen (6). Wie der Titel bereits verrät, nehmen die Autoren
Konsumenten, Bastler und Rebellen oder, anders ausgedrückt, die mitunter
eigensinnigen und aufsässigen Nutzer und Nutzerinnen neuer Technologien
als wichtige Akteure in den Blick. Sie fragen danach, wie diese sich Technologien aneigneten, in ihren Alltag integrierten oder gegebenenfalls diese
Integration auch mehr oder minder öffentlich verweigerten. Letztlich geht es
Oldenziel und Hård darum, in einer pan-europäischen Perspektive zu
erkunden, wie trotz anhaltender nationaler und regionaler Differenzen eine
neue und wesentlich von Technik bestimmte gemeinsame europäische (Alltags-)Kultur entstehen konnte.
Im zweiten Band der Reihe gehen Martin Kohlrausch und Helmuth
Trischler dem Einfluss technisch-wissenschaftlicher Experten auf die europäische Geschichte nach. Mit dem von ihnen im Buch gebrauchten Begriff der
,,technoscientific experts‘‘ wollen sie verdeutlichen, dass eine Trennung zwischen technischen und wissenschaftlichen Experten für das ,,lange‘‘ 20.
Jahrhundert keinen Sinn macht. In ihrer Darstellung begegnen uns akademisch und nicht-akademisch ausgebildete Ingenieure und Architekten ebenso
wie Stadtplaner und Naturwissenschaftler. Kohlrausch und Trischler schreiben dabei eine komplexe Geschichte der Wechselwirkungen zwischen
Nationalstaatsbildung und Aufstieg technisch-wissenschaftlicher Experten,
zwischen nationaler Instrumentalisierung von Experten und umgekehrter
Instrumentalisierung des Nationalismus durch diese. Es geht um Allianzen
und Auseinandersetzungen zwischen alten Eliten und neuen ,,Fachleuten‘‘, um
technokratische Phantasien und schließlich um die komplexen und widersprüchlichen Motive und Folgen transnationaler Expertenkooperation.
Beim dritten, ebenfalls 2014 erschienenen und hier zu besprechenden
Band handelt es sich um den offiziell vierten der Making Europe-Reihe.
Wolfram Kaiser und Johan Schott nehmen wiederum andere zentrale Akteure
des europäischen Integrationsprozesses in den Blick, nämlich inter- und
transnationale Organisationen technisch-wirtschaftlichen Charakters.
Gemeint sind damit in der Regel freiwillige, nicht staatliche aber durchaus
staatsnahe Vereinigungen, Vereine und auch Kartelle, in denen sich Experten
– die uns hier also wiederbegegnen – auf gemeinsame Regeln und Standards
einigten. Dieser Prozess der Regelsetzung, so Kaiser und Schott, reflektiert die
zunehmende wirtschaftliche und technisch-infrastrukturelle Vernetzung
Europas seit Mitte des 19. Jahrhunderts, war seinerseits aber auch Voraussetzung für eine weitergehende Integration. Die Autoren interessieren sich
insbesondere für die spezifische Kultur der Zusammenarbeit in diesen Organisationen, deren Arbeitsweise und das Selbstbild der kooperierenden
215
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
Experten. Zentral ist dabei einerseits der Anspruch der Akteure auf eine
explizit de-politisierte, rein sachlich-technische Entscheidungsfindung und
andererseits eine erst auf Basis dieser technokratischen Ideologie mögliche
Konsenskultur. Dass hier de facto hochpolitische Entscheidungen getroffen
wurden, dass es um Machtfragen und den Einfluss einzelner Experten ebenso
wie einzelner von ihnen vertretener Unternehmen und auch Staaten ging,
steht dabei außer Frage.
Damit nun aber zu den Bänden im Einzelnen. Um den Nutzern und
Nutzerinnen und deren Einfluss auf die Ausformung einer technisch
geprägten europäischen Alltagskultur näher zu kommen, beschäftigen sich
Oldenziel und Hård in Consumers, Tinkerers, Rebels mit ausgewählten Arenen
der Aneignung und Aushandlung, des Bastelns und Protestierens. Sie führen
den Leser in Modesalons und Eisenbahnabteile der Jahrhundertwende, auf
Straßen und Radwege, in Sozialwohnungen und Küchen der Zwischenkriegszeit, schließlich in die Räume von Computerclubs, in Kinderzimmer und
auf Wertstoffhöfe des späten 20. Jahrhunderts. Sie stellen dabei technische
Ensembles vor, die Kachelöfen, Küchenherde und städtische Versorgungsinfrastrukturen, Schlafwagen, Kursbücher und Auswandererhallen, Fahrräder
und Straßenverkehrsordnungen ebenso umfassen können wie Einmachgläser
und Supermarktregale oder Barbiepuppen, Heimcomputer und Programmiersprachen. Wirkungsmächtig wurden diese Ensembles dabei gerade in
ihrer Gesamtheit, was knapp mit Hilfe des ersten von Oldenziel und Hård
vorgestellten Beispiels exemplifiziert werden soll. Hier geht es nämlich um die
Etablierung einer paneuropäischen, ja, Nordamerika sowie Teile der kolonialen Welt umfassenden und dabei auf die Metropole Paris ausgerichteten
(Damen-)Modekultur im späten 19. Jahrhundert. Diese beruhte nicht zuletzt
auf einem technischen Ensemble, das unter anderem Modemagazine,
Schnittbögen und Nähmaschinen umfasste. In Kombination mit neuen Vertriebsformen – Stichwort Vertretersystem, Warenhaus und Versandhandel –
machte es dieses Ensemble möglich, dass sich eben nicht nur großbürgerliche
Damen beispielsweise in St. Petersburg, sondern auch modebewusste Hausangestellte in London die Pariser Modewelten aneignen konnten. Unter
Beteiligung eines komplexen Systems von Akteuren mit je spezifischen
Fähigkeiten – vom Pariser Designer bis zur Budapester Heimnäherin, von der
litauischen Handarbeitslehrerin bis zum finnischen Nähmaschinenvertreter –
wurde so eine über Europa hinaus reichende und mehr als nur die Oberschicht
erfassende gemeinsame Modekultur etabliert.
Ähnliche Zusammenhänge präsentieren Oldenziel und Hård mit Hilfe
weiterer Beispiele, wobei ihre Darstellung chronologisch in drei größere Teilen
organisiert ist, die durch zwei Epochenschwellen voneinander abgegrenzt
sind. Die erste dieser Epochenschwellen markiert der Erste Weltkrieg, die
zweite das Protestjahrzehnt der 1960er Jahre. Die erste Zäsur rechtfertigen die
Autoren damit, dass die europäischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg
216
�REZENSIONEN /REVIEWS
einen sehr viel aktiveren Einfluss auf die Ausgestaltung von Technologien und
technische Systemen zu nehmen begannen als zuvor. Nutzer und Nutzerinnen
mussten sich nun stärker mit staatlichen oder staatsnahen Akteuren, nicht
zuletzt auch hier wiederum mit (technischen) Experten auseinander setzen.
Als zweite Epochenschwelle zeichneten sich die 1960er Jahre neben
beschleunigter Entkolonialisierung und wachsender Bedeutung gesamteuropäischer Institutionen vor allem durch die an Einfluss gewinnenden neuen
Bürgerbewegungen und die damit einhergehende mindestens partiell erfolgreiche ,,Selbstermächtigung‘‘ von Nutzern respektive Konsumenten aus.
Neben dem bereits skizzierten Thema Mode werden für die Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg noch die Themen Wohnen sowie Reisen beziehungsweise
Migration vorgestellt. Bei letzterem geht es nicht zuletzt um die Eisenbahn als
geradezu prototypische Technologie der europäischen Integration, die hier
jedoch gleichzeitig auch als Technologie der sozialen Segregation und Ausgrenzung greifbar wird.
Für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg setzen die Autoren anhand von
drei Beispielen Schlaglichter auf die Auseinandersetzung zwischen dem Staat
und seinen Experten einerseits und Nutzern und Nutzerinnen andererseits.
Thematisiert werden dabei zunächst das Fahrrad, die ,,Proletarisierung‘‘ der
Radfahrkultur in der Zwischenkriegszeit sowie der ,,Kampf um die Straße‘‘ mit
Verkehrsexperten und bürgerlichen Automobilisten. Anschließend werden
am Beispiel der Industrialisierung der Ernährung Auseinandersetzungen
zwischen Industrie, Staat, (Ernährungs-)Experten und Konsumenten diskutiert, die sich nicht nur an der Frage der angemessenen Versorgung
entzündeten, sondern bei denen es auch um Kontrolle und Autonomie ging.
Das dritte Unterkapitel widmet sich Spannungen zwischen Staat, Experten
und Nutzern am Beispiel des (sozialen) Wohnungsbaus, wobei sehr
anschaulich verdeutlicht wird, wie stark sich mitunter reale Nutzer in
Bedürfnissen und Verhalten von den imaginierten Nutzern der Experten
unterschieden.
Im dritten und letzten Teil des Bandes wird schließlich am Beispiel des
Umgangs mit Ressourcen und Reststoffen, wiederum auch Mode – hier in
Form des Politikums Jeans im ,,Kalten Krieg‘‘ – sowie Computern und dem
Internet thematisiert, wie seit den 1960er Jahren eine veränderte Nutzerkultur
entstand. In dieser stiegen auf lokaler aber eben auch auf transnationaler
Ebene agierende Nutzer-Netzwerke und Protestbewegungen zu neuen
machtvollen Akteuren auf, die eine Veränderung staatlicher Technologiepolitik erzwingen und die bisherige Verbindlichkeit von Expertenwissen in
Frage stellen konnten.
Insgesamt gelingt es Oldenziel und Hård, ein bemerkenswert breites
Panorama der Sozial-, Kultur- und eben Technikgeschichte des 20. Jahrhunderts zu entwerfen. Zusammengehalten wird die Darstellung dabei einerseits
durch die recht konsequente Nutzerperspektive, wobei aber andere relevante
217
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
Akteure keinesfalls aus dem Blick geraten. Andererseits gerät das Ganze auch
darum so überzeugend und rund, weil sich die Autoren bei der Entfaltung der
verschiedenen Fallbeispiele nicht scharf an die selbst gesetzten Epochengrenzen halten, sondern mit chronologischen Überlappungen sowie Vor- und
Rückgriffen arbeiten und immer wieder Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kapiteln und Themen herstellen. Zu den Stärken des Buches gehört
dabei sicherlich auch, dass sich hier ganz unterschiedliche Debatten, Ansätze
und Themen der neueren Technikgeschichte wiederfinden. Die Nutzerperspektive korrespondiert dabei mit einem stark sozialkonstruktivistischen
Zugang, wobei selbstverständlich das Phänomen der Ko-Konstruktion durch
den Nutzer ebenso thematisiert wird wie etwa Genderaspekte, Social Engineering, konsumhistorische Zugänge sowie Aspekte der Mobilitäts-,
Produktions-, Umwelt- und Kommunikationsgeschichte.
Gerade angesichts dieses positiven Befundes kann aber der gleichsam
revolutionäre Gestus, mit dem die Autoren antreten, auch ein wenig nerven.
Liest man ihre Einleitung, so entsteht der Eindruck, sie hätten soeben als erste
entdeckt, dass Nutzer als Akteure relevant waren, dass Alltagstechnologien
untersuchenswert sind und dass Technologien unterschiedliche Bedeutungszuschreibungen erlauben. Oldenziel und Hård setzen sich hier von einer
traditionellen Technikgeschichte der bedeutenden Innovationen und großen
Männer ab, die so schon lange nicht mehr geschrieben wird. Eine zweite
kritische Anmerkung ist grundsätzlicher Natur: Am Ende des Bandes stellt
sich durchaus die Frage, wie spezifisch europäisch die technische Kultur
eigentlich ist, deren Entstehung Oldenziel und Hård porträtieren. Geht es
tatsächlich um Making Europe oder geht es um Alltagskultur, Nutzeridentitäten und ,,Making Technology‘‘ in den – sagen wir – ,,westlichen‘‘
Massenkonsumgesellschaften, die im ,,langen‘‘ 20. Jahrhundert entstanden?
Wird hier also tatsächlich eine Geschichte der europäischen Integration über
Nutzergemeinschaften erzählt, oder erweist sich die Kategorie ,,Europa‘‘ nicht
als vielfach ebenso konstruiert wie möglicherweise die Nutzergemeinschaften
selbst?
In Building Europe on Expertise nehmen Kohlrausch und Trischler die im
19. Jahrhundert entstehende neue Spezies technisch-wissenschaftlicher
Experten und deren Beitrag zur Herstellung des modernen Europa in den
Blick. Ihre zentrale These lautet, dass dabei Nationalismus und Transnationalismus eng miteinander verflochtene Phänomene waren. Der Nationalismus
der Experten und ihr transnationales Denken und Handeln kann ebenso wie
der weitere Aufstieg der europäischen Nationalstaaten und der gleichzeitige
Aufbau übernationaler Organisationen und Institutionen nur in Verbindung
miteinander und als gemeinsamer Prozess verstanden werden. Der Transnationalismus war dabei zunächst nicht eigentliches Ziel, sondern eher Ergebnis
gerade des kompetitiven Verhältnisses der Staaten untereinander sowie
schlicht Resultat ihrer technisch-infrastrukturellen Vernetzung. Partiell, so die
218
�REZENSIONEN /REVIEWS
Autoren, änderte sich dies erst in der bipolaren Welt des Kalten Krieges ab
Mitte des 20. Jahrhunderts, in der nun in (West-)Europa sehr bewusst auf
Kooperation gesetzt wurde. Unterhalb der Oberfläche der europäischen
Institutionen blieben freilich nationale Konkurrenz und nationale Egoismen
anhaltend relevant. Entscheidend für die funktionierende Kooperation der
Experten war dabei ihr Charakter als hidden integration, also eine gleichsam
für die breiteren (nationalen) Öffentlichkeiten verborgene, unsichtbare
Kooperation, auf deren Basis die Produktion und Zirkulation von Wissen mit
großer Selbstverständlichkeit erfolgten. Nicht von ungefähr wird uns dieses
Konzept der hidden integration im Band von Wolfram Kaiser und Johan Schot
zu den Organisationen der technisch-wirtschaftlichen Zusammenarbeit wieder begegnen.
Wie bereits bei Oldenziel und Hård, so ist auch bei Kohlrausch und
Trischler die Darstellung chronologisch in drei große Kapitel gegliedert, wobei
der zeitliche Zuschnitt anders aussieht. Der erste Teil widmet sich der Phase
von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu den frühen 1930er Jahren. Im Zentrum
der Untersuchung stehen dabei zunächst das ,,Erzeugen‘‘ technisch-wissenschaftlicher Experten in speziellen Ausbildungsanstalten sowie deren Kampf
um soziale Anerkennung und politische Mitsprache. Der Leser erfährt einiges
über die Geschichte der technischen Bildung in Europa, die verschiedenen
nationalen Modelle – insbesondere das französische, britische und deutsche –
und deren Rezeption und Modifikation in anderen Teilen des Kontinents.
Deutlich werden dabei einerseits der kompetitive Charakter dieser Entwicklung und andererseits ihre starke internationale Verwobenheit. Darüber
hinaus werden zentrale Eigenheiten der technisch-wissenschaftlichen Eliten in
ihrer ersten großen Expansionsphase verdeutlicht: ihre strategische, ökonomische und auch militärische Bedeutung für die (entstehenden)
Nationalstaaten, ihre enge Verbindung zu nationalstaatlicher Machtpolitik
sowie ihre starke Identifikation mit dem Nationalstaat. Auf der anderen Seite
funktionierte die nationale Aufladung der Technik und ihrer Repräsentanten
nur auf der Basis beständiger internationaler Vergleiche; Voraussetzung für
den nationalen Erfolg war dabei nicht zuletzt der internationale, vor allem
transeuropäische Wissens- und Technologietransfer. Verdeutlicht wird hier
das Spannungsverhältnis zwischen technischen Eliten als einerseits übernational einsetzbare unpolitische Fachleute und andererseits hochgradig
national aufgeladene Symbolfiguren. Schließlich wird im Zusammenhang mit
dem Aufstieg der technisch-wissenschaftlichen Elite auch der Aufstieg technokratischer Ideale thematisiert, die partielle Umsetzung dieser Ideale
insbesondere in der Phase des Ersten Weltkriegs und die zunehmend autoritären Tendenzen der Technokratiebewegung in der Zwischenkriegszeit.
Letzteres leitet zum zweiten Teil der Darstellung über, in dem es um die
Phase zwischen Ende des Ersten Weltkriegs und der Nachkriegszeit des
Zweiten Weltkriegs geht. Die Perspektive ist nun insofern eine etwas andere,
219
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
als in diesem Teil stärker einzelne Experten exemplarisch vorgestellt werden.
Die zentrale Frage lautet, wie die große Bereitschaft zahlreicher europäischer
Experten zu erklären ist, sich auf eine Art Teufelspakt mit den entstehenden
autoritären Regimen einzulassen und damit deren Aufstieg und deren Verbrechen erst möglich zu machen. Um einer Antwort auf diese Frage näher zu
kommen, wenden sich Kohlrausch und Trischler zunächst der frühen Zwischenkriegszeit zu. Es geht ihnen dabei um eine Auseinandersetzung mit der
Selbstermächtigung technisch-wissenschaftlicher Experten zu ,,Ingenieuren
des Sozialen‘‘, die mit dem Anspruch verbunden war, auch gravierende
gesellschaftliche Probleme mit Hilfe von Technik lösen zu können (139).
Exemplifiziert werden diese Tendenzen mit Hilfe gleichsam paradigmatischer
Akteure: Le Corbusier und der Congrès International d’Architecture Moderne, im Grunde erwartungsgemäß Tomáš Bat’a und der Bataismus sowie
natürlich Henry Ford und die Rezeption des Fordismus in Europa.
Kohlrausch und Trischler verdeutlichen, dass nicht wenige ,,Ingenieure
des Sozialen‘‘ demokratische Strukturen als hinderlich für die Umsetzung ihrer
weitreichenden Pläne zur Umgestaltung der Gesellschaft empfanden. Diktatorische Regime schienen dafür bessere Bedingungen zu bieten, und
umgekehrt hätten Terrorherrschaft, vor allem aber forcierte Aufrüstung,
Krieg und Vernichtungspolitik in den autoritären Regimen Europas nicht
ohne die willige Kollaboration der Experten umgesetzt werden können. Dieses
Verhältnis von wechselseitiger Abhängigkeit und Unterstützung thematisieren die Autoren für das ,,Dritte Reich‘‘ am Beispiel von Konrad Meyer als
einem der Vordenker der Vernichtung, für das faschistische Italien am Beispiel
von Guglielmo Marconi und für die stalinistische Sowjetunion schließlich am
Beispiel des Biologen und Agronomen Trofim Lyssenko.
Zum eigentlichen Thema ihres Buches kommen Kohlrausch und
Trischler am Ende dieses Teilabschnitts zurück, indem sie sich mit dem
bemerkenswerten Phänomen auseinander setzen, dass trotz der deutlich
zurückgehenden transnationalen Kooperation im ,,Zeitalter der Extreme‘‘ der
globale Wissenstransfer sogar beschleunigt wurde. Zurückzuführen war das
zunächst auf die Zwangsemigration technisch-wissenschaftlicher Experten
aus der Sowjetunion und insbesondere aus NS-Deutschland sowie nach
Kriegsende auf die mehr oder minder freiwillige Kooperation deutscher
Wissenschaftler und Techniker mit den Siegermächten, insbesondere natürlich mit den USA und der UdSSR. Obwohl nicht intendiert, entwickelte
sich dieser nahezu weltumspannende Wissenstransfer zu einem Motor nicht
nur der technik-wissenschaftlichen, sondern schließlich auch der politischen
Integration.
Der dritte und letzte Teil des Buches ist der Entwicklung im Europa der
Nachkriegszeit gewidmet, wobei sich die Perspektive erneut, nun stärker
institutionengeschichtlich ausgerichtet, verschiebt. Am Beispiel prägender
Institutionen der wissenschaftlich-technischen Kooperation, insbesondere der
220
�REZENSIONEN /REVIEWS
Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN), der Europäischen
Atomgemeinschaft (EURATOM) und der Europäischen Organisation zur
Zusammenarbeit in der Weltraumforschung (ESRO), diskutieren die Autoren
die Determinanten, Wege und Ziele technisch-wissenschaftlicher Integration
in (West-)Europa. In der Welt des Kalten Krieges schien die nun explizit
vorangetriebene Bündelung nationaler Ressourcen in transnationalen Programmen und Institutionen für die europäischen Staaten und ihre Experten
die einzige Chance zu bieten, der bedrohlichen technisch-wissenschaftlichen
Dominanz der Supermächte zu begegnen. Gerade für die Bundesrepublik und
deren angesichts ihrer NS-Vergangenheit häufig vorbelasteten Experten bot
die transnationale Forschungskooperation die Chance auf Wiederanerkennung und Reintegration. Auch für die Nachkriegsentwicklung machen
Kohlrausch und Trischler deutlich, dass transnationale Zusammenarbeit nach
wie vor auch rein nationalen Interessen dienen konnte, insofern als die
beteiligten europäischen Länder versuchten, auf der Basis der Kooperation die
eigene Position respektive die der nationalen Industrien auf den internationalen Märkten zu stärken. Dennoch, so die Autoren, war die Kooperation
technisch-wissenschaftlicher Experten in einer zunehmenden Zahl europäischer Institutionen ein zentrales Feld der europäischen Integration, teilte
allerdings gleichzeitig den Kontinent auch entlang der Grenzen des Kalten
Krieges. Auch auf der östlichen Seite des so genannten Eisernen Vorhangs
intensivierte sich seit den 1950er Jahren die technisch-wissenschaftliche
Zusammenarbeit, allerdings sehr viel stärker zu den Bedingungen und zum
Vorteil des dortigen Hegemons UdSSR.
Dieser dritte Teil schließt mit einem Kapitel, das die Geschichte und
Ergebnisse der Forschungsförderung durch EWG und EU noch einmal im
Überblick präsentiert. Schließlich fragen Kohlrausch und Trischler nach den
historischen Prozessen, die die heutige europäische Forschungskooperation
und Forschungslandschaft geprägt haben.
Insgesamt erzählen Kohlrausch und Trischler ihre Geschichte der Herstellung Europas durch technisch-wissenschaftliche Experten und deren
transnationale Kooperation durchaus als Erfolgsgeschichte, mindestens was
die Zeit seit 1945 anbelangt. Sie tun dies trotz des im 21. Jahrhundert
gescheiterten Lissabon-Prozesses und trotz eines in den vergangenen Jahren
eher schwindenden Glaubens an Wissenschaft und Technik als potente
Katalysatoren der Integration. Insofern schließen sie auch nachvollziehbar mit
einem gewissen Optimismus und mit der Feststellung, dass Experten in der
Tat eine treibende Kraft für die Integration Europas waren und dass Europa
eben auch auf deren Expertise gebaut wurde, gebaut wird und gebaut werden
wird.
Natürlich erzählen Kohlrausch und Trischler keine naive Erfolgsgeschichte. Deutlich dürfte geworden sein, dass sie ein sehr breites Panorama
entwickeln, manchmal sogar so breit, dass dem Leser nicht immer ganz klar
221
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
wird, wohin die Reise argumentativ gerade geht. Ganz sicher wird hier aber
nicht das Meisternarrativ eines auch nur im Ansatz geradlinigen, kontinuierlichen Integrationsprozesses geschrieben, sondern eine Geschichte von
Zweifeln und massiven Brüchen, von Partikularinteressen, von miteinander
verwobenen hehren und dunklen, altruistischen und höchst banal egoistischen
Motiven technisch-wissenschaftlicher Experten. Um auf die zentrale These
der Autoren zurückzukommen, so war es eben gerade die Kombination der
nationalen und transnationalen Interessen, der hehren und egoistischen
Motive, die dem Prozess seine Dynamik gab. Kohlrausch und Trischler
betonen, dass es sich bis heute um eine gleichsam heterogene Integration
handelt, dass in Europa multiple Muster regionaler Kooperation entstanden
sind, die mit multiplen Wissensgesellschaften und nach wie vor auch multiplen (nationalen) Innovationskulturen korrespondieren. Und nach wie vor
existieren die multiplen europäischen Wissensgesellschaften eben zwischen
den Polen nationaler Konkurrenz und transnationaler Kooperation.
Die Stärke des Bandes liegt in der überzeugenden Auswahl, Zusammenstellung und partiellen Neuinterpretation von durchaus Bekanntem unter
einer weitgehend konsequent verfolgten Fragestellung, genuin Neues bietet er
wenig. Die tatsächlichen Netzwerke der Kooperation, die Kooperationskultur
und die Kooperationsroutinen der technisch-wissenschaftlichen Eliten bleiben
allerdings bemerkenswert undeutlich, ein Preis, der angesichts der Breite des
vermittelten Überblicks über die Entwicklung verwobener nationaler und
transnationaler Expertenkulturen und deren Relevanz für die Herstellung
Europas wohl zu zahlen war.
Wolfram Kaiser und Johan Schot verfolgen in Writing the Rules for Europe
die Entstehung und Entwicklung inter- und transnationaler Organisationen
und fragen nach deren Beitrag zur Herstellung des modernen Europas. Sie tun
das zunächst in drei großen chronologischen Überblickskapiteln. Das erste
dieser Kapitel widmet sich der Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg, das
zweite der Zwischenkriegszeit und das dritte der Integration ,,Kerneuropas‘‘
vor allem bis zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Angesichts der Heterogenität und Komplexität des entstehenden Systems
internationaler Vereine und Vereinigungen liegt es im Grunde nahe, dass
Kaiser und Schott auch ihre Überblickskapitel letztlich exemplarisch anlegen.
Für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg steht die 1865 in Paris gegründete
,,Union Télégraphique Internationale‘‘ als stilbildende Vereinigung im Zentrum des Interesses, eine europäisch dominierte Vereinigung mit allerdings
globalem Anspruch. Für die Zwischenkriegszeit wird die weitere Entwicklung
der ,,International Machinery‘‘ (erstmals S. 7) auf der neuen Plattform des
Völkerbundes betrachtet, die selbst stark von der technokratisch-internationalistischen Arbeitsweise der im 19. Jahrhundert entstandenen
Organisationen sowie von der inter-alliierten Zusammenarbeit währen des
Ersten Weltkriegs geprägt war. Im dritten Kapitel folgen die Autoren dem
222
�REZENSIONEN /REVIEWS
Aufbau neuer Institutionen der internationalen Zusammenarbeit in Europa
nach 1945, wobei sie hier nicht eine einzelne Organisation auswählen, sondern
die Entwicklung und das Zusammenspiel mehrerer neuer Institutionen (darunter die Economic Commission for Europe, Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, Europäische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl, EWG und auch der COMECON) diskutieren und gleichzeitig die
anhaltenden Aktivitäten und den anhaltende Einfluss der existierenden
Organisationen thematisieren.
Auf die drei Überblickskapitel folgen insgesamt vier Kapitel, in denen
zwei zentrale Bereiche europäischer Zusammenarbeit und zunehmender
Integration detaillierter verfolgt werden, nämlich einerseits die Eisenbahn und
andererseits der Stahlsektor. Näher vorgestellt werden also zwei Branchen,
die nicht nur für die Industrialisierung Europas eine Schlüsselrolle spielten,
sondern eben auch für die Entwicklung des ,,Technokratischen Internationalismus‘‘ (,,technocratic internationalism‘‘, erstmals S. 7), der Kaiser
und Schot besonders interessiert. Sie exemplifizieren mit diesen beiden
Branchen unterschiedliche Entwicklungsstränge der europäischen Integration, insofern als es bei den Eisenbahnen primär um die Einigung auf
gemeinsame Standards ging, beim Stahl hingegen um Kartellbildung,
Marktabsprachen und die Aufteilung des Marktes.
Sowohl in den Überblicks- wie in den Vertiefungskapiteln bemühen sich
Kaiser und Schott darum, ihren letztlich institutionengeschichtlichen Ansatz
mit einem stärker biografischen zu verweben, insofern als sie eben nicht nur
der Entwicklung der Organisationen, sondern auch dem Einfluss zentraler
individueller Akteure nachgehen. Im Hintergrund steht dabei die These, dass
es nicht zuletzt diese Akteure und deren informelle persönlichen Netzwerke
waren, die den europäischen Integrationsprozess prägten und den konsensualen Arbeitsstil in den Institutionen ermöglichten. Näher analysiert und
präsentiert werden diese informellen Netzwerke allerdings nicht.
Im abschließenden achten Kapitel arbeiten Kaiser und Schott explizit ihre
in den vorangehenden Kapiteln bereits angelegte zentrale These aus, dass der
spezifische Charakter des europäischen Integrationsprozesses, der nach 1945
entstehenden europäischen Institutionen und insbesondere jener der Europäischen Union stark von den älteren Organisationen übernationaler
Zusammenarbeit und deren Kooperationskultur geprägt wurde und wird. Wie
bei Kohlrausch und Trischler ist das zentrale Konzept das der hidden integration, die bei Kaiser und Schot nun allerdings sehr viel deutlicher als
wichtiges Kennzeichen europäischer Integration greifbar wird. Eng mit den
unsichtbaren Integrationsinstanzen verwoben waren ihr stark technokratisches Selbstbild, ihre postulierte Politikferne und ihre fehlende oder
mindestens unzureichende demokratische Legitimation. Offensichtlich gilt
dies sowohl für die frühen Organisationen transnationaler Kooperation wie
auch für die nach 1945 entstehenden (west)europäischen Institutionen. Kaiser
223
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
und Schot betonen in diesem Zusammenhang die Kontinuitäten in der
europäischen Integrationsgeschichte, die über die großen Zäsuren des 20.
Jahrhunderts hinweg reichen. Sie dekonstruieren damit ausdrücklich den
Gründungsmythos der EU, dass es 1945 gleichsam eine ,,Stunde Null‘‘ gegeben
habe, in der europäische Integration vor allem von einsichtigen Politikern und
vor dem Hintergrund hehrer Motive neu erfunden worden sei. Erst mit der
sich seit den 1960er und 1970er Jahren wandelnden politischen Kultur in
Europa – und hier sind wir wieder bei der von Oldenziel und Hård postulierten
Epochenschwelle – geriet, so Kaiser und Schot, die bereits im 19. Jahrhundert
entstandene europäische Kooperationskultur der hidden integration in eine bis
heute nicht überwundene Legitimations- und Funktionskrise, die letztlich den
Abschied von zentralen Regeln des Technokratischen Internationalismus
einleitete.
Die besondere Stärke dieses vierten Bandes der Making Europe-Reihe liegt
darin, dass er sehr anschaulich die sich im 19. Jahrhundert formierende international machinery und deren langanhaltenden Einfluss auf den
europäischen Integrationsprozess verdeutlicht. Europa bleibt dabei freilich ein
Konstrukt mit unscharfen, fließenden Grenzen, ein Raum, dessen Ausdehnung davon bestimmt wurde, wer an der Technokratischen Internationale
mitwirkte, wer, möglicherweise auch ohne unmittelbar beteiligt zu sein, aus
politischen und ökonomischen Gründen Regelungen und Normen akzeptierte, um von der Integration zu profitieren. Deutlich wird auch, dass es schon
seit dem 19. Jahrhundert Akteure aus Frankreich und Deutschland waren, die
im Zentrum der porträtierten international machinery standen, und zwar über
drei Kriege hinweg und ungeachtet einer auch propagandistisch inszenierten
so genannten Erbfeindschaft. Trotzdem behalten die Autoren auch die zahlreichen anderen mehr oder minder peripheren Akteure im Blick,
thematisieren die Sonderrollen Großbritanniens und Russlands und vermeiden es dankenswerterweise auch für die Zeit nach 1945, ihren Blick
ausschließlich auf Westeuropa zu fokussieren.
Insgesamt handelt es sich auch bei diesem Band um ein eindrucksvoll breit
angelegtes Buch, dem es gelingt, eine weite Perspektive auf den Prozess der
europäischen Integration zu eröffnen. Er trägt damit zu einem besseren
Verständnis der Eigenheiten, aber eben auch der Schwächen und Defizite des
europäischen Integrationsprozesses bei.
Was den vorliegenden Band allerdings auch auszeichnet, ist sein eher
deskriptiver Charakter. Hier werden Geschichten von Organisationen und
Akteuren erzählt, die erst im zusammenfassenden Schlussteil in stärkerem
Maße analytisch verdichtet werden. Die von den individuellen und institutionellen Akteuren verfolgten diskursiven Strategien zur Etablierung,
Durchsetzung und Rechtfertigung ihres Vertretungs- und letztlich
224
�REZENSIONEN /REVIEWS
Machtanspruchs bleiben undeutlich. Die Modifikationen respektive Deformationen der Kooperationskultur und deren Funktion für und in den
europäischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts spielen eine relativ geringe
Rolle, wobei zugestanden sei, dass Kaiser und Schot eben ausdrücklich die
Kontinuitätslinien in den Mittelpunkt stellen wollen. Außerdem muss in
diesem Zusammenhang natürlich auf den oben vorgestellten Band von
Kohlrausch und Trischler verwiesen werden, in dem sich die beiden ja in einer
Kaiser und Schot ergänzenden Perspektive mit technisch-wissenschaftlichen
Experten und deren Rolle für den europäischen Integrationsprozess auseinander setzen.
Mit dieser letzten Bemerkung komme ich noch einmal auf den eingangs
thematisierten Charakter der Reihe zurück: Die drei hier besprochenen Bände
verdeutlichen sicherlich das Gesamtkonzept, insofern als sie einen je spezifischen, aber sich partiell eben auch überlappenden und gegenseitig
ergänzenden Blickwinkel auf den Prozess des Making Europe eröffnen. Die
einzelnen Bände funktionieren dabei auch jeder für sich, erzählen aber vor
allem in ihrer Kombination eine multiperspektivische Geschichte der europäischen Integration seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Angesichts des
Hauptnarrativs der Serie, nämlich der wesentlich durch neue Technologien als
Aktanten bestimmten Herstellung transnationaler Beziehungen in Europa,
kann es kaum verwundern, dass uns zwar eine Vielzahl relevanter Akteure
begegnen, mindestens in den drei hier vorgestellten Bänden aber vor allem
technisch-wissenschaftliche Experten eine zentrale Rolle spielen (durchaus
auch im ersten Band zu den Nutzern und Nutzerinnen).
Das Verhältnis zwischen struktur- und akteursorientierter Erzählweise
wird in keinem der Bände explizit thematisiert, sondern bleibt in den
gewählten Erzählweisen implizit. Letztlich gelangen Kaiser und Schot sowie
Kohlrausch und Trischler aus entgegengesetzten Richtungen kommend zum
gleichen Spannungsfeld: Ersteren geht es eigentlich um die Organisationen
und deren Entwicklung und prägende Kraft, was aber ohne die Individuen und
deren Netzwerke nicht zu verstehen ist; letzteren geht es eher um die individuellen Experten, aber da stellt sich dann die Frage, in welchen Institutionen
diese produziert werden und in welchen sie agieren. Dass dies kaum explizit
reflektiert wird, weder für Einzelbände noch für die Reihe insgesamt, mag auch
mit dem Anspruch zusammenhängen, für eine breite Leserschaft zu schreiben.
Für ein zusammenfassendes Fazit ist es auf der Basis von dreien der
geplanten sechs Bände sicher noch zu früh. Dass das Gesamtkonzept der Serie,
nämlich die Geschichte der europäischen Integration als das Ergebnis einer
wesentlich materiell bestimmten Realität zu interpretieren und in einer
Kombination von im engeren Sinne technikhistorischen mit politik-, wirtschafts-, sozial- und kulturhistorischen Ansätzen zu präsentieren,
225
.
REZENSIONEN /REVIEWS
�REZENSIONEN /REVIEWS
funktioniert, und zwar sehr gewinnbringend funktioniert, zeigen aber schon
die hier vorgestellten Bände. Selbstverständlich ist dabei auch die Making
Europe-Serie selbst eine Manifestation des (west)europäischen Integrationsprozesses sowie das Ergebnis europäischer Forschungsförderung. Die Autoren
sind also selbst transnational kooperierende Experten in einem Europa in the
making. Dieser Manifestation europäischer Integration ist die breite Leserschaft zu wünschen, die sie erreichen möchte.
Reinhold Bauer, Stuttgart
226
�
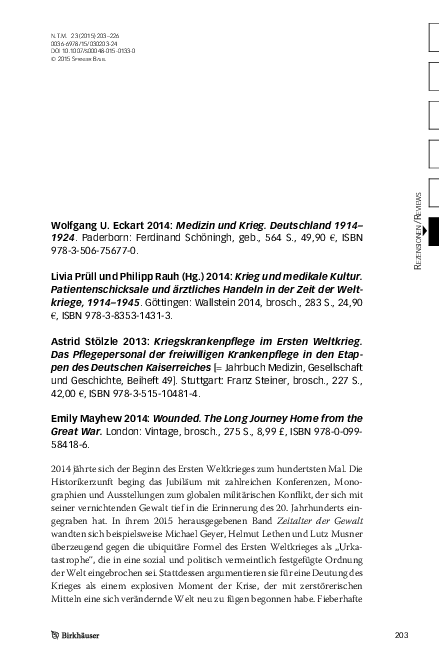
 Silvia Berger Ziauddin
Silvia Berger Ziauddin