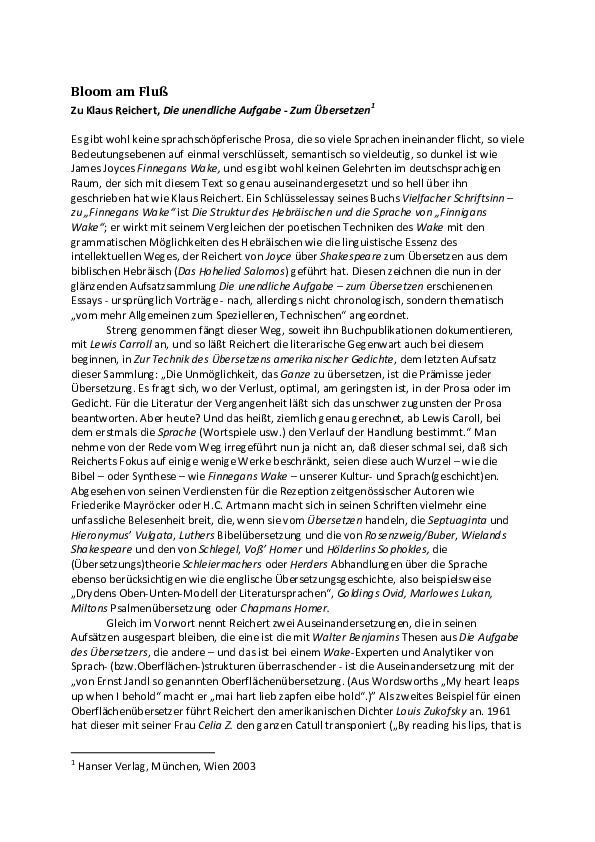Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Bloom am Fluß
Bloom am Fluß
2004, In: Walter Famler (Hrsg.), Wespennest, Nr. 134, Wien
Zu Klaus Reichert, Die unendliche Aufgabe - Zum Übersetzen
Related Papers
Namenkundliche Informationen
Flurnamen im WandelFlurnamen benennen Flächen, die nicht dauerhaft bewohnt, aber häufig durch den Menschen kultiviert und landwirtschaftlich genutzt sind. Die in diesen Namen erschließbaren Namenmotive verweisen unter anderem auf frühere oder aktuelle landschaftliche Beschaffenheiten, Grundstücksbesitzer und -besitzerinnen, landwirtschaftliche Nutz- und Abgabeformen, lokale Ereignisse oder Tier- sowie Pflanzenvorkommen. Jacob Grimm – und in der Folge eine Vielzahl von im Besonderen philologisch orientierten Namenforscher und Namenforscherinnen – hielten Flurnamen und hier vor allem ländliche Flurnamen für einen Forschungsgegenstand, in dem viele «spuren des höchsten alterthums» (Grimm 1840: 136) erschlossen werden könnten und marginalisierten Flurnamen, die im städtischen Kontext vorkommen, wenn sie diesen dieses sprachgeschichtliche Potential nicht gar schlichtweg absprachen.
Ein guter Mensch zu sein, das steht selten auf der Agenda des Alltags. Es soll Zeitgenossen gegeben haben und geben, die sich das vorgenommen haben. Das vorige Jahrhundert hat mit dem Porträt eines solchen begonnen, zusammengefasst in einer literarischen Nahaufnahme eines Tages. „Ulysses“ von James Joyce unter diesen Auspizien gelesen, zeigt die Schwierigkeiten, mit denen das Gute, Wahre und Schöne zu kämpfen hat. Ein Spurenelement im Universum des Bloom, aber immerhin vorhanden. Bisher wenig Beachtung fand jedoch die Tatsache, dass der Inseratenaquisateur Leopold Bloom Freimaurer gewesen sein soll. Eigentlich alles ganz klar, denn zwischen dem Pub Davy Byene’s in der Duke Street, wo Bloom einen Burgunder und ein Gogonzolabrot bestellt und der Public Library, wo er über Hamlet diskutiert befindet sich immerhin die Großloge von Irland, in einem imposanten Gebäude. Und wer würde sich besser eignen, um das Jahrhundert zu beginnen als Bloom, der alle in einer Person ist und noch viel mehr. Getaufter Jude, Katholik und Protestant und eben Freimaurer. In Zeiten einer Revitalisierung von Religion tut der Blick in die Vergangenheit gut, denn Joyce rückt der Religion schon zu Leibe. Kein Wunder also, dass das Werk wegen seiner Offenheit in den USA verboten war und Exemplare in den zwanziger Jahren sofort verbrannt wurden.
2017 •
Deutsch and English (intaktes PDF: https://drive.google.com/file/d/1zssfD23Ekm52fDh8x4FPlva5g6S_Kpdm/view ) Unausgesprochen, weil Gegenstand aller Werke des Autors, blieb in der ersten Auflage dieser Schrift, dass er die Psychoanalyse dort fortsetzte, wo Freud selbst nicht mehr weiterkam: die erforderlichen Forschungsgebiete waren bis zu seinem Tode nicht genügend weit gediehen… Die Erkenntnis, dass die Familie restlos allen ihr ausgelieferten Kindern zum Herd sinnlosen Leidens wird (von der Kirche zurückgeführt auf die Verfluchung der erbsündig gewordenen ersten Menschen), hatte Freud zu einem wissenschaftlichen Lösungsversuch dieser religiös verrätselten Tragik inspiriert: Er nahm an, dass die Familie künstlichen Ursprungs sein müsse, Ergebnis eines gut gemeinten Eingriffs der psychisch gesunden Urkulturen. Die natureigene Lebensform des Homo sapiens bezeichnete Freud als Darwin’sche Urhorde. Das ihr zugeschriebene Beziehungsgefüge schien sich zu bewähren. Nicht nur unterschied es sich durch seine weit umfangreichere Mitgliederzahl von der monogamen Familie, auch Phänomene wie den Schwund der bewussten Einzelpersönlichkeit in der Masse und deren Verlangen nach einem überstarken „Führer“ schien es zwanglos zu erklären. Letztlich aber stellte sich das von Freud angenommene Urzusammenleben als eine Vorstellung heraus, die unvereinbar ist mit den Befunden der modernen primaten- und humanethologischen Forschung… Heute ist die Psychoanalyse im Besitz eines entsprechend abgewandelten Modells der Urhorde – sehr viel anders, als Freud zu erahnen vermochte, so erweist sich seine These zur Einführung der Monogamie als eome geniale, intuitive Offenbarung. Diese Daseinsform ist doch ein Missgeschick des Urmenschen, jene ‚Sünde‘ wider die Natur, die zu seinem Untergang und zur Entstehung unserer naturfeindlichen Gesellschaft führte, zum „Bösen“ auf Erden… .............................. Unapproached, because the subject of all the author's works, it remained in the first edition of this work that he continued psychoanalysis where Freud himself could no longer progress: the necessary fields of research had not progressed far enough until his death... The realization that the family completely became the focus of senseless suffering for all the children delivered to it (attributed by the Church to the curse of the first human beings who had become original sinners) had inspired Freud to attempt a scientific solution to this religiously enigmatic tragedy: He assumed that the family had to be of artificial origin, the result of a well-intentioned intervention of psychologically healthy primeval cultures. Freud described the natural way of life of Homo sapiens as Darwinian primordial hordes. The relationship structure attributed to her seemed to prove itself. Not only did it differ from the monogamous family in its much larger membership, but phenomena such as the loss of the conscious individual personality in the masses and their desire for an overpowering "leader" seemed to explain it casually. Ultimately, however, Freud's assumption of primeval coexistence turned out to be an idea that was incompatible with the findings of modern primate and human ethology research... Today psychoanalysis is in possession of a correspondingly modified model of the primordial horde - very much different from what Freud was able to guess, so his thesis on the introduction of monogamy proves to be an eome of ingenious, intuitive revelation. This form of existence is a misfortune of primitive man, that 'sin' against nature that led to his demise and to the emergence of our nature-hostile society, to "evil" on earth...
P. Attinger, Fluch über Akkade, in B. Janowski D. Schwemer (ed.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge, Band 9. Texte zur Wissenkultur (2020) 41-54 .
Fluch über Akkade2020 •
Gegenstand des Mythos sind der Aufstieg (Z. 1-52) und der Fall (Z. 53-280) Akkades, der Hauptstadt des von Sargon gegründeten Reiches. Hauptfigur ist der Gott Enlil, dessen Entscheidungen die Welt lenken.
BLATT 3000, 8 (2), 2017
FLUCHT NACH VORNE2017 •
Discussing music initiatives and musicological research in the field of refugee studies shows that cultural studies still need to improve their work on current forced migration. From a musicological point of view, the essay outlines chances of music oriented migration studies for science, cultural agents, and society in Germany.
ABECEDARIUM. Erzählte Dinge im Mittelalter
Napf (Konrad Fleck: Flore und Blanscheflur)2019 •
ISBN eBook (PDF) 978-3-7574-xxxx-x Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt.
2018 •
Einige Passionsblumen sind beliebte kletternde Zierpflanzen. Passiflora incarnata ist zudem Arzneipflanze des Jahres 2011. Auffällig sind ihre bizarren Blüten, die die Passion Christi symbolisieren sollen. Biologie, Morphologie, Symbolik und Verwendung der Passionsblumen werden nachfolgend vorgestellt.
RELATED PAPERS
Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 79
Le "Couronnement de Marie d'Oignies", un tableau perdu de Gaspar de Crayer (1642) commenté par Daniel Papebroch2023 •
Philippine Population Review
A development concept of adolescence: the case of adolescents in the Philippines2004 •
Current Opinion in Environmental Science & Health
Beyond opposition and acceptance: examining public perceptions of the environmental and health impacts of unconventional oil and gas extraction2018 •
International journal of higher education and sustainability
Study from Home: Modelling the Factors Facilitating Online Education During and Post Covid-192023 •
DergiPark (Istanbul University)
UYGURCA ALTUN YARUK (BELGELER) Kaya, Ceval (2023). Uygurca Altun Yaruk (Belgeler). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 842 s. ISBN: 978-975-17-5510-02023 •
Journal of Veterinary Medicine and Animal Health
Isolation time of brooding chicks play an important role in the control of Marek's diseaseRevista Española de Cardiología
Impacto pronóstico de una estrategia invasiva en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST según la presencia o no de disfunción sistólica2010 •
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
A study on the statistical modeling of fading and its effects on system performance using SIRP and SDP methods2014 •
Brazilian Journal of Microbiology
Use of RAPD, enzyme activity staining, and colony size to differentiate phytopathogenic Fuzarium Oxysporum isolates from Iran2002 •
International Journal of Automotive Engineering and Technologies
An application for the selection of steel sheet materials used in automotive construction with the MOORA methodRELATED TOPICS
- Find new research papers in:
- Physics
- Chemistry
- Biology
- Health Sciences
- Ecology
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science