Lisa Riedner
Arbeit! Wohnen!
Urbane Auseinandersetzungen
um EU-Migration
Eine Untersuchung zwischen
Wissenschaft und
Aktivismus
edition
assemblage
��Arbeit! Wohnen!
Urbane Auseinandersetzungen um EU-Migration
Eine Untersuchung zwischen Wissenschaft und Aktivismus
von Lisa Riedner
Ebook - PDF-Ausgabe, 2019
www.edition-assemblage.de
Copyright © 2018 edition assemblage
ISBN 978-3-96042-039-2 (Print Ausgabe)
Lektorat: Desz Debreceni (Edition Assemblage)
Satz & Cover: Alma (Edition Assemblage)
Gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung und die Graduiertenschule für Geisteswissenschaften Göttingen (GSGG)
��Inhalt
Danksagung
1
Einleitung
3
Der ‚Tagelöhnermarkt‘ zwischen Ausbeutung, Rassismus
und Widerstand
‚Tagelöhnermarkt‘ als Einheit?
‚Tagelöhnermarkt‘ als Außen?
‚Tagelöhnermarkt‘ als rassistische Figur
‚Tagelöhnermarkt‘ in der Arbeitsgesellschaft
Tagelöhnermarkt als Teil globaler Ausbeutungs- und
Klassenverhältnisse
Selbstorganisierter Arbeitsmarkt als widerständiger
Raum und Ausbeutungstechnologie zugleich
Selbstorganisierter Arbeitsmarkt als intersektionelle
und überdeterminierte Formation
Die relationale Autonomie von Migration und
Arbeiter*innen
Die Frage nach dem Regieren
Fragestellung und Ausblick auf die Kapitel
Konflikt als Methode –
Ein Ansatz zwischen Wissenschaft und Aktivismus
Ethnographic research revisited
Regime als ontologisches Konzept
Die ethnografische Regimeanalyse
Perspektive der Kämpfe und Konflikt als Methode
Verhältnis Wissenschaft und Aktivismus?
Justice for Janitors? Unwahrnehmbare und
sichtbarwerdende Kämpfe gegen Prekarisierung,
Ausbeutung und Migrationskontrolle
Vor dem Arbeitsgericht
3
6
10
12
18
20
28
31
35
37
41
47
47
51
55
57
65
73
73
Die Verhandlung
74
Fragestellung
76
Rassistische Anrufungen vor Gericht
78
Representational und Imperceptible Politics
80
�Mehr arbeiten für weniger Lohn?!
Migrantische Arbeit im Reinigungsgewerbe
85
Ausbeutung und Überausbeutung
90
Prekarisierung als Technologie des Regierens und Quelle
von Widerstand
92
Transnationale Migrationsprojekte
Entfliehen und Fordern
Kampf um Deutung – Der ‚Tagelöhnermarkt‘
zwischen Ärger, Endstation und Sprungbrett
„Was, in München?!“
Endstation, Sprungbrett oder Ärger?
Der Kampf um die Deutung der Figur ‚Tagelöhnermarkt‘
Intersektionale Assemblagen des Rassismus
97
101
103
103
105
120
Kolonial bis postliberal – Artikulationen des Rassismus
121
Stuart Halls Repräsentationsregimeanalyse als Werkzeugkasten
125
‚Schwarzarbeiter‘, ‚Ungeziefer‘, ‚Freiwild‘ –
Eine Assemblage des Rassismus
Die Behörden lassen uns alleine! Produktive Moralpaniken
127
139
Markieren, Vertreiben und Aufklären –
Sicherheitspraktiken am selbstorganisierten
Arbeitsmarkt
Grüne Bänder: Zollkontrolle als Effekt der Moralpanik
143
145
Grüne Bänder als Zwang und Markierung
147
Aufklären, Vertreiben oder Eindämmen?
148
Alltägliche Begegnungen mit Sicherheitspraktiken am
selbstorganisierten Arbeitsmarkt
Perspektiven aus den Sicherheitsbehörden
154
161
„Wenn der normale Fußgänger auf der Straße ausweichen muss...“ –
Das Problem aus Sicht einer Polizeistreife
161
„Passanten wandten sich angewidert ab“ – Problembeschreibung
eines Bußgeldbescheids
166
„München wird bunter und lebendiger, aber auch lauter“ –
Armutszuwanderung als Schwerpunkt städtischer Sicherheitspolitik
168
Wider die Repressionshypothese
171
�Obdachlosenpolitik und Grenzziehungen
städtischer Bürgerschaft
Umkämpfte Stadtbürgerschaft
175
175
Konflikt um Wohnraum I – Ein ‚Härtefall’
180
Street-level Bureaucracy
184
Jalla Wohnungsamt! Eine Genealogie der Münchner
Obdachlosenpolitik gegenüber Migrant*innen
186
Institutionen der Münchner Obdachlosenpolitik
186
Politische Paradigmen
189
Paradigmenwechsel „Wohnen statt Unterbringen“ –
from welfare to workfare?
192
Entdeckung und Definition des Problems
197
Anfrage 2006: Einrichtung eines Sondertopfes
197
Anfrage Untersbergstraße 2009/2010: ‚Münchner Problemhaus‘?
200
Podiumsdiskussion: „Was unter den Nägeln brennt...“
202
Runder Tisch bei ver.di: „Da sträuben sich sämtliche Haare!“
204
Konflikt um Wohnraum II: „Jalla Wohnungsamt!“
206
Runder Tisch Hilfebedürftige Zuwanderer*innen
207
Der Amtsleiter: „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“
209
Erneute Krise des Unterbringungssystems wird ausgerufen
213
Versuche der Problemlösung, Entwicklung
neuer Instrumente
214
Dienstanweisung Meldefrist 6 Monate
214
„Beratung, da müssen wir mehr tun“
216
Thesenpapier gegen ‚Anreize zum Verbleib‘
220
Weitere Dienstanweisungen
221
Konflikt um Wohnraum III: Zugang unmöglich
223
Gesamtplan Wohnen statt Unterbringen 2012: Ausschluss als Schutz 225
Eine Frage der Kälte: Kälteschutz als humanitaristisches
Ausweichmanöver
228
Runder Tisch Armutszuwanderung: Verfestigungstendenzen
vermeiden
231
Konflikt um Wohnraum IV: Kundgebung gegen Null-Grad-Regelung
235
Multiple Grenzziehungen
Nachtrag
Soziale Union oder nationale Souveränität des
Sozialstaats? Aushandlungen am EuGH
238
240
243
�Neues Terrain
Rechtlicher Rahmen in the making
Soziale Union vs. nationale Wohlfahrtssouveränität:
Strategien am EuGH
Sala 1998, Grzelczyk 2001 und Baumbast 2002:
Unionsbürger*innen diskriminieren verboten?
243
246
249
251
Änderung des Sekundärrechts: die Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG 254
Tas/Tas-Hagen 2006 & Morgan/Bucher 2007: Freizügigkeit
als Grundfreiheit?
257
Verhältnismäßig freizügig – Seilziehen vor Gericht
258
D’Hoop 2002 & Collins 2004: Bezug zum Arbeitsmarkt
260
Trojani 2004: Solidarität für „arme Schlucker“
261
Bidar 2005 und Förster 2008: Aufenthaltskriterium
262
Hartz IV für nichterwerbstätige Unionsbürger*innen?!
265
Vatsouras/Koupatantze 2009: Wider die deutsche Ausschlussklausel 265
Änderung des Sekundärrechts: Verordnung zur Koordinierung der Systeme
der sozialen Sicherheit
268
Dano 2014 und Alimanovic 2015: Migrationskontrolle
statt soziale Union
270
Resümée: Der kurze Sommer der Sozialunion. Oder: Wie die Nation vor ‚Sozialtourismus‘ geschützt wurde
276
Nachtrag: Die Grenzen der Freizügigkeit und der
selbstorganisierte Arbeitsmarkt in München
Workfare verschärft - Zwischen Aktivierung und
Ausschluss
Der soziale Frieden ist bedroht – Vom Städtetagspapier
zur Verschärfung des Freizügigkeitsgesetzes
Die Münchner Ausländerbehörde als Aktivierungsinstanz
Das Münchner Jobcenter als Grenzbehörde
279
281
281
289
296
Perspektiven aus dem Jobcenter München
299
Hartz IV beantragen
301
Sozialhilfemissbrauch bekämpfen
305
Über Aktivierung und Ausschluss hinaus
309
„What sort of crisis is this?“
313
Literaturverzeichnis
323
�Danksagung
Dieses Buch ist durch unzählige Menschen, Situationen und Begegnungen geprägt. Es ist unmöglich, alle Personen zu nennen, die
Anteil an der Entstehung dieser Arbeit hatten, aber wenigstens einigen möchte ich meinen persönlichen Dank aussprechen.
Zu allererst möchte ich den Menschen danken, mit denen ich im
Workers’ Center der Initiative Zivilcourage zusammen gearbeitet,
gekämpft und Zeit verbracht habe – von niemandem habe ich mehr
gelernt. Hier seien stellvertretend Ahmed M., Anton C., Birgit R.,
Christian B., Hristo V., Isabel G., Jonathan D., Julia E., Julia S., Meike T., Nadka E., Nina R., Oğuz L., Pembe A., Raia A., Savas T., Vasvie Y. und Vildan S. genannt – teşekkür, mersi, благодаря!
Die Netzwerke e4a, MigrAr und transnational social strike haben
mir gemeinsame, translokale Perspektiven eröffnet und den Mut
nicht verlieren lassen. Weiterer Dank gilt den Mitgliedern des
Netzwerks für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung (kritnet), des gleichnamigen Labors in Göttingen und der Redaktion der
Zeitschrift movements: Ihr habt mir die Gewissheit gegeben, nicht
vereinzelt, sondern Teil eines interventionsfähigen Projektes zur
Kritik von Migrations- und Grenzregimen zu sein.
Besonderer Dank gilt Prof. Dr. Nina Glick Schiller und Dr. Stef Jansen vom Department for Social Anthropology der University of Manchester, die mir geholfen haben, die Vorläufer meines Promotionsprojektes auf die Beine zu stellen.
In allen Phasen dieses Prozesses wusste ich Christian Beck, Esther
Joas, Sarah Reinhard, Renate Riedner, Pauline Wagner, Julie Weissmann, meine Eltern und meinen Bruder an meiner Seite – danke!
Des weiteren danke ich den Wohngemeinschaften, die so geduldig
und unterstützend waren – insbesondere den Mitbewohner*innen
in Plan B und der Rumford-WG. Katharina Wolke danke ich für ihren Garten, in dem ich so produktiv arbeiten konnte, wie nirgends
sonst.
Eine ganze Reihe von Freund*innen und Kolleg*innen hat Vorarbeiten und Teile dieses Buches gelesen, korrigiert und/oder diskutiert: Mein herzlicher Dank gilt Raia Apostolova, Christian Beck,
Isabel Dean, Esther Joas, Jenny Künkel, Olga Reznikova, Renate
1
�Riedner, Gabriele Riedner, Sarah Reinhard, Katharina Ruhland, Jonathan Schmidt-Dominé, Maria Schwertl, Veit Schwab und Pauline Wagner.
Ein Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung hat die materielle Grundlage
für diese Arbeit gelegt – vielen Dank an alle Beteiligten. Für Zuschüsse zu den Druckkosten danke ich derselben Stiftung sowie der Graduiertenschule für Geisteswissenschaften Göttingen (GSGG). Für die gemeinsame Arbeit an der vorliegenden Publikation danke ich der edition
assemblage und für das Endlektorat Desz Debreceni. Besonderer Dank
auch an Petja Dimitrova für die ausdrucksstarke Zeichnung des Covers,
die auf einem Foto beruht, dass Trixi Eder bei der Demonstration des
DGB zum 1. Mai 2010 in München geschossen hat.
Last but not least gilt mein Dank den Betreuer*innen der Dissertation,
die diesem Buch zugrunde liegt. Prof. Dr. Moritz Eges treffsichere Kommentare haben mir geholfen, meine Argumente zu schärfen. Keine andere hat mich auf meinen Pfaden durch die Landschaften und Dickichte
der Migrations- und Grenzregimeforschung so sehr beeinflusst und motiviert wie Prof. Dr. Sabine Hess – danke.
2
�Einleitung
Der ‚Tagelöhnermarkt‘ zwischen Ausbeutung, Rassismus und Widerstand
Als ich mit einem Rucksack voll mehrsprachiger Flugblätter zu Arbeitsrechten an der Straßenkreuzung im Münchner Bahnhofsviertel ankam,
verweilten schon etwa zehn mir unbekannte Personen auf dem Gehsteig. Sie wirkten unbeteiligt und schienen auf etwas zu warten. Ich
setzte mich auf den Bordstein und wartete auf die Personen, mit denen
ich mich verabredet hatte, um an diesem Vormittag im März 2010 einen
Infotisch aufzustellen. Nach einigen Minuten und abschätzenden Blikken wechselten einige der Wartenden die Straßenseite. Wer waren diese
Leute, wieso hielten sie sich hier auf? Wir beäugten uns gegenseitig, bis
ich einem der Wartenden die Flugblätter anbot – er nahm ein türkischsprachiges – und etwas unbeholfen fragte: „Nasılsın?“ – „Wie geht’s?“
Weil wir keine gemeinsame Sprache hatten, hörte das Gespräch hier
auch schon auf.
Schließlich kamen die Erwarteten und brachten alles mit, was wir
brauchten, um den Infotisch aufzubauen: einen Tapeziertisch, weitere
Flugblätter und kopierte Zeitungsartikel über Werkvertragsarbeiter aus
der Türkei, die in München gegen ihre Arbeitgeber vor Gericht gegangen waren, weil diese sie um ihren Lohn betrogen hatten. Wir wollten
Flugblätter verteilen, mit Passant*innen sprechen, türkischsprachige migrantische Arbeiter*innen über ihre Rechte informieren und ihnen Unterstützung anbieten. Wir, das waren fünf Personen, die bei der Initiative
Zivilcourage aktiv waren. Die Initiative war eine Gruppe von Personen,
die sich etwa zwei Jahre zuvor im Zusammenhang mit der Unterstützung von den genannten Werkvertragsarbeitern kennengelernt hatten.
Ich selbst hatte im Rahmen des Ausstellungsprojekts Crossing Munich zu
dem Unterstützer*innenkreis gefunden und eine Forschung zusammen
mit Philipp Zehmisch zur Aushandlung transnationaler Realitäten der
Werkvertragsarbeit in München und Istanbul durchgeführt (Riedner,
Weinzierl & Zehmisch, 2009; Riedner & Zehmisch, 2009). Danach hatte ich beschlossen, sowohl weiter in diesen Zusammenhängen aktiv zu
bleiben, wie auch meine Promotionsforschung hier anzusiedeln. Eine
3
�Handvoll Personen war mit dabei: Zwei Aktivisten, die in den 80ern aus
der Türkei nach Deutschland gekommen waren, zwei weiße1 deutsche
Erwerbslose, die sich gegen Ungerechtigkeit engagieren wollten, und
drei weiße deutsche Studierende, die wie ich zu diesen Arbeitskämpfen
mehr oder weniger zufällig hinzugestoßen waren. In den nächsten Jahren sollten sich immer wieder neue Personen der Gruppe anschließen,
während andere sich nicht mehr beteiligten.
Nachdem es Anfang 2010 kaum noch etwas zur Unterstützung der 47
Werkvertragsarbeiter zu tun gab, hatten wir uns entschieden, einen
Infostand im Münchner Bahnhofsviertel aufzustellen, um weiteren um
ihren Lohn betrogenen Arbeiter*innen unsere Unterstützung anzubieten. Im Münchner Bahnhofsviertel werden viele Geschäfte von türkisch- oder arabischsprachigen Personen betrieben und hier befinden
sich auch mehrere Moscheen (Özkan, 2015). Wir wählten einen Freitag
Vormittag, weil zu diesem Zeitpunkt viele Menschen die Moscheen besuchen oder einkaufen gehen und das Viertel sehr belebt ist.
Noch bevor alles aufgebaut war, kamen mein türkischsprachiger Kollege, die Wartenden und ich ins Gespräch. Sie stünden hier, weil sie
Arbeit suchten. Arbeitgeber*innen kämen hier vorbei, um ihnen einen
Job anzubieten und sie meist auch gleich mitzunehmen. Sie kämen aus
Bulgarien und könnten seit dem EU-Beitritt 2007 jederzeit legal nach
Deutschland kommen und sich hier aufhalten. Um dokumentiert arbeiten zu können, müssten sie aber erst eine Arbeitsgenehmigung beantragen oder mit Gewerbeschein arbeiten. Sie berichteten von ihren
Erfahrungen und ihrem Ärger mit Lohnbetrug, vorenthaltenem Wohnraum und Obdachlosigkeit, von Arbeitslosigkeit, Armut und Perspektivlosigkeit in ihrem Herkunftsort Pazarjik, leeren Versprechungen von
Seiten der EU und alltäglichen Polizeikontrollen. Sebahattin Angelov2
1
Ich setze den Begriff ‚weiß‘ kursiv, um seinen gesellschaftlichen Konstruktionscharakter hervorzuheben. ‚Schwarz‘ schreibe ich groß, um darauf zu
verweisen, dass ich den Begriff nicht als rassifizierende Bezeichnung, sondern
in Anschluss an antirassistische Bewegungen benutze, in der sich rassistisch
Markierte die Bezeichnungen ‚Schwarz‘ bzw. ‚Black‘ mit emanzipatorischem
Ziel angeeignet haben, wie zum Beispiel die Black Panthers oder die Initiative
Schwarzer Deutscher (ISD).
2
Alle Namen wurden zum Zwecke der Anonymität geändert. Ich verwende erfundene Vor- und Nachnamen, da die alleinige Nennung des Vornamens im Deutschen den Höflichkeitsregeln widerspricht und die Benannten
tendenziell abwertet bzw. machthierarchisch unter der Autorin ansiedelt.
4
�hatte seinen Finger bei einem Arbeitsunfall verloren, Pembe Kirilova
war obdachlos und suchte Arbeit, Yasar Kristovs Bruder war wegen UBahn-Fahrten ohne Ticket im Gefängnis. Zwei Polizisten kontrollierten
unsere Gesprächspartner*innen, uns aber nicht. Als wir die Polizisten
fragten, ob racial profiling3 der Kontrolle zu Grunde liege, erklärten sie:
Hier käme es eben zu viel Kriminalität und eigentlich wollten wir doch
dasselbe – Probleme lösen.
Bald zog ein Gewitter auf. Etwa 20 Arbeiter*innen kamen unserer Einladung nach, uns in den nur zwei Häuserblöcke entfernten Räumen eines
von einem Freund aus der antirassistischen Szene betriebenen, temporären Stadtteilprojekts des städtischen Theaters Münchner Kammerspiele unterzustellen und dort weiter zu diskutieren. Ab diesem Tag sollte
die Initiative Zivilcourage mindestens einmal wöchentlich einen Treffpunkt – ein (temporäres) Workers’ Center (Benz, 2014)4 – in diesen und
nach deren Abriss in anderen, nahegelegenen Räumen anbieten.
3
Mit dem Begriff des racial profiling wird versucht, rassistische Maßnahmen der Polizei zu thematisieren und auf ihre Verbreitung hinzuweisen.
Sebastian Friedrich und Johanna Mohrfeldt (2012) definieren racial profiling
folgendermaßen: „‚Racial Profiling‘ bezeichnet die Erstellung eines Verdächtigenprofils, bei dem rassifizierte Merkmale wie Hautfarbe, Haarfarbe oder religiöse Symbole (in der Regel in Zusammenwirkung mit Faktoren wie Gender,
Klasse, Alter) maßgeblich handlungsleitend für polizeiliche Maßnahmen wie
Kontrollen, Durchsuchungen, Ermittlungen und/oder Überwachung werden“.
4
Die Sozial- und Politikwissenschaftlerin Martina Benz (2014) hat eine
Studie über Worker Centers in den USA geschrieben, in der sie die ganz unterschiedlichen Kontexte darstellt, in denen Worker Centers entstanden sind,
und auch deren unterschiedlichen Organisationsweisen vorstellt. Einige entstanden durch unabhängige Organisierung migrantischer Arbeiter*innen
oder Afro-americans (ebd.: 14). Manche wurden von religiösen Gruppen initiiert, andere von Gewerkschaften und wieder andere von rechtlichen oder
sozialen Beratungsstellen. Sie haben gemeinsam, dass sie einen Ort bieten,
an dem Arbeiter*innen zusammenkommen können. Das Magazin wildcat hat
Workers’ Centers als „community-based“ beschrieben, „wobei diese Community über die Herkunft, territorial oder über eine bestimmte Arbeitssituation bestimmt sein kann, Überschneidungen inklusive“ (o.V., 2007). Dies ist
vor allem für Arbeiter*innen mit diskontinuierlicher Beschäftigung von Vorteil. Manche Worker Centers, wie das Ponoma Day Labour Center (Calderon et
al., 2003), dienen auch als Treffpunkt von Arbeitssuchenden und potenziellen
Arbeitgeber*innen, die sich registrieren und verpflichten, Mindeststandards
wie zum Beispiel einen bestimmten Lohn einzuhalten. In den meisten Wor-
5
�In diesem Buch geht es um die lokalen Auseinandersetzungen um EUinterne Migration, um den selbstorganisierten Arbeitsmarkt und insbesondere für die Versuche des Regierens, die in diesen Auseinandersetzungen eine Rolle spielten. Ziel der folgenden Einleitung und des ersten
Kapitels ist es, meine Analyseperspektive und Herangehensweise transparent zu machen und zu diskutieren. Warum nehme ich diesen Ort
und diese Situation als Ausgangspunkt? Nicht nur, weil hier die erste
Begegnung mit prekarisierten Arbeiter*innen bulgarischer Staatsbürgerschaft (und somit Unionsbürgerschaft) stattfand, ich in den nächsten
Jahren fast jede Woche hier Zeit verbrachte und in Konflikte um diesen
sozialen Raum eingebunden war, er also einen zentralen Platz in meiner
Forschungspraxis einnahm …
‚Tagelöhnermarkt‘ als Einheit?
… sondern auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass gerade die
Konzentration auf einen Ort und eine dort verortete soziokulturelle
Formation die Gefahr birgt, diese als eine geschlossene Einheit wahrzunehmen und Verbindungen und Verhältnisse, die über sie hinausgehen
oder sie durchqueren, zu vernachlässigen. Im dritten Kapitel werde ich
beschreiben, wie die Deutung dieser sozialen Formation als Einheit es
erst ermöglichte, sie als Skandal, als Fremdkörper, Störfaktor im Viertel und als Sicherheitsbedrohung wahrzunehmen. Die öffentliche Aufmerksamkeit fokussierte dabei auf die Anwesenheit von Gruppen wartender, rassistisch markierter Männer auf dem Gehsteig und benannte
die Formation als ‚Tagelöhnermarkt‘ oder ‚Arbeiterstrich‘. Erst dann
wurde sie der städtischen Politik zum Problem, das „gelöst“ werden
ker Centers stehen Auseinandersetzungen um vorenthaltene Löhne im Mittelpunkt, neben „Bildung, Schulung, Sprachtraining und Beratung“ (o.V., 2007),
aber es geht auch um „die Organisierung von politischen Kampagnen“, etwa
„gegen die Verschärfungen der Einwanderungsgesetzgebung“, denn oftmals
sind es migrantische Arbeiter*innen, die sich in den Worker Centers aufhalten
und organisieren (vgl. ebd.). Das von der Initiative Zivilcourage in Koalition
mit migrantischen Arbeiter*innen gegründete temporäre Workers’ Center in
München ist meines Wissens nach das einzige in Deutschland. Im Unterschied
zu der Schreibweise der Worker Centers in den Vereinigten Staaten wird es mit
einem Genitiv-S geschrieben – Workers’ Center –, um die Idee auszudrücken,
dass es ein Zentrum von Arbeiter*innen und nicht für Arbeiter*innen sein soll.
6
�sollte. Die Erfindung und Vereinheitlichung der Figur ‚Tagelöhnermarkt
im Münchner Bahnhofsviertel‘ und die folgenden Kämpfe um ihre Deutung – darum, wie über ihn gesprochen und gedacht werden konnte
– war direkt und indirekt verknüpft mit den weiteren Praktiken der verschiedensten Akteure – vom Münchner Stadtrat, über die Polizei, Funktionsträger in städtischen Ämtern, Geschäftsleute im Bahnhofsviertel
bis hin zu Politiker*innen auf Bundes- und EU-europäischer Ebene. Die
Frage drängt sich auf: Wie haben Wissenspraxen, inklusive meiner eigenen, die soziale Formation und die sie betreffenden und mitkonstituierenden hegemonialen Diskurse5 verändert? Meine wissenschaftliche
Wissenspraxis werde ich unter dem Schlagwort „Konflikt als Methode“
im ersten Kapitel kritisch reflektieren. Hier möchte ich nur kurz und
als Vorgriff zum dritten Kapitel auf die Frage eingehen: Welche Rolle
hat die Initiative Zivilcourage bei der Entdeckung des ‚Tagelöhnermarktes‘ – der Sichtbarmachung der Praktiken von EU-Migrant*innen6 auf
den Straßen des Südlichen Bahnhofsviertels mit der Kategorie ‚Tagelöhnermarkt‘ – und auch bei den folgenden Aushandlungen des Diskurses zu dieser neu geschaffenen Figur gespielt? Erst versuchten wir
(als Initiative Zivilcourage), die Situation der Arbeiter*innen unter dem
Stichwort ‚Tagelöhnermarkt‘ öffentlich zu machen, wobei wir so oft wie
möglich Interviews mit EU-Migrant*innen an Journalist*innen vermittelten7. Wir waren die ersten, die die Bezeichnungen ‚Tagelöhner*innen‘
5
Als Diskurse bezeichne ich im Anschluss an den späteren Michel
Foucault Macht-Wissen-Komplexe, die nicht nur einschränken, sondern auch
konstituieren, was sag- und denkbar ist und in die Aushandlungen von ganz
konkreten Wirklichkeiten eingebunden sind. Während die Vorstellung eines
‚diskursiven Wunschkonzerts‘ à la ‚Sprache schafft Realität‘ zu kurz greift, ist
Denken und Handeln, Praxis und Sprache doch aufs Engste miteinander verwoben (vgl. Weissmann, 2011: 14 ff.).
6
Mit dem Begriff EU-Migrant*innen bezeichne ich Migrant*innen
mit Unionsbürgerschaft. Meine Definition der Konzepte ‚Migration’ und
‚Migrant*in’ ist im Unterkapitel zum ‚Tagelöhnermarkt’ als rassistische Figur,
das Teil der Einleitung ist, zu finden.
7
Der Entschluss, die öffentliche Aufmerksamkeit durch Pressearbeit
zu suchen, entstand im Rahmen von gemeinsamen Treffen und Gesprächen
mit EU-Migrant*innen. Während einzelne Arbeiter*innen lieber nicht an die
Öffentlichkeit gehen wollten, setzte sich bald die Meinung durch, dass Medienberichte über ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse und auch persönliche Porträts von Arbeiter*innen dazu beitragen könnten, die Situation zu verbessern.
Gleichzeitig zu den strategischen Überlegungen, dass Politiker*innen oder an-
7
�und ‚Tagelöhnermarkt‘ nutzten. Als wir dann mit Medienberichten
konfrontiert waren, die unsere Repräsentation auf noch skandalisierendere und viktimisierendere Art und Weise aufgriffen, schwenkten wir
um und betonten, dass die prekarisierten Arbeiter*innen durchaus Jobs
fänden, Geld verdienten und hart arbeiteten. Erst seit etwa 2014 versuchen wir uns dezidiert von diesem individualisierenden und leistungsideologischen Blick zu lösen und zu vermitteln, dass die migrantischen
Arbeiter*innen konstitutiver Teil des Viertels und in die sozialen und
ökonomischen Verhältnisse Münchens eng eingebunden sind (egal ob
sie lohnarbeiten oder nicht). Dabei benutzen wir heute oft den Begriff
‚selbstorganisierter Arbeitsmarkt‘, um der Viktimisierung und Skandalisierung durch die Ausdrücke ‚Tagelöhnermarkt‘ oder ‚Arbeitertstrich‘
entgegenzuwirken und die agency der Personen zu betonen, die hier auf
Arbeitgeber*innen warten, Freund*innen treffen, Neuigkeiten austauschen, einfach nur Zeit totschlagen oder sich aus anderen Gründen hier
aufhalten.
Eigentlich scheint es mir aber grundsätzlich unzutreffend, den ‚Tagelöhnermarkt‘ als eine Einheit zu begreifen, egal unter welchem Namen.
Dies wird deutlich daran, dass es unmöglich ist, seine Ränder zu definieren. Wer gehört dazu? Nur die Personen, die hier gerade tatsächlich
auf Arbeitgeber warten, oder auch diejenigen, die sich dort treffen, auf
den Mikro-Bus nach Bulgarien warten oder einfach nur ‚spazieren gehen‘8? Wo hört er auf und wo fängt er an? Ist es nur an der Ecke Goethe-/Landwehrstraße, oder auch in den benachbarten Straßenzügen?
Der ‚Tagelöhnermarkt‘ lässt sich nicht eindeutig fassen, weder räumlich
noch zeitlich, noch in Bezug auf die Aufenthalts- und Arbeitsverhältnisse oder die Nationalitäten, das Alter, Geschlecht oder gar die Zahl der
Arbeitssuchenden und der anderen Personen, die sich hier aufhalten.
Die Ansammlung sozioökonomischer Beziehungen und Praktiken bildet
keine klar definierbare und umgrenzbare Entität, sondern, um mit Dedere Entscheidungsträger so auf die Situation aufmerksam würden und den
Forderungen nach Arbeit, Wohnraum, einem selbst-betriebenen Café und weniger Polizeirepression nachkommen würden, entstand die Motivation dafür,
mit Journalist*innen und anderen öffentlichen Akteuren zu sprechen, meiner
Meinung nach, auch aus der Wut über die Verhältnisse, die so ausgedrückt und
geteilt werden konnte.
8
Mit ‚gezmek‘ wurde von den türkischsprechenden Arbeiter*innen eine
beliebte Freizeitbeschäftigung bezeichnet, die in etwa mit ‚spazieren gehen‘
oder ‚um die Häuser ziehen‘ korrespondiert.
8
�leuze und Guattari (1997) zu sprechen, vielmehr eine nicht abzählbare,
nicht zu definierenende Assemblage von Praxen und Affizierungen, die
ständig im Werden begriffen und weder eingrenzbar noch gänzlich zu
kontrollieren ist.9
Die Vorstellung eines ‚Tagelöhnermarktes‘ geht mit mehreren kategorischen Festschreibungen einher. Zum einen werden die Personen, die
sich hier aufhalten, als ‚Tagelöhner‘ identifiziert. Ich benutze hier die
maskuline Form, weil allgemein – auch in wissenschaftlicher Literatur
(vgl. Özkan, 2015; Richter, 2015) – angenommen wird, dass nur Männer10
der ‚Tagelöhnerei‘ nachgehen, während die dazugehörigen Frauen im
Bahnhofsviertel um Geld betteln oder ‚daheim‘, also in Bulgarien, auf
die Kinder aufpassen. Es sei eine feste Gruppe von Männern, die hier
jeden Tag stehe, um für einige Stunden Arbeit zu finden. Meiner Erfahrung nach warten sowohl Männer wie auch Frauen hier auf Arbeit. So
haben auch die vier Frauen, deren Migrationsgeschichte ich im zweiten Kapitel erzählen werde, hier schon Arbeit gesucht und gefunden.
Auch habe ich nie von sozialen Bindungen zwischen Personen, die im
Bahnhofsviertel auf dem Gehsteig stehen und Arbeit suchen und den im
Bahnhofsviertel bettelnden Frauen erfahren. Im Gegenteil haben sich
lohnarbeitende oder nach Lohnarbeit suchende Personen öfters gegenüber den bettelnden Frauen bzw. gegenüber dem Betteln als Erwerbstätigkeit abgegrenzt, dieses moralisch abgewertet und so – mit den hegemonialen Normen der „Arbeitsgesellschaft“ (Hirsch, 2015; vgl. auch
Lessenich, 2013; Moser, 1993) konform gehend – ihre Subjektivierung als
‚rechtschaffene‘ Erwerbstätige unterstrichen.
Die Vorstellung, der ‚Tagelöhnermarkt‘ sei eine klar definierte Einheit,
ging auch mit der Annahme einher: Einmal ‚Tagelöhner‘, immer ‚Tagelöhner‘. Tatsächlich stellt der an dieser Kreuzung selbstorganisierte Arbeitsmarkt aber keine „Endstation Arbeiterstrich“ dar, wie die Schlagzeilen der Zeitschrift Focus (Rohrer, 2013) und der Süddeutschen Zeitung
(Öchsner, 2013) im Jahr 2013 nahelegten, sondern für viele Lohnabhängige eher eine Zwischenstation und dies nicht nur im zeitlichen, sondern auch im geografischen Sinne. Die ‚Tagelöhner‘ halten sich nämlich
zu anderen Zeiten auch an anderen Orten in der Stadt auf. Wenn ich
9
Zu den Begriffen des Werdens, der Affizierung und der Assemblage
vgl. Deleuze & Guattari, 1997; Tsianos & Pieper, 2011.
10
Wenn ich von Frauen und Männern spreche, möchte ich Trans- und
genderqueere Personen mit einschließen.
9
�mich auf den Münchner Straßen und in öffentlichen Verkehrsmitteln
in München bewege, treffe ich regelmäßig Personen, die ich von der
Kreuzung im Südlichen Bahnhofsviertel und vom Workers’ Center her
kenne. Öffentlich wahrgenommen werden sie allerdings nur als ‚Tagelöhner‘ am ‚Tagelöhnermarkt‘ und so werden sie auch auf diese Identität reduziert und an dieser Kreuzung verortet. Dass sie aber auch über
den selbstorganisierten Arbeitsmarkt hinaus Teil der Stadtgesellschaft
sind, wird so ausgeblendet. Desweiteren geht die Vorstellung des ‚Tagelöhnermarktes‘ auch mit kategorischen Festschreibungen in Bezug auf
ihr Arbeitsleben einher: ‚Tagelöhner‘ suchen Tagesjobs und sind darauf
angewiesen, dies hier zu tun. Aber tatsächlich haben nicht wenige der
hier anzutreffenden Personen auch längerfristige Arbeitsverhältnisse
und weitere Strategien der Arbeitssuche.
Das unzutreffende, aber hegemoniale Bild des ‚Tagelöhnermarktes‘ als
männlich, abgegrenzt und auswegslos zeigt, dass viel Wissen über den
‚Tagelöhnermarkt‘ produziert wird, ohne sich für die Perspektive, die
sozialen Realitäten und Subjektivierungen der ‚Tagelöhner*innen‘ zu
interessieren. Die diskursive Vereinheitlichung trägt auch zur Abgrenzung dieser sozialen Formation bei.
‚Tagelöhnermarkt‘ als Außen?
Die Vorstellung, dass der selbstorganisierte Arbeitsmarkt in sich
abgeschlossen ist und klare Grenzen hat, geht auch mit einem Ausschluss einher. Es handelt sich nicht nur um eine Grenzziehung
zwischen verschiedenen Teilen der Stadtgesellschaft, sondern auch
um eine Grenzziehung zwischen ihrem Innen und Außen. Katrin
Lehnert spricht mit Loïc Wacquant von einem „Kolumbus-Syndrom“ (Wacquant, 2008: 76, zit. n. Lehnert, 2009: 110), wenn Teile
der Gesellschaft mit Hilfe von Kategorien abgespalten werden:
„Aus einer Mittelschichtsperspektive werden neue defizitäre Problemgruppen entdeckt (das ‚Außen‘), die sich von einer als einheitlich gedachten Gesellschaft (dem ‚Innen‘) unbemerkt abgekoppelt zu haben
scheinen.“ (Lehnert, 2009: 110)
10
�Soziale Probleme sind dann nicht mehr Teil der Gesellschaft, sondern von ihr abgespalten (ebd.). Lehnert spricht zwar von der Gefahr, die in akademischen Analysekategorien wie ‚Prekariat‘ liegt, die
Kritik ist aber auch auf nichtwissenschaftliche Wissenspraxen zu übertragen.
Auch der ‚Tagelöhnermarkt‘ wird tendenziell als abgetrennte Einheit
dargestellt, die außerhalb der Stadtgesellschaft liegt. Er wird als ein Außen der Münchner Stadtgesellschaft imaginiert, befindet sich aber tatsächlich nicht nur geografisch, sondern auch im sozialen und ökonomischen Sinn inmitten der Stadtgesellschaft und inmitten Europas. So hat
die Arbeit, die die Arbeitssuchenden hier finden, eine zentrale Funktion:
Sie bauen Häuser, reinigen Gebäude oder arbeiten in den Supermärkten.
Außerdem konsumieren sie alltäglich in den Cafés, Imbissen und Supermärkten des Bahnhofsviertels und andernorts in München. Zudem
gibt es nicht wenige Vermieter*innen, die hohe Profite aus ihrer Notlage schlagen. Zum Beispiel kam es 2010 zu einem Skandal, weil etwa
500 Personen in 55 Zimmern mit Mieten von teils über 1000 Euro pro
Zimmer in einem Arbeiterwohnheim der Firma A1 in der Untersbergstraße wohnten11. Wenn eine fragt, wo und wie die Arbeiter*innen Teil
der Stadtgesellschaft sind, merkt sie schnell, dass der ‚Tagelöhnermarkt‘
eben nicht als ein abgetrenntes Phänomen außerhalb der Stadtgesellschaft, als Fremdkörper, zu begreifen ist. Und trotzdem herrscht die Auffassung, dass die EU-migrantischen Arbeiter*innen und der von ihnen
aufgesuchte Arbeitsmarkt nicht zur Stadtgesellschaft gehören, sondern
‚Andere‘, ‚Fremde‘ sind. Die Aufspaltung in ein imaginiertes ‚Innen‘ und
‚Außen‘ geht mit deren Bewertung als ‚gut‘ und ‚schlecht‘ einher und
spricht der als ‚Außen‘ bestimmten Einheit die Daseinsberechtigung ab.
In dieser Arbeit untersuche ich schwerpunktmäßig, wie dieses ‚innere
Außen‘ hergestellt und zum Objekt, zur Grundlage und zum Effekt von
Versuchen des Regierens12 wird. Dafür gilt es, über eine Analyseperspektive, die die hegemonialen Vorstellungen vom ‚Tagelöhnermarkt‘
seiner Realität gegenüberstellt und als ‚falsch‘ herausstellt, hinauszugehen, denn sie greift zu kurz. Es geht mir nicht darum, welche Darstellung wahr ist und welche moralische Bewertung zutrifft, oder nicht. Es
11
Die Situation wurde Ende 2009 im Münchner Stadtrat thematisiert
(vgl. Sozialreferat, 2009).
12
Auf den Begriff der ‚Versuche des Regierens‘ gehe ich weiter unten
ein.
11
�stellt sich vielmehr die Frage, wie es zu diesen hierarchisierten Gleichzeitigkeiten von ‚Innen‘ und ‚Außen‘ kommt und wie sie produktiv werden. Wie werden Trennung und hierarchische Ungleichheit zwischen
dem ‚Innen‘ und ‚Außen‘, dem ‚Eigenen‘ und dem ‚Anderen‘ hergestellt
und ausgehandelt?
‚Tagelöhnermarkt‘ als rassistische Figur
Der ‚Tagelöhnermarkt‘ wird sowohl im Medien- wie auch im kommunalpolitischen Diskurs als Störfaktor repräsentiert, wobei diese Markierung zahlreichen verschiedenen Logiken folgt. Zum einen folgt sie,
trotz Unionsbürgerschaft der Akteure, immer noch der Nationalität. Ein
extremes Beispiel stellt das folgende Zitat des Besitzers eines Hotels im
Bahnhofsviertel in der Süddeutschen Zeitung vom 4. Juni 2010 dar:
„Goethestraße sauber halten. Deshalb keine Bulgaren und Rumänen,
die sind nix, ich rufe Polizei, muss man wegmachen, schmutzig alle,
aber Polizei sagt, kann man nicht wegschmeißen in Heimat, ist EU,
Bulgarien. Leider.“ (Rühle, 2010)13
Der nationalstaatlichen Logik, dass Migrant*innen als Ausländer*innen
aus dem Staatsgebiet entfernt werden sollen, bzw. sich nur im Ausnahmefall im nationalen Territorium aufhalten dürfen, wird die freie
Mobilität und somit erschwerte Entfernbarkeit der EU-europäischen
Migrant*innen zum Problem. Dieser Konflikt zwischen national-staatlicher Exklusionslogik und EU-europäischer14 Zugehörigkeit bzw. liberaler Bewegungsfreiheit ist diesem Buch zentral und führt zu der Frage,
13
Dabei kommt nicht nur der Rassismus des Hotelbesitzers, sondern
auch der des Journalisten zum Ausdruck, der sozusagen in einem Rassismus
zweiten Grades den ehemaligen Gastarbeiter, auch durch die fehlerhafte deutsche Grammatik gekennzeichnet, als rassistisches Mangelwesen beschreibt.
14
Mit den Begriffen ‚EU-europäisch‘ und ‚EU-Europa‘ (statt ‚europäisch‘
und ‚Europa‘) möchte ich deutlich machen, dass die EU nicht dasselbe ist wie
Europa, weder im geografischen, noch im historischen und politischen Sinne.
Aufgrund von Lesbarkeit habe ich mich gegen die sich derzeit durchsetzende Schreibweise ‚EUropa‘ entschieden (vgl. etwa Wissel, 2015). Als Teil seiner
Analyse der EU als koloniales Projekt bezeichnet der ungarische Soziologe József Böröcz die sprachliche Gleichsetzung der ‚EU‘ mit ‚Europa‘ als „synecdoché
12
�welche neuen und alten Grenzziehungen unter diesen Umständen vorgenommen werden. Hierfür werde ich die Analyse des marxistischen
Philosophen Etiénne Balibars (2010) zum national-sozialen Staat heranziehen, die zeigt, wie der keynesianische Sozialstaat aufs Engste mit
Nationalismus und Rassismus verbunden ist.
Immer wieder werde ich auf Prozesse stoßen, in denen sich die staatsrassistischen Figuren des/r ‚Ausländer*in‘, ‚Migrant*in‘ und des ‚Fremden‘ mit der leistungsideologischen Figur des ‚Sozialschmarotzens‘ zu
den Begriffen des ‚Sozialtourismus‘ und auch der ‚Armutszuwanderung‘
verschränken. Verschiedene wissenschaftliche Ansätze können helfen,
diesen spezifischen „Assemblagen des Rassismus“ (Tsianos & Pieper,
2011) näher zu kommen. Die aktuellen rassismuskritischen Debatten beruhen auf den grundlegenden Analysen, dass Rassismen sich nicht auf
individuellen Hass und seine Übersetzung in ‚fehlgeleitetes‘ institutionelles Handeln reduzieren lassen, sondern soziale (Macht-)Verhältnisse
darstellen, die von angeblichen gesellschaftlichen Einheiten (‚Rassen‘,
‚Nationen‘, ‚Kulturen‘, ‚Wertegemeinschaften‘) aus- bzw. einschließen.
Sie reagieren auf heterogene, sich in kontingenter Bewegung befindende gesellschaftliche Verhältnisse mit Vorstellungen und Praktiken von
(moralischer) Ordnung, Normalität und Homogenität (vgl. Bojadžijev,
2008; Giroux & Goldberg, 2006; Goldberg, 2002; Lentin & Titley, 2011).
Rassistische (Wissens-)Praktiken definieren, was normal und was nicht
normal, erwünscht und unerwünscht, was fremd und was eigen, was
Innen und was Außen ist. Indem Rassismen Menschen in ungleiche
Verhältnisse zueinander setzen, regulieren sie auch den Zugang zu
ökonomischen und symbolischen Ressourcen (vgl. Hall, 2000; 2004). Es
geht in der Rassismusforschung nicht nur um Sprache, sondern auch
um materielle Umstände und die Veränderung von gesellschaftlichen
Kräfteverhältnissen. Rassismen, so die neuere Rassismusforschung,
durchziehen nicht zuletzt auch die Körper und die Subjektivierung der
Akteure (vgl. Papadopoulos & Sharma, 2008). Es wurde beispielsweise
untersucht, wie die Ideen des ‚Westens‘, der ‚Moderne‘ oder der ‚Aufklärung‘ – untrennbar verknüpft mit Gegenbildern wie „dem Rest der
Welt“ (Hall, 1994), dem „Orient“ (Said, 1979), ‚Primitivität‘ oder ‚Unterentwicklung‘ – Teil der kolonialen, kapitalistischen und paternalistischen Projekte sind und auch den heutigen Gesellschaftsverhältnissen
representation (where the part stands for the whole, conveniently ignoring,
hence excluding and occluding, the rest)“ (Böröcz, 2001: 8).
13
�und Subjektivierungen zugrunde liegen (vgl. Balibar & Wallerstein,
2014; Dietze, Brunner & Wenzel, 2010; Fanon, 1966). In seinem Buch The
racial state (2002) hat der südafrikanische Philosoph Theo Goldberg gezeigt, wie die Entstehung und die heutigen Transformationen des modernen Staates nicht von Prozessen der Rassifizierung zu trennen sind.
Unter dem Schlagwort des methodologischen Nationalismus erklären
die U.S.-amerikanische Kulturanthropologin Nina Glick Schiller und
andere Kulturwissenschaftler*innen, wie die Vorstellung von Gesellschaft mit dem Nationalstaat zusammengeschweißt ist und Gesellschaft
in nationalen Containern gedacht wird (vgl. Wimmer & Glick-Schiller,
2003). Diese Vorstellung geht mit der Normalisierung von Sesshaftigkeit
einher. Migration wird in diesem Denkrahmen gewöhnlich als grenzüberschreitende Bewegung zwischen zwei Staaten definiert und als problematische Ausnahme gesehen, die von der Norm der Sesshaftigkeit
abweicht. Migrant*innen sind dann zu integrierende, zu rettende oder
abzuschiebende Ausländer*innen, die anhand von Defiziten (sprachlich,
kulturell, ökonomisch, etc.) gedacht werden (vgl. Hess, Binder & Moser,
2009). Die Kategorie ‚Migrant*in‘ transportiert Andersheit, Fremdheit
und auch Bedrohung und trägt so eine wichtige Funktion in der aktuellen Konjunktur des Rassismus. In der Figur der „Armutszuwanderung“
verschränkt sich die Kategorie ‚Migrant*in‘ mit der Kategorie ‚Roma‘
und somit mit antiziganistischem Rassismus, der ebenfalls das angebliche Nomadentum, also die Nicht-Sesshaftigkeit problematisiert und
auf den ich im dritten Kapitel näher eingehen werde. Es gibt gerade
in neoliberalen Zeiten aber auch einen positiven Bezug auf Mobilität
und transnationale Vernetzung, wie etwa durch die Förderung von
Mobilität im Studium durch Programme wie Erasmus und auch durch
positive Bezugnahmen auf die EU-europäische Freizügigkeit deutlich
wird. So wird in neueren Spielarten des Rassismus Gesellschaft nicht
allein anhand von nationalen Abgrenzungen und das ‚Wir‘ nicht nur
entlang von ‚race‘ oder ‚Kultur‘ definiert. Diese als Neo-Rassismen (vgl.
Dietze, 2009: 24), postliberal (vgl. Tsianos & Pieper, 2011) oder auch als
racial neoliberalism (vgl. Lentin & Titley, 2011) bezeichneten Rassismen
affirmieren Diversität positiv. Es sind die illiberalen Minderheiten, die
westlichen Werten der Aufklärung, des Leistungswillens, der Emanzipation und sexuellen Toleranz angeblich nicht entsprechen, die in diesen
Rationalitäten auf Ablehnung stoßen (vgl. Lentin & Titley, 2011; Puar,
2007; Tsianos, 2014).
14
�In Bezug auf den antimigrantischen Rassismus stellt sich die Frage: Welche Mobilität gilt als Migration und wer wird als Migrant*in
problematisiert und regiert? Oder in Bezug auf die EU-migrantischen Arbeiter*innen: Wie werden aus mobilen Unionsbürger*innen,
die
ihre
Freizügigkeit
wahrnehmen,
Armutszuwander*innen, die den Sozialstaat und den sozialen Frieden in
den Stadtteilen bedrohen? Im öffentlichen Diskurs scheint hier eine Art
common sense zu herrschen, dass Migration mit Wohnortwechsel und
der Überschreitung von Staatsgrenzen zu tun hat. Nicht alle, auf die diese Kriterien zutreffen, werden aber als Migrant*innen kategorisiert bzw.
migrantisiert, man denke nur an ‚Expats‘ oder den ‚Jetset‘. Gleichzeitig
können Personen, die in Deutschland geboren wurden und hier leben,
durchaus als Migrant*innen gelten – so kann die von der staatlichen Demografie etablierte Kategorie ‚Migrationshintergrund‘ von den Eltern
geerbt werden. Ich grenze mich also von einer Migrationsforschung ab,
die Migration als eigenständiges soziologisches Phänomen begreift, sozusagen Migrant*innenforschung betreibt und damit Teil der aktuellen
Konjunktur des Rassismus und der Versuche, Migration zu regieren,
ist. Ist dann aber nicht allein schon die Rede von der ‚Migration‘ und
‚Migrant*innen‘ notwendigerweise problematisch? Wäre es eine Lösung, auf die Bezeichnung ‚Migrant*in‘ zu verzichten? Meiner Meinung
nach würde es nicht helfen, den Begriff nicht mehr zu verwenden, denn
dann entstünde die Gefahr, eben jene realen Prozesse und Verhältnisse
zu übersehen, die das Migrant*in-Sein produzieren. Stattdessen gilt es,
Migration als politisches Aushandlungsfeld zu begreifen und in diesen
Aushandlungen Position zu beziehen. Ich möchte die Perspektive also
umdrehen und Migrant*innen mit Sandro Mezzadra (2015) für die Zwecke dieses Buches definieren als jene, deren Mobilität rassistisch problematisiert und zur Grundlage ihrer Ausbeutung und Dominanz gemacht
wird – kurz: Migration = Mobilität + Rassismus.
Das am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt Universität angesiedelte Berliner Labor Migration stellt auch in Bezug auf den
wissenschaftlichen Diskurs die Diagnose, dass „der Migrationsbegriff
bei genauerem Hinsehen schnell unscharf wird“ (Lehnert & Lemberger, 2014; vgl. auch New Keywords Collective, 2016). Es gelte, Migration als Teil der Gesellschaftsordnung zu begreifen, somit Gesellschaftsforschung zu migrantisieren und im Gegenzug Migrationsforschung
zu entmigrantisieren, d. h. den „Fokus weg von den migrantischen
15
�Subjekten und Räumen“ (Lehnert & Lemberger, 2014: 45) und vorzugsweise „hin zu den Techniken und Institutionen ihrer Beherrschung“
(ebd.) zu lenken. In diesem Sinne definiere ich auch den selbstorganisierten Arbeitsmarkt als migrantischen bzw. migrantisierten Raum.
Nicht, weil er von Personen geprägt ist, die Staatsgrenzen langfristig
überschritten haben, sondern weil es gerade das Mobil-Sein, das NichtVon-Hier-Sein der ‚Tagelöhner*innen‘ ist, das neben ihrer Armut und
angeblich fehlender Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt als Grundlage
der Problematisierungen herangezogen wird, die ‚Tagelöhner*innen‘ als
Bedrohung erscheinen lässt. Anders ausgedrückt ist die Migrantisierung der ‚Tagelöhner*innen‘ Grundlage dafür, sie zum Objekt von spezifischen antimigrantischen und migrationsregulierenden Versuchen
des Regierens zu machen15. Wie an diesem Beispiel schon deutlich wurde, spielen bei den Aushandlungen der scheinbar so selbsterklärenden
und neutralen Kategorien ‚Migrant*in‘ und ‚Migration‘ neben Rassifizierung, und Kulturalisierung auch Klassismus eine wichtige Rolle. Die
Rede von der Migration ist also extrem unscharf, umkämpft und kann
sicherlich als einer der Hauptschauplätze der aktuellen Auseinandersetzungen um Rassismus und soziale Verhältnisse bezeichnet werden.
Verkompliziert wird dies noch einmal dadurch, dass immer mehr nicht
nur zwischen Sesshaftigkeit, Mobilität und Migration, sondern im Zuge
postliberaler Artikulationen des Rassismus auch zwischen guten und
schlechten Migrant*innen unterschieden wird. In Bezug auf EU-interne Migration tut sich zudem der Sonderfall auf, dass die Grenzen von
nationalem Territorium und Bürgerschaft teilweise mit den EU-Außengrenzen, den Grenzen des Schengener Raumes und der Unionsbürgerschaft in Konflikt treten. In dieser Arbeit kann ich anhand von mehreren Teilanalysen nachverfolgen, wie aus der ‚Mobilität‘ von freizügigen
Unionsbürger*innen in einem Prozess der Migrantisierung ‚Armutszuwanderung‘ wird, und was das mit Rassismus und Klassenverhältnissen
und Transformationen von Staatlichkeit und Bürgerschaft zu tun hat.
15
Wenn antimigrantischer Rassismus also eine Grundlage meines Forschungsansatzes darstellt, behaupte ich nicht, dass andere Formen des Rassismus keine Rolle spielen, wie etwa Antiziganismus oder nicht (vorwiegend) auf
Mobilität beruhende rassifizierende Zuschreibungen von Schmutz, Sexualität,
Hautfarbe, etc. Insbesondere das dritte Kapitel zeigt, wie höchst flexibel und
vielfältig die untersuchten „Assemblagen des Rassismus“ (Tsianos & Pieper,
2011) in Bezug auf den ‚Tagelöhnermarkt‘ und die ‚Armutszuwanderung‘ waren.
16
�Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass ich mich nicht
für die Aushandlungen um und am selbstorganisierten Arbeitsmarkt
interessiere, um mehr über die bulgarischen Migrant*innen oder den
‚Tagelöhnermarkt‘ zu erfahren16, sondern, um zu einer rassismustheoretisch informierten, intersektionalen Analyse und Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse und Auseinandersetzungen in München, Deutschland und der EU beizutragen. Hier spielt die Frage nach der Produktion
von Differenz, wie in der aktuellen historischen Konjunktur zwischen
Innen und Außen unterschieden wird und mit welchen Praktiken, Institutionen und Versuchen des Regierens sich diese Vorstellungen verschränken, eine große Rolle. Die lokalen Auseinandersetzungen um
EU-Migration geben, so meine These, einen gleichzeitig sehr partiellen
und tiefgehenden Einblick in die aktuellen Verschiebungen, Brüche und
Kämpfe des Rassismus.
16
Auch wenn ich mich in dieser Arbeit nicht auf sie beziehe, sondern
mich eher von ihnen abgrenze, weil es dezidiert nicht in meinem Interesse liegt,
über die migrantischen Arbeiter*innen und den selbstorganisierten Arbeitsmarkt soziologisches Wissen zu produzieren, möchte ich hier auf die sozialwissenschaftliche Forschungslandschaft zu day laborers und day labor markets,
die vor allem in den USA und auch in Japan seit etwa 15 Jahren recht belebt
ist, verweisen. Beispielsweise gibt es Forschungen über die informellen Organisationsweisen von Tagelöhner*innenagenturen (Bartley & Roberts, 2006), zu
Versuchen, ein day labor center in Denver zu etablieren (Camou, 2009) und zu
Arbeitsverhältnissen von day laborers in New York und Strategien, diese z.B.
durch Worker Center zu verbessern (Theodore, Valenzuela & Meléndez, 2006).
Der Soziologe Damian T. Williams (2009) hat enthnografisch dazu geforscht,
wie day laborers ihre Arbeitssuche gestalten und wie der Arbeitsmarkt auf der
Mikroebene organisiert ist. Eine weitere Studie hat mit quantitativen und qualitativen Methoden die Arbeiter*innen, die ökonomische Nachfragesituation
und die räumlichen Dimensionen der day labor markets in Tokio und Los Angeles miteinander verglichen (Valenzuela, Kawachi & Marr, 2002). In seinem
Artikel Day Labor Work in der Zeitschrift Annual Review of Sociology von
2003 gibt der Soziologe und Stadtplaner Abel Valenzuela (2003) einen Überblick
über die Literatur zu day labor bis zu diesem Zeitpunkt.
17
�‚Tagelöhnermarkt‘ in der Arbeitsgesellschaft
Wie bereits deutlich wurde, wird der selbstorganisierte Arbeitsmarkt
auch in Bezug auf die mit ihm in Zusammenhang stehenden Arbeitsverhältnisse immer wieder als ein Außen, eine Ausnahme und eine
Gefahr für die Münchner Bevölkerung dargestellt. Auf der einen Seite,
wie im dritten Kapitel zu lesen sein wird, ist dann die Rede von der
‚Endstation Arbeiterstrich‘ und von ‚modernen Sklaven‘, während die
deutschen Arbeitnehmer*innen von ‚Dumpinglöhnen‘ bedroht seien.
Auf der anderen Seite wird den ‚Tagelöhner*innen‘ oft jede Verbindung
zum Arbeitsmarkt abgesprochen – sie gelten dann als ‚unqualifizierte
Migrant*innen‘ ohne Perspektive auf dem Münchner Arbeitsmarkt. Die
Kategorie ‚Armutszuwanderung‘, als sogenannte ökonomische Migration von der angeblich nicht ökonomischen Sphäre der Flucht getrennt, ist
Ausdruck eines paradoxalen vermeintlichen Außen im liberalökonomischen Sinne: ‚Armutszuwanderer‘ stehlen gleichzeitig ‚den Deutschen‘
die Arbeitsplätze und leben als ‚Sozialtouristen‘ von ‚unseren Steuergeldern‘. Der Begriff Armutszuwanderung ist, wie ich zeigen werde, im
Zeitrahmen meiner Forschung erst zu einer Kernfigur des Regimes der
EU-internen Migration und Arbeit avanciert.
Eine Frage, die in den Auseinandersetzungen zu den ‚Tagelöhner*innen‘
stark umkämpft war, lautete: Sind sie Arbeiter*innen, oder nicht? Mit
anderen Worten: Sind sie erwerbstätig oder zumindest erwerbsfähig?
Die Antwort bestimmte nicht nur über den symbolischen Ein- bzw. Ausschluss in die Bevölkerung, sondern auch über den Zugang zu bürgerschaftlichen Rechten – so ist beispielsweise der Anspruch auf grundsichernde Leistungen (Hartz IV) an die Erwerbstätigeneigenschaft
gebunden. Wie diese Frage ausgehandelt wurde, werde ich im dritten
Kapitel in Bezug auf den Kampf um die Deutung des ‚Tagelöhnermarktes‘ im öffentlichen Diskurs analysieren, sie wird aber auch in den Aushandlungen mit Polizei und Zoll (Kapitel 4), dem Wohnungsamt (Kapitel 5), am Europäischen Gerichtshof (Kapitel 6) und in den Konflikten
mit Ausländerbehörde und Jobcenter (Kapitel 7) eine Rolle spielen. Die
Aufmerksamkeit dafür, wie die Figur der ‚Arbeitnehmer*in‘ umkämpft
wurde, wird mich nicht zuletzt zu der Frage nach den aktuellen Transformationen des Sozialstaates führen, die neben den Prozessen der Europäisierung und (Re-)Nationalisierung auch von der Umwandlung des
18
�keynesianischen, die (nationale) Bevölkerung absichernden Wohlfahrtssystems zum aktivierenden workfare-Regime (vgl. Peck, 2001) geprägt
sind17.
Hier möchte ich nur herausstellen, dass die Debatte, ob die
‚Tagelöhner*innen‘ – oder auch generell die ‚Armutszuwander*innen‘
– Arbeiter*innen seien, auf einem Konsens darüber beruhte, was Arbeit bedeutet. Der Begriff der Arbeit war kaum umstritten, sondern fast
durchgehend entsprechend der Normalitätsvorstellung in der ‚Arbeitsgesellschaft‘ als sozialversicherungspflichtige, ganztägige Lohnarbeit,
die mitunter den Wert einer Person bestimmt, definiert. Die zentrale
These der wissenschaftlichen Debatten zur Arbeitsgesellschaft lautet,
dass die Figur der ‚Arbeit‘ zum Maßstab gesellschaftlicher und staatlicher Normalitätsvorstellungen, Politiken und Praktiken geworden ist
(vgl. Lehnert, 2009; Lessenich, 2013; Hirsch, 2015). Arbeit gilt als Figur,
um die gesellschaftliche Prozesse kreisen und die die Normalität und
Subjektivierungen bestimmt. Sie geht einher mit der „politische[n] Vision vom Arbeitslosen als Schuldigen und vom Sozialhilfebetrug als
Sozialmissbrauch (anstatt als solidarischen Rechtsanspruch in einer demokratisch verfassten politischen Gemeinschaft)“ (Hirsch, 2015: 87). Politökonomischer Hintergrund ist, so der Münchner Philosoph Michael
Hirsch, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wegen technologischen Fortschritten zwar immer weiter abnehme, die gesellschaftlich erwartete Arbeitszeit aber nicht für alle reduziert werde, sondern
vielmehr „die individuelle Erwerbstätigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum Imperativ erhoben wird“ (ebd.). Statt die Reduzierung
der Arbeitslast für alle zu begrüßen, avanciert die unweigerlich entstehende Arbeitslosigkeit zur Schuld der Einzelnen. Auch hier findet sich
17
Die als workfare bezeichnete Sozialpolitik bindet soziale Leistungen an
die Bedingung, dem Leistungsimperativ zu folgen. In Deutschland macht der
Slogan der Hartz IV-Reform „Fordern und Fördern“ diese Logik deutlich. Statt
anzuerkennen, dass Arbeitslosigkeit strukturell bedingt ist, werden die vermeintlich ‚leistungsunwilligen‘ Einzelnen zur Ursache erklärt. Ziel ist die Aktivierung von Leistungspotential. Ausgeschlossen werden diejenigen, die dem
Leistungsimperativ nicht Folge leisten (können). Im Unterschied dazu werden
in der national-sozialen Logik der Exklusion primär jene von sozialen Leistungen ausgeschlossen, die nicht Staatsbürger*innen sind. Das Thema workfare
und aktivierender Sozialstaat wird in den folgenden Kapiteln immer wieder
aufgegriffen, um dann im Kapitel 7 ausführlicher behandelt zu werden.
19
�wieder ein angebliches Außen, das definierender Teil der Gesellschaft
ist:
„Im heutigen postfordistischen Arbeitsregime sind auch die ‚Überflüssigen‘ und ‚Überzähligen‘ Teil der Arbeitsgesellschaft, und zwar sowohl objektiv wie subjektiv. Objektiv, indem sie zu Objekten der Politik der ‚Wiedereingliederung‘ des aktivierenden Sozialstaates werden;
subjektiv, indem sie mental Teil der Arbeitsgesellschaft und ihrer Normalitätserwartungen bleiben.“ (ebd.: 19)
Die diskursanalytischen Überlegungen zur sich verändernden Rolle der
Figur der Arbeit sind notwendig, um die aktuellen Versuche des Regierens zu verstehen – insbesondere, wenn versucht wird, durch Aktivierung zu regieren. Sie dürfen aber nicht die Frage nach den materiellen
Ausbeutungsverhältnissen verdecken.
Tagelöhnermarkt als Teil globaler Ausbeutungsund Klassenverhältnisse
Auch wenn meine Forschung für eine genauere Analyse der Arbeitsverhältnisse der EU-Migrant*innen, mit denen wir im Workers’ Center
zusammenarbeiteten, nicht ausgelegt war, weil ich nicht an deren Arbeitsplätzen und während ihrer Arbeitszeit forschte, kann ich im zweiten Kapitel ein Schlaglicht auf den Arbeitskampf von vier Reinigungsarbeiter*innen werfen und diesen auch in eine Beschreibung der Arbeits- bzw. Ausbeutungsverhältnisse18, denen ich im Rahmen meiner Arbeit mit der Initiative Zivilcourage begegnet bin, einbetten. Es zeichnet
sich ein sehr diverses Bild von Arbeitsverhältnissen ab, das keinesfalls
auf die in den Medien skandalisierten Schreckensmeldungen von extrem
niedrigen Löhnen, komplett fehlenden Arbeitsrechten und Zwangsver18
Ich verwende die Begriffe Arbeits- und Ausbeutungsverhältnisse
weitgehend synonym. Hintergrund dafür ist die marxsche Analyse, dass Lohnarbeit im Kapitalismus immer auf der Ausbeutung von Arbeitskraft beruht. Von
‚Arbeitsverhältnissen‘ spreche ich meist dann, wenn die Kritik an der Ausbeutung oder die Kapitalismusanalyse nicht im Vordergrund steht, z. B. wenn ich
Ansätze oder Kämpfe rezipiere, die sich nicht gegen Lohnarbeit positionieren,
sondern nur gegen prekäre oder ‚überausbeutende‘ Lohnarbeit.
20
�hältnissen zu vereinfachen ist. Die Arbeitsverhältnisse der EU-migrantischen Arbeiter*innen19 sind aber trotzdem sehr prekär: Es handelt
sich meist um Jobs im Bau- und Reinigungsgewerbe für etwa acht bis
fünfzehn Euro die Stunde (brutto), mit mehr oder weniger dokumentierten Arbeitsverträgen oder auch als (schein-)selbstständige Einpersonenunternehmen. Bis 2014 mussten die neuen Unionsbürger*innen im
Rahmen der Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Regel
eine Arbeitserlaubnis beantragen, was undokumentierte Arbeitsverhältnisse förderte. Für die Arbeitgeber*innen sind letztere auch heute
noch von Vorteil, weil sie sich Sozialabgaben sparen, die immerhin bis
zu 40 Prozent der Lohnkosten ausmachen. Die Arbeiter*innen arbeiten
oft nur einige Stunden oder Tage für einen oder eine Arbeitgeber*in,
manchmal auch längerfristig, bevor sie wieder einen neuen Job suchen.
Lohnbetrug ist zwar nicht die Regel, aber durchaus an der Tagesordnung – sei es, dass der/die Arbeitgeber*in gar nicht zahlt oder der/die
Arbeitnehmer*in über unbezahlte Überstunden, versteckte Akkordarbeit und ‚geschönte‘ Arbeitszeitabrechnungen um ihren Lohn betrogen
wird.
Welche Ansätze gibt es, um diese Arbeitsverhältnisse zu analysieren? Sowohl in manchen Medienberichten als auch aus einer (unzureichenden)
19
Ich nutze den Begriff ‚EU-migrantische Arbeiter*innen‘ als zentrale
Bezeichnung für die Personen, deren Kämpfe im Zentrum dieser Arbeit stehen. So möchte ich auf ihre (in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stets
neu ausgehandelte) Positionierung im kapitalistischen Produktionsprozess
und damit gesellschaftlichen Kräfte- und Konfliktverhältnissen hinweisen.
‚Arbeiter*innen‘ sind auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft oder, wenn sie nicht
erwerbstätig sind, auf staatliche Transferleistungen oder Unterstützung durch
soziale Netzwerke angewiesen. Mit dem Begriff ‚Arbeiter*innen‘ möchte ich
aber keine Vorstellungen einer ‚Arbeiterklasseneinheit‘ aufrufen oder mich auf
einen ‚Hauptwiderspruch‘ beziehen. Politische Subjekte als ‚Arbeiter*innen‘
zu bezeichnen, geht allzu oft mit einem orthodox-marxistischen, strukturalistischen Klassenbegriff einher, der sowohl Selbstbezeichnungen übergeht wie
auch übersieht, dass Klasse stets etwas in Bewegungen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen Gemachtes und keine vorgegebene Struktur ist (vgl.
etwa Balibar & Wallerstein, 2014). Stattdessen gehe ich von sehr vielfältigen
und historisch situierten Prozessen der Vergesellschaftung aus, die auf unterschiedlichste Weisen entlang von gender, class, race und weiteren Differenzkategorien bzw. sozialen Verhältnissen umkämpft sind. Vgl. auch das Unterkapitel Selbstorganisierter Arbeitsmarkt als intersektionelle und überdeterminierte
Formation und Carstensen, Heimeshoff & Riedner i.E.
21
�kapitalismuskritischen Perspektive gilt der ‚Tagelöhnermarkt‘ als Sinnbild des ‚Raubtierkapitalismus‘: ein Abstellgleis für nackte Arbeitskraft,
die völlig dem Gutdünken der Arbeitgeber*innen bzw. dem Bedarf des
Arbeitsmarktes ausgeliefert ist. Die ‚Tagelöhner‘ sind dann „moderne
Arbeitssklaven, frei verfügbar“ (SZ vom 7.10.2012) oder „Freiwild für
betrügerische Subunternehmer“ (SZ vom 24.8.2010). Der selbstorganisierte Arbeitsmarkt kann aber auch aus weniger reißerischer Perspektive als Ausbeutungstechnologie analysiert werden. Er gewährleistet
einen hohen Mehrwert, weil die Arbeitskraft extrem flexibel einzusetzen ist und somit keine Kosten verursacht, wenn sie nicht gebraucht
wird. Außerdem müssen sich die Arbeitgeber*innen um die Gesundheit und das Wohlergehen der einzelnen Arbeiter*innen keine Sorgen
machen, weil sie, wenn eine*r krank wird, sich gleich wieder eine*n
andere*n Arbeiter*in holen können. Auch der Begriff der Überausbeutung ist hier anzuwenden – nicht nur, weil die Löhne oft unterhalb des
Durchschnittslohns liegen, sondern auch, weil der Preis der Arbeit den
Preis der Reproduktion der Arbeit unterschreitet (vgl. Friedrich & Zimmermann, 2015)20. Den Lohnabhängigen bleibt nicht genug Geld, um
langfristig gesund zu bleiben, sie sind oft obdachlos und ohne Krankenversicherung. Solche unsicheren Arbeitsverhältnisse werden heute
oft als prekär bezeichnet. Auf die Begriffe der Ausbeutung, Überausbeutung, Prekarität und Prekarisierung werde ich im zweiten Kapitel
zurück kommen.
Bei solchen Analysen, egal ob sie von (Über-)Ausbeutung oder Prekarität sprechen, bleibt aber zu bedenken, dass es in mehrfacher Hinsicht
vereinfachend ist, den ‚Tagelöhnermarkt‘ auf die einseitig vermachtete
Beziehung zwischen Unternehmer*in und Lohnarbeiter*in zu reduzieren. So kann der Arbeitsmarkt nicht verstanden werden, ohne nach der
Rolle insbesondere der staatlichen Versuche des Regierens zu fragen.
Die Migrationsforscherin Bridget Anderson etwa stellt einen klaren Zusammenhang zwischen Migrationskontrollen und Prekarisierung her:
20
Ich danke Jonathan Schmidt-Dominé für die Hinweise, dass der Überausbeutungsbegriff auch deswegen problematisch ist, weil bei der Berechnung
des Durchschnittlohns oft ein nationaler Maßstab angelegt wird und weil das,
was als ‚bloße Reproduktion‘ und ‚lebensnotwendig‘ gilt, nicht überall gleich
ist. Zudem blendet der Begriff tendenziell aus, dass auch eine ‚durchschnittliche‘ Ausbeutung Körper nicht schont und auf unbezahlte Reproduktion setzt.
22
�„rather than a tap regulating entry, immigration controls might be
more usefully conceived as constructing certain types of workers, and
facilitating certain types of employment relations, many of which are
particularly suited to precarious work.“ (Anderson, 2007)
Im Laufe der Arbeit werde ich immer wieder auf die Frage zurückkommen, inwiefern die Ausbeutungsverhältnisse im Kontext des selbstorganisierten Arbeitsmarktes mit (sozial-)rechtlichen Ausschlüssen und den
Assemblagen des Rassismus, die die Arbeitssuchenden markieren und
ihren sozialrechtlichen Ausschluss legitimieren, verknüpft sind.
Aus materialistisch-staatstheoretischer Perspektive geht der nationalsoziale Staat als Kompromiss zwischen nationaler Bürgerschaft und
Kapital mit dem (graduellen) Ausschluss von Arbeiter*innen, die nicht
zu den Staatsbürger*innen gehören, einher. Der Ausschluss bestimmter
Gruppen von Arbeiter*innen von gewissen Rechten stratifiziert den Arbeitsmarkt und ermöglicht eine
„Desorganisation [...], weil die Kopplung sozialer Rechte an die Staatsbürgerschaft – die ‚soziale Staatsbürgerschaft‘, wie Balibar es nennt
– die in diesem Prozess stattfindet, die Nationalisierung der Arbeiterklasse materiell fundiert.“ (Karakayalı & Tsianos, 2002: 263)
Die Nationalisierung der Arbeiterklasse ist Grundlage für die Migrantisierung eines anderen Teils der Arbeiter*innen. In der Diskussion mit
Immanuel Wallerstein legt Balibar dar, wieso nicht nur zwischen Staaten des Zentrums und der Peripherie, sondern auch innerhalb der Staaten, in denen sich ein national-sozialer Kompromiss bilden konnte, ein
„duales Proletariat“ (Balibar, 1998: 217) entsteht, das mit „zwei Reproduktionsweisen“ (ebd.) einhergeht: Für die Staatsbürger*innen ist die
Reproduktion (mehr oder weniger) durch den Sozialstaat in die kapitalistische Produktionsweise integriert, für die von der Staatsbürgerschaft
Ausgeschlossenen wird die Reproduktion
„ganz oder teilweise vorkapitalistischen Reproduktionsweisen (oder
besser gesagt: Reproduktionsweisen, die durch den Kapitalismus dominiert und entstrukturiert werden und nicht auf freier Lohnarbeit basieren); sie stehen in direktem Zusammenhang mit den Phänomenen
23
�[...] der destruktiven Ausbeutung der Arbeitskraft und der rassischen
Diskriminierung.“ (ebd.)
Im Falle der EU-Migrant*innen heißt dies, dass ihr weitgehender Ausschluss aus dem nationalen Sozialsystem, die unsicheren Arbeitsverhältnisse und die niedrigen Löhne dazu führen, dass sie oftmals versuchen
müssen, ihre Reproduktion (dazu gehört Essen, Schlafen, Sorgearbeit,
soziale Beziehungen und Krankenversorgung) weitgehend außerhalb
der kapitalistischen Kreisläufe von Konsum, Sozialversicherung und
Lohnarbeit selbst zu organisieren – oder darauf verzichten müssen, was
krank macht und langfristig tötet.
In Serhat Karakayalıs und Vassilis Tsianos skizzenhaftem Versuch „das
Migrationsregime der Bundesrepublik Deutschland und seine Transformation unter rassismusanalytischen Gesichtspunkten kritisch zu rekonstruieren“ (Karakayalı & Tsianos, 2002), sind es nicht nur die Migrationskontrollen, sondern die rassifizierten Linien folgende „Trennung von
Lohnarbeit und Staatsbürgerschaft“ (ebd. 264) generell, die (wenn wir
ihre Analyse etwas vereinfachen) zu einer „ethnisierten Unterschichtung der eingewanderten Arbeitskraft“ (ebd. 246), zur „Segmentierung
der Arbeitskraft“ und zur „rassistische[n] Hierarchisierung von Lebenschancen“ (ebd. 246) führen. Sie beziehen sich dabei auf einen prominenten Rassismusforscher, Robert Miles, der Rassifizierung und Rassismus
definiert als:
„ideological forces which, in conjunction with economic and political
relations of domination, located certain populations in specific class
positions and therefore structured the exploitation of labour power in
a particular ideological manner.“ (Miles, 2000: 141)
Eine solche Perspektive erlaubt zu fragen, wieso genau diese
Arbeiter*innen ihre Arbeitskraft am selbstorganisierten Arbeitsmarkt
verkaufen. Es wird sich zeigen, dass der ‚Tagelöhnermarkt‘ und die Ausbeutungsverhältnisse der Lohnabhängigen, die hier Arbeit suchen und
finden, ohne den Rassismus, der die Arbeitssuchenden markiert und abwertet, ebenso wenig zu erklären sind, wie ohne eine Untersuchung des
spezifischen rechtlichen Status der Unionsbürgerschaft und Freizügigkeit und deren konkrete Umsetzung in München.
24
�Die Segmentierung des Arbeitsmarktes hilft nach Tsianos und Karakayalı
zudem zu erklären, wieso die Arbeiter*innen sich nicht als Arbeiterklasse konstituieren und gemeinsam gegen ihre (Über-)Ausbeutung zur
Wehr setzen:
„Die Ethnisierung könnte demnach bestimmt werden als ein konstitutives Element der Klassenbildung und zwar nicht auf der Ebene
der Klasse als Produktivkraft, sondern in Bezug auf das kapitalistische (Staats)Regime, das in der strukturellen Desorganisation der Beherrschten besteht.“ (ebd.: 263)
Und auch nach Immanuel Wallerstein erweist sich
„der Rassismus [...] bei der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems als hilfreich. Dank seiner Existenz können die Vergütungen für
einen Großteil der Arbeiterschaft viel geringer ausfallen, als es auf der
Basis von Verdienst und Leistung zu rechtfertigen wäre.“ (Wallerstein,
1998: 46)
Die von Wallerstein mitbegründete Weltsystemtheorie weitet den
Blick über den einzelnen Staat hinaus aus, denn kapitalistische Verhältnisse seien nur global zu erklären. Die Erschließung neuer Märkte,
neuer Rohstoffe und günstiger Arbeitskraft in den peripheren, teils
noch nicht kapitalistisch erschlossenen Regionen gehöre seit dem 16.
Jahrhundert zur Funktionsweise des Kapitalismus und verändere die
Lebensweisen und sozialen Strukturen in der Peripherie, was zu Migration führe, sowohl vom Land in die Städte oder in die industrialisierten Regionen, wie auch in die Länder des sogenannten kapitalistischen
Zentrums. Im zweiten Kapitel wird sich zeigen, dass auch die Lebensrealitäten der EU-migrantischen Arbeiter*innen sich ohne einen Blick
auf die Verhältnisse in Bulgarien und die Beziehungen zwischen Bulgarien, der EU und Deutschland bzw. München nicht erklären lassen.
Es gilt aber genau hinzusehen, denn Gesellschaften sind nicht klar
zwischen Peripherie und Zentrum aufgeteilt, sondern werden von
immer komplexeren Differenzierungen durchkreuzt. An dieser Stelle erscheint mir das Konzept der differenzierten Inklusion produktiv,
das beschreibt, dass die heutige Gesellschaft durchkreuzt und durchquert ist von verschiedensten Linien der differenzierten Inklusion, die
25
�Ausbeutungsverhältnisse multiplizieren (vgl. Casas-Cortes et al., 2014;
Mezzadra & Neilson, 2013). Es verweist auf die Gleichzeitigkeit von
Innen und Außen, indem es nicht, wie oft üblich, davon ausgeht, dass
Entrechtung und Ausgrenzung zu Ausschluss führt, sondern zu spezifischen Formen von Einschluss in einer stratifizierten, zonierten, vermachteten Gesellschaft. Es stellt einen Vorschlag dar, von Einschluss
statt von Ausschluss zu sprechen – aber von einem fragmentierten
Einschluss. Die Vorstellung eines einheitlichen, homogenen Bevölkerungskörpers wird so untergraben. Der Begriff der differenzierten
Inklusion hilft, einen detaillierteren Blick auf die Verhältnisse im Kontext des selbstorganisierten Arbeitsmarktes zu werfen – nicht nur in
Hinsicht auf die zwischen Ein- und Ausschluss changierende gesellschaftliche Situation der bulgarischen Arbeiter*innen, mit denen wir
im Workers’ Center vor allem zusammen arbeiteten, sondern auch auf
die vermachtete Vielfalt der gesellschaftlichen Positionierungen, in
denen sich Akteure im Kontext des selbstorganisierten Arbeitsmarkt
befanden. In Kapitel 4 gehe ich so etwa darauf ein, wie ein azerbaijanischer Staatsbürger, dessen Visum abgelaufen war und der am selbstorganisierten Arbeitsmarkt Anschluss gefunden hatte, Asyl beantragte, um wenigstens ein Dach über dem Kopf und Verpflegung zu
haben. Seine bulgarischen Begleiter beschwerten sich, dass die Option
Asylantrag für sie spätestens seit dem EU-Beitritt Bulgariens nicht
mehr existierte. Ein ehemaliger Werkvertragsarbeiter aus der Türkei,
der für einige Zeit ohne Papiere in München lebte, erklärte, dass der
Stundenlohn im Bahnhofsviertel gesunken wäre, seitdem so viele ‚Bulgaren‘ ihre Arbeitskraft hier anböten. Diese und weitere Beispiele in
dieser Arbeit zeigen, dass es statt dem vermeintlich klar abgegrenzten
Außen vielfältige fragmentierte Formen des Einschlusses gibt und wie
dabei rechtlich und rassistisch differenzierte Gruppen unterschiedliche Interessen haben können, so dass es zumindest schwieriger – aber
keineswegs unmöglich! – ist, sich gemeinsam zu organisieren.
Differenzierte Inklusion heißt nicht nur, dass Grenzen durchlässig
sind und filtern, sondern beinhaltet eine Aussage über das Innen und
Außen im Kapitalismus, das über die rein rechtliche Aufspaltung hinausgeht, Prozesse der Normierung und Subjektivierung mit einbezieht, die Frage nach den Widersprüchen des Kapitalismus stellt und
so die analytische Perspektive auf ein abstrakteres Niveau ausweitet.
26
�Sandro Mezzadra (2011) spricht davon, dass kapitalistische Verhältnisse
gleichzeitig auf dem Streben, gesellschaftliche Verhältnisse gänzlich zu
erschließen bzw. in Wert zu setzen, und der grundlegenden Notwendigkeit eines Außen, das in Wert gesetzt werden kann, bestehen. Oder in
anderen Worten: Die kapitalistische Dynamik als soziales Verhältnis sei
darauf angewiesen, dass es ein Außen gibt, das angeeignet, ausgebeutet
und kommodifiziert werden kann:
„Let me briefly elaborate on the proposed definition of capitalism. First
of all it may seem paradoxical. While the first element of the definition
(capital as ‚social relation‘) points to a ‚constitutive outside‘ (we could
define it with Marx: ‚labor as not capital‘), the second element (‚endless
accumulation of capital‘) has been presented as a ‚totalizing‘ norm. I
think that it is worth maintaining this paradox, since it lies at the core
of modern capitalism and it makes up its contradictory and dynamic
nature. Capital must totalize itself (that means, it must organize the
whole fabric of society, politics, culture, etc. according to its norms, to
the imperative of its ‚endless accumulation‘ and valorization), and at
the same time this attempt to totalize itself cannot but be partial, since
the existence of a ‚constitutive outside‘ is a necessary condition for its
valorization.“ (Mezzadra, 2011: 159)
Die materiell und rechtlich differenzierte Inklusion der EU-migrantischen Arbeiter*innen und der Antagonismus zwischen ihrer diskursiven Einhegung als Arbeiter*innen und (Unions-)Bürger*innen auf der
einen Seite und Ausgrenzung in das angebliche Außen der Gesellschaft
– als ‚Schwarzarbeiter‘, ‚Überflüssige‘ oder ‚Armutszuwanderer‘ – auf
der anderen Seite, lässt sich so als Teil kapitalistischer Vergesellschaftung verstehen21.
21
Wenn der populäre Soziologe Mike Davis die Slums der Weltmetropolen als außerhalb der Gesellschaft darstellt (vgl. M. Davis, 2007), Robert Castel
in seinen einflussreichen soziologischen Arbeiten zu sozialem Ausschluss und
Prekarität eine „Zone der Entkoppelung“ (Castel & Dörre, 2009) festmacht oder
das Münchner Sozialreferat sogenannten Armutszuwander*innen jede ‚Perspektive‘ in München abspricht (siehe Kapitel 5) – greift dies analytisch also zu
kurz. Ohne auf die politische Theorie hier weiter eingehen zu können, denke
ich, dass die These, dass die Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse auf ihrer Expansion aufbauen und somit immer neue ‚Außen‘ und neue Grenzlinien
produzieren, eine differenziertere Analyse ermöglicht. Auch die extremste Ar-
27
�Eine zentrale Frage, die sich immer wieder stellt, wenn wir versuchen,
den ‚Tagelöhnermarkt‘ zu analysieren, ist aber bis jetzt unberücksichtigt
geblieben: Handelt es sich tatsächlich nur um eine Ausbeutungs- und
Ausgrenzungstechnologie oder vielmehr (auch) um einen widerständigen Raum?
Selbstorganisierter Arbeitsmarkt als widerständiger Raum und Ausbeutungstechnologie zugleich
Nicht nur die extreme Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, ökonomische
Unsicherheit und die Versuche der Polizei, den ‚Tagelöhnermarkt‘ zu
vertreiben und einzudämmen, bestimmen die Lebens- und Arbeitsrealitäten der migrantischen Arbeiter*innen, sondern ihre alltäglichen
Praktiken in sozialen Netzwerken gestalten diesen sozialen Raum mit.
Die migrantischen Arbeiter*innen sind ständig in Auseinandersetzungen um Lohn, Arbeitsbedingungen und auch ihre bloße Anwesenheit
im öffentlichen Raum, verwickelt. Ein Arbeitskampf von vier Frauen
und ihr transnationales eigenwilliges Migrationsprojekt wird Thema
des zweiten Kapitels sein. Im vierten Kapitel werde ich darauf eingehen,
wie Polizei, Zoll und andere Akteure versuchen, die ‚Tagelöhner‘ zu vertreiben, dabei aber regelmäßig das Nachsehen haben. Auch verschiedene Versuche, EU-Migrant*innen durch die Hetze gegen sogenannte
Armutszuwanderung, Verschärfungen des Freizügigkeitsgesetzes und
den Ausschluss von arbeitssuchenden Unionsbürger*innen vom Recht
auf ein Existenzminimum (siehe Kapitel 7) inkl. Unterkunft (siehe Kapitel 5) abzuschrecken und so von einem Aufenthalt etwa in Deutschland
abzuhalten, blieben erfolglos.
In ihrer relationalen Theorie des Rassismus plädiert Manuela Bojadžijev
für einen Wechsel der Perspektive: Es gelte, von den Kämpfen der Migration auszugehen (also quasi Antirassismusforschung statt Rassismusforschung zu betreiben), um so Rassismus und Kapitalismus nicht
als übermächtig und starr erscheinen zu lassen, sondern als gesellschaftliche Auseinandersetzungen:
mut ist aus einer solchen Perspektive als Teil der kapitalistischen Gesellschaft
zu begreifen. Dies macht menschliches Elend nicht weniger skandalös, sondern
schärft den Blick auf seinen gesellschaftlichen Zusammenhang.
28
�„Die Konjunkturen des Rassismus hängen nicht nur von seiner internen Reproduktionsfähigkeit ab. Seine Reorganisation und Entwicklung
ist entscheidend geprägt von denen, die sich gegen ihn zur Wehr setzen.
Zur Bestimmung der Konjunkturen lassen sich folglich die Kämpfe
gegen Rassismus zum Ausgangspunkt nehmen. Rassismus ist selbst
eine Form der sozialen Auseinandersetzung, in welcher er sich erneuert und zur komplexen Form kapitalistischer Entwicklung beiträgt.“
(Bojadžijev, 2008: 47)
Auch der selbstorganisierte Arbeitsmarkt kann nicht nur einseitig
als Ausbeutungstechnologie, sondern muss auch als Artikulation von
Kämpfen der lebendigen Arbeit22 gegen ihre Kommodifizierung und Regulierung verstanden werden. Er kann nicht als Abstellgleis nackter Arbeitskraft begriffen werden, sondern auch die Strategien und Praxen der
Arbeiter*innen müssen in den Blick genommen werden. Der selbstorganisierte Arbeitsmarkt und die ihn bedingenden Regime der EU-internen
Migration sind nicht alleine Werkzeuge des Kapitals, die fragmentierte
Reservearmeen schaffen sollen, um Ausbeutungsverhältnisse zu verschärfen. Den ‚Tagelöhnermarkt‘ alleine als Ausbeutungstechnologie zu
betrachten, folgt deterministischen Ansätzen, die soziale Formationen
als passives Produkt von Ausbeutungs- und Regierenstechnologien sehen. Ein solcher Funktionalismus wurde insbesondere orthodox-marxistischen Analysen von Migration vorgeworfen. Migration jedoch „lässt
sich nicht aus Kosten-Nutzen-Rechnungen ableiten und im Sinne einer
Reservearmee steuern“ (Hess & Tsianos, 2004: 8).
Ist der selbstorganisierte Arbeitsmarkt dann also viel eher widerständiger Raum als Ausbeutungstechnologie? Ich möchte argumentieren, dass
er beides zugleich ist und gerade die konkrete Artikulation dieses Spannungsfelds Einblick in die kapitalistische Gesellschaftsformation gibt.
Auch so ist die widersprüchliche Gleichzeitigkeit von Innen und Außen
zu verstehen: Die Ware Arbeitskraft ist nicht von ihrem Gegenstück
der lebendigen Arbeit zu trennen. Auch wenn immer wieder versucht
wird, Menschen auf ihre Arbeitskraft zu reduzieren – z. B. durch restriktive Politiken der ‚Arbeitsmigration‘ oder die Idee der EU-europäischen
22
Der marxsche Begriff der „lebendigen Arbeit“ betont, dass Arbeitskraft nie völlig zur Ware werden kann und so nie gänzlich zu bestimmen ist,
weil sie immer mit lebendigen Körpern, mit Menschen, mit Vielfalt verbunden
ist (Hielscher & Riedner, 2015).
29
�‚Marktbürgerschaft‘ – kommen nicht nur Arbeitskräfte ‚rein‘, sondern
auch Menschen23. In den Worten des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis:
„That economic concept of the labour input as radically different to all
other inputs and labour as the only commodity that can never be fully
commodified was to me – and still remains to this day – Marx’s biggest contribution to our way of conceptualizing the political economy
we live in. So when he was writing that labour is the ‚living, form-giving fire‘ that lends value to commodities, he was not just being poetic,
he was being at his highest level of economic analysis.“ (SkriptaTV,
2013)24
Die Handlungsmacht und politische Zentralität der migrantischen
Arbeiter*innen in der Produktion der sozialen Formation des selbstorganisierten Arbeitsmarkts zu betonen, bedeutet nicht, im liberalen Sinne
zu behaupten, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, sondern
die Kämpfe der Arbeiter*innen als eigenwilligen Part in antagonistischen Verhältnissen zu begreifen.
Die soziale Formation des selbstorganisierten Arbeitsmarkts ist also
durch eine weitere Gleichzeitigkeit zu beschreiben: Es handelt sich nicht
nur um eine Ausbeutungstechnologie, sondern auch um einen Raum der
(Arbeits-)Kämpfe, die im antagonistischen Verhältnis zu den Verwertungsprozessen und zu den Versuchen der Kontrolle und des Regierens
stehen, oder diesen im deleuzianischen Sinne entfliehen bzw. über diese
hinausgehen25. Ich schlage also vor (wie es Moritz Ege nach der Lektüre
eines ersten Entwurfes dieser Einleitung treffend formuliert hat),
23
Ich beziehe mich hier auf die „humanistisch gesinnte“ (Bojadžijev &
Karakayalı, 2007: 210) Aussage, die Max Frisch im Rahmen einer Debatte zu
Migration in den 1960er Jahren in der Schweiz getroffen hat: „Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen“ (Frisch, 1965: 100).
24
Yanis Yaroufakis zitiert hier die folgenden Worte aus den Grundrissen
von Karl Marx: „Labour is the living, form-giving fire; it is the transitoriness of
things, their temporality, as their formation by living time“ (Marx, o.J.).
25
Mit politischen Praktiken, die über die Versuche des Regierens hinausgehen und ihnen entfliehen, setze ich mich im zweiten Kapitel noch einmal unter dem Stichwort der „imperceptible politics“ auseinander (vgl. Papadopoulos,
Stephenson & Tsianos, 2008).
30
�„das vermeintliche Außen als gewissermaßen systemisch produzierten
oder doch zumindest systemisch relevanten Bestandteil von Kapitalismus zu verstehen, der (a) neue Objekte der Verwertung darstellt, (b)
so etwas wie eine Reservearmee, (c) lebendige Arbeit, die darin nicht
aufgeht.“ (Ege, 2015a)
In dieser Arbeit geht es um die komplexen Auseinandersetzungen in
München, in denen die EU-migrantischen Arbeiter*innen zu Objekten
der Verwertung und des Regierens gemacht werden, aber gleichzeitig
für ein besseres Leben kämpfen.
Selbstorganisierter Arbeitsmarkt als intersektionelle und überdeterminierte Formation
Eine weitere Schärfung der Perspektive scheint mir noch nötig, die
durch die vorhergehenden Überlegungen schon vorbereitet wurde.
Wenn eine die alltäglichen und transnationalen Praktiken der EU-migrantischen Arbeiter*innen als Arbeitskampf und den selbstorganisierten Arbeitsmarkt als Ausbeutungsinstrument versteht, dann übersieht
sie schnell, dass sich die Gesellschaft nicht auf einen Antagonismus zwischen ‚ökonomischen‘ Faktoren und den Kämpfen gegen Ausbeutung
reduzieren lässt. Die EU-migrantischen Arbeiter*innen sind aber nicht
nur von Versuchen betroffen, Profit zu maximieren und auch bei ihren
Kämpfen handelt es sich nicht nur um solche, die gegen Ausbeutung
kämpfen, sondern es geht auch um andere Formen der Unterdrückung
und Dominanz, wie etwa die Kontrolle ihrer Mobilität und paternalistische Machtverhältnisse. Mit Demo-Slogans wie „Wir möchten nicht wie
Hunde behandelt werden“ oder „Wir sind keine schlechteren Menschen“
wenden sie sich gegen Rassismus und Ausgrenzung. Der Satz „Ich bin
gekommen, um selbstständig zu sein“, mit dem Nadka Eseva im Rahmen eines gemeinsamen Fotoprojektes an die Öffentlichkeit ging, handelt nicht nur von ökonomischer Selbstständigkeit, sondern auch von
dem Ausbruch aus ihrer Ehe und dem prekären Leben in Bulgarien (vgl.
Riedner, 2011). Auch die Versuche des Regierens der EU-Migrant*innen
machen aus einer rein ökonomischen Perspektive nicht immer Sinn. So
wird die soziale Formation des selbstorganisierten Arbeitsmarkts nicht
nur durch Interventionen, die ökonomischen Rationalitäten folgen,
31
�sondern beispielsweise auch durch sicherheitspolitische Praktiken beeinflusst.
Nicht zuletzt kulturanthropologische Beschäftigungen haben auf die
Verschränkung von Wirtschaftsweisen mit anderen Bereichen menschlicher Kultur hingewiesen26. So weist der US-amerikanische Kulturanthropologe Michael Burawoy mit seinen Studien darauf hin, dass
Produktion noch nie rein ökonomisch bestimmt war: „the process of
production contains political and ideological elements as well as a purely economic moment“ (Burawoy, 1983: 587). Die Vorstellung einer rein
‚ökonomischen‘ Sphäre und die damit einhergehenden Unterscheidungen zwischen dem Politischen, dem Sozialen und dem Ökonomischen
ist eine liberale Abstraktion, die nach Raia Apostolova auch den dynamischen Differenzierungen zwischen guten, politischen und schlechten, ökonomischen Flüchtlingen und zwischen guten, im ökonomischen
Sinne produktiven Migrant*innen und schlechten, nichtproduktiven
Migrant*innen zu Grunde liegt und so die politischen Widersprüche des
Kapitalismus zwischen lebendiger Arbeit und Kapital verschleiert (Apostolova, 2015). Es gilt also, kein ökonomistisch vereinfachtes Verständnis
von sozialen Verhältnissen einzunehmen. Rassistische und sexistische
Machtverhältnisse werden in ökonomistischen Ansätzen oft darauf
verkürzt, dass sie Arbeiterklassen spalteten und so einen gemeinsamen
Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung erschwerten. Diese Machtverhältnisse sind dem Kapitalismus aber nicht nur funktional, sondern
haben auch eigene Dynamiken. Eine solche Kritik an orthodox-marxistischen Perspektiven wurde in mehreren Zusammenhängen formuliert. In Étienne Balibars viel zitierten Essay zu „Klassen-Rassismus“
(Balibar, 1998) konstatiert dieser etwa eine „Heterogenität der histo26
Dieses Buch wurde auch als Doktorarbeit im Fach Kulturanthropologie geschrieben. Ich habe mich dazu entschieden, für diese Publikation nur
jene fachinternen Bezüge und Debatten herauszustreichen, die für eine fachfremde Leser*innenschaft uninteressant sind. Nicht nur, weil ich meine Positionierung in der problematischen Geschichte des Vielnamenfachs der „Volks-“
bzw. „Völkerkunde“ oder „(Europäischen) Ethnologie“, die eng mit kolonialen
und volkstümelnden Kräften verstrickt ist, transparent machen möchte. Sondern auch, weil mir manche Debatten für die Auseinandersetzung zu kritischer,
situierter Wissenspraxis und sozialen Verhältnissen, die über das Fach hinaus
gehen, durchaus relevant erscheinen. Dieses Buch ist also auch als Versuch zu
verstehen, ausgewählte kulturanthropologische Debatten in eine größere kritische Öffentlichkeit einzubringen.
32
�rischen Formen, die das Verhältnis von Rassismus und Klassenkampf
angenommen hat“ (ebd.: 248), so dass „die schlichte Idee nicht haltbar ist, dass der Rassismus gegen das ‚Klassenbewusstsein‘ eingesetzt
wird“ (ebd.: 250, Hervorhebung im Original).
Allen voran waren es aber feministische Stimmen, die dem orthodox marxistischen Credo von der grundlegenden Bedeutung der
Produktionsverhältnisse als ‚Unterbau‘, auf denen die gesellschaftlichen Verhältnisse als ‚Überbau‘ erst sekundär erwuchsen, widersprachen. Die Unterordnung und Ausbeutung von Frauen sei nicht
bloß eine Nebenwirkung des Kapitalismus, sondern eine eigenständige Form der Unterdrückung. Deshalb werde die Emanzipation der Frauen sich auch nicht automatisch als Nebenprodukt der
sozialistischen Revolution ergeben, sondern müsse schon auf dem
Weg dorthin aktiv eingefordert und verwirklicht werden. In mehrheitlich von weißen Frauen geprägte feministische Strömungen
wiederum intervenierten Schwarze Frauen: Rassismus als Herrschaftsform müsse mit in die Analyse geholt werden (vgl. Combahee River Collective, 1982; Davis, 1981; hooks, 1990). Mit Konzepten
wie triple oppression (vgl. Viehmann u.a., 1991) und Intersektionalität (vgl. Hess, Langreiter et al., 2014) sollte die Verschränkung
der verschiedenen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse analysiert werden. So gilt es auch in der vom ‚Tagelöhnermarkt‘ ausgehenden Analyse von Regimen der Lohnarbeit und der EU-internen
Migration, rassistische ebenso wie sexistische, paternalistische und
heteronormative Machtverhältnisse mit zu reflektieren. Am selbstorganisierten Arbeitsmarkt und in den gesellschaftlichen Verhältnissen, deren Teil er ist, stehen Lohnabhängige im Konflikt mit
Arbeitgeber*innen. Die Verhältnisse sind aber nicht alleine durch
den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zu erklären, sondern
in vielerlei Hinsicht überdeterminiert.
Mit dem Begriff der Überdeterminierung, wie auch mit den verwandten Konzepten der historischen Konjunktur und der Artikulation greife ich auf den postmarxistischen Werkzeugkasten zurück,
wie er unter anderem von Louis Althusser, Etienne Balibar und Stuart Hall geprägt und auch in neueren kulturanthropologischen Ansätzen weiter entwickelt wurde (vgl. Bojadžijev, 2008; Ege, 2015b).
Es handelt sich um Versuche, deterministische und ökonomistische
Verständnisse von Gesellschaft zu überwinden.
33
�Das Konzept der historischen Konjunktur, das ursprünglich von Antonio Gramsci geprägt wurde (vgl. Ege, 2015b; Hall & Massey, 2012), geht
davon aus, dass gesellschaftliche Verhältnisse ständig ausgehandelt
werden und sich in ihren Transformationen nicht vorhersehen lassen,
dass aber gleichzeitig gewisse Eigenheiten, Kräfteverhältnisse, MachtWissens-Komplexe und Widersprüche typisch sind für spezifische Momente. Nach Lawrence Grossberg handelt es sich bei einer historischen
Konjunktur um „einen historischen Moment, der definiert ist durch eine
Anhäufung/Kondensierung von Widersprüchen, durch eine Fusion verschiedener Strömungen oder Umstände“ (Grossberg, 2007: 140, zit. n.
Ege, 2015b: 75). Suart Hall betont das Krisenhafte an Konjunkturen:
„A conjuncture is a period when different social, political, economic
and ideological contradictions that are at work in society and have given it a specific and distinctive shape come together, producing a crisis
of some kind. [...] A conjuncture can be long or short: it’s not defined
by time or by simple things like a change of regime – though these
have their own effects. As I see it, history moves from one conjuncture
to another rather than being an evolutionary flow.“ (Hall & Massey,
2012: 55)
Als Beispiele nennt er die historische Konjunktur der Nachkriegszeit,
die u.a. vom Wohlfahrtsstaat dominiert war, und die in der Krise der
1970er Jahre ihren Anfang nehmende neoliberale Konjunktur (vgl.
ebd.).
Das Verhältnis von konkreten sozialen Verhältnissen, Situationen oder
(diskursiven) Praktiken, die unter dieser Perspektive ebenfalls als kontingent konzeptionalisiert werden, und ihren historischen Konjunkturen wird durch den Begriff der Artikulation ausgedrückt. Die partikularen Situationen und konkreten lokalen Verhältnisse artikulieren
historischen Konjunkturen; sie sind nicht deren notwendiges Ergebnis
und gleichzeitig nicht ohne diese zu erklären. Stuart Hall bezeichnet
mit dem Begriff Artikulation,
„eine Verbindung oder eine Verknüpfung, die nicht in allen Fällen
notwendig als ein Gesetz oder Faktum des Lebens gegeben ist, aber
die bestimmte Existenzbedingungen verlangt, um überhaupt aufzutreten; eine Verknüpfung, die durch bestimmte Prozesse aktiv auf-
34
�recht erhalten werden muss, die nicht ‚ewig‘ ist, sondern ständig erneuert werden muss, die unter bestimmten Umständen verschwinden
oder verändert werden kann, was dazu führt, dass die alten Verknüpfungen aufgelöst und neue Verbindungen – Re-Artikulationen – geschmiedet werden.“ (Hall, 2004: 65)
Wenn ich im Folgenden davon spreche, das sich A und B in C artikulieren, dann möchte ich damit vor allem ausdrücken, dass B kein
notwendiges Ergebnis von A und B war – dass es auch anders hätte
kommen können.
Der Begriff der Überdeterminierung drückt in diesem Sinne aus, dass
konkrete Verhältnisse und Situationen nicht durch einen einzelnen Faktor (oder auch durch verschiedene Faktoren) hinreichend erklärt werden können, sondern dass verschiedene Faktoren zusammentreffen und
situativ ausgehandelt werden, so dass konkrete Artikulationen der historischen Konjunkturen als unvorhersehbare Effekte der unterschiedlichsten Faktoren und situativ-kontingenter Aushandlungsprozesse immer
überdeterminiert sind. Nach Manuela Bojadžijev dient der Begriff der
Überdeterminierung dazu, „den Verlauf der Geschichte weder objektiv,
gelenkt durch ökonomische Prozesse, noch subjektiv als intentionale Tat eines Individuums oder Kollektivs zu konzipieren“ (Bojadžijev,
2008: 272).
Die relationale Autonomie von Migration und
Arbeiter*innen
Anfang der 2000er wurde mit der These der Autonomie der Migration in der deutschsprachigen Migrationsforschung und in antirassistischen Debatten ein operaistisches Argument stark gemacht
und dabei ausgeweitet (Bojadžijev & Karakayalı, 2007). Der italienische Operaismus (vgl. Balestrini & Moroni, 2002; Wright, 2005)
war gegen den orthodox-marxistischen Determinismus angetreten
und hatte die These der Arbeiterautonomie aufgestellt: Änderungen der Produktions- und Gesellschaftsverhältnisse werden von
den Kämpfen der Arbeiter*innen vorangetrieben (vgl. Bojadžijev,
Karakayalı & Tsianos, 2003; Malo de Molina, 2004a). Die Perspektive der Autonomie der Migration erfüllt die Forderungen, sowohl
35
�Ökonomismus wie auch Determinismus zu überkommen, indem sie
a) von den Kämpfen als treibende Kraft ausgeht und b) die Migration weder von push-und-pull-Faktoren getrieben sieht, noch auf
den Antagonismus zwischen lebendiger Arbeit und Kapital reduziert.
Die Autonomie der Migration postuliert die Migration als treibende Kraft gesellschaftlicher Entwicklungen:
„[M]igration is autonomous, meaning that – against a long history of
social control over mobility as well as a similarly oppressive scholarly
thought – migration has been and continues to be a constituent power
throughout the formation of modern polity.“ (Tsianios, 2007: 162)
Diese Analyseperspektive erlaubt, die gesellschaftlichen Verhältnisse
der Migration mit denen der Arbeit zu verknüpfen und Migrant*innen
als Träger*innen von Arbeitskraft zu konzeptualisieren:
„Migration ist nicht kontrollierbar, weil die Ware Arbeitskraft einen
spezifischen Unterschied zu allen anderen Waren aufweist. Die Träger der Ware, hier die MigrantInnen, lassen sich nicht auf genau diese
Funktion reduzieren, oder anders gesagt: Der Migrant ist kein homo
oeconomicus.“ (Karakayalı, 2008: 152)
Aber sie schreibt sie nicht auf die Rolle der Lohnarbeiter*innen fest.
So untersucht Manuela Bojadžijev in der Windigen Internationalen
(Bojadžijev, 2008) nicht nur Streiks in den Fabriken, sondern auch Kämpfe um Kindergeld oder bezahlbaren Wohnraum. Und Serhat Karakayalı
(2008) zeigt in den Gespenstern der Migration, dass auch das Regieren
der Migration nicht auf ökonomische Rationalitäten zu reduzieren ist.
Leider haben aber viele aktuelle Forschungen zum europäischen Migrations- und Grenzregime, die sich auf die Perspektive der Autonomie der
Migration beziehen, den Ausgangspunkt der Arbeiterautonomie und
die Frage nach kapitalistischen Verhältnissen aus den Augen verloren.
Sie sind in ihrer Kritik an funktionalistischen und orthodox-marxistischen Analysen, die Grenzen und Migrationskontrolle auf Werkzeuge
des Kapitals reduzieren, über das Ziel hinausgeschossen und haben es
verpasst, weiterführende Analyseansätze zu kapitalistischen Verhältnissen in die Analyse mit einzubeziehen. Ein solchermaßen eingeengte
36
�Perspektive trägt nicht nur wenig zu einem Verständnis der aktuellen
Konjunkturen des Kapitalismus bei, sondern reifiziert diesen sogar (vgl.
Mezzadra, 2011). Ich möchte mit Sandro Mezzadra dafür plädieren, eine
solche „theoretische Polarität“ aufzubrechen:
„Einerseits versuchen von den Cultural Studies beeinflusste ForscherInnen aufzuzeigen, wie migrantische Hybridität und Handlungsmacht
essentialistische Identitätsdiskurse destabilisieren; andererseits existiert, was ich sehr grob ‚ökonomischer Ansatz‘ genannt habe, welcher
die Ausbeutung hervorhebt. Ausbeutung ist in diesem Ansatz der
Schlüssel zur Situation der MigrantInnen. Mensch könnte sagen, es
gibt auf der einen Seite ein negatives Bild der MigrantInnen – als ausgebeutetes Subjekt, und auf der anderen Seite gewissermaßen ein positives Bild: MigrantInnen als kulturelle Avantgarde der Gegenwart, als
diasporische Subjekte, ‚KosmopolitInnen von unten‘. Ich glaube, diese
theoretische Polarität muss überwunden werden.“ (Mezzadra, 2010)
In der vorliegenden Arbeit versuche ich, über diese theoretischen Kurzschlüsse hinauszukommen, indem ich mich an den Wurzeln der Perspektive der Autonomie der Migration in der postoperaistischen Figur
der Arbeiter*innenautonomie reorientiere und das Konzept der differenzierten Inklusion verwende. Es gilt, aus einer Perspektive der Kämpfe heraus über Determinismus und Ökonomismus hinaus zu gelangen,
und trotzdem die Frage nach den aktuellen kapitalistischen Verhältnissen nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Frage nach dem Regieren
Ich nehme den ‚Tagelöhnermarkt‘ und die Kämpfe der EU-migrantischen Arbeiter*innen im mehrfachen Sinne zum Ausgangs- und Anknüpfungspunkt meiner Arbeit, aber nicht zu ihrem Objekt. Zum einen
waren die Straßenzüge, an denen die Arbeitssuchenden sich aufhalten,
ganz konkret der Ausgangspunkt für meine aktivistischen und akademischen Tätigkeiten und Kontakte. Zum anderen ist es aus wissensreflexiver Perspektive interessant, den Diskurs zum ‚Tagelöhnermarkt‘
zu untersuchen. Darin kann ich auch meine eigene Involvierung reflektieren. Und schließlich veranlasst die Auseinandersetzung mit dem
37
�selbstorganisierten Arbeitsmarkt als sozialer Formation, vereinfachte Vorstellungen aufzugeben und von verschiedenen Gleichzeitigkeiten auszugehen. Es handelt sich um ein doppelten Antagonismus: Der
selbstorganisierte Arbeitsmarkt ist mitten in der Gesellschaft und in
sie verwobener Teil – die Vorstellung, er sei außerhalb, einheitlich, abgeschlossen, anders, fremd ist aber gleichzeitig eine Grundlage seiner
Existenz. Zudem ist er gleichzeitig Arbeitskampf und Ausbeutungstechnologie und somit tief in die Widersprüche des Kapitalismus verstrickt.
Von diesem komplexen Verständnis des selbstorganisierten Arbeitsmarktes ausgehend interessiere ich mich aber vor allem für die Versuche des Regierens, die am ‚Tagelöhnermarkt‘ aufeinandertreffen und
die EU-migrantischen Arbeiter*innen zum Objekt haben. Versuche des
Regierens definiere ich hier hilfsweise und in Anschluss an foucauldianische Ansätze als die vielfältigen Praktiken, Strategien und Rationalitäten, die menschliches Verhalten zu ändern, verbieten, lenken oder
fördern suchen, um „wünschenswerte Zustände“ (Rose, 2000: 10) wie
zum Beispiel Sicherheit, Freiheit, Wirtschaftswachstum, Gesundheit
oder Stabilität zu erreichen (vgl. Foucault, 1987; Lemke, 1997; Pieper &
Gutiérrez Rodríguez, 2003; Rose, 2000).
Hilfreich erscheint mir auch das Konzept von policy, wie es in der anthropology of policy, insbesondere von Susan Wright und Cris Shore
(2011), ausbuchstabiert wurde:
„Policies are not simply external, generalised or constraining forces,
nor are they confined to texts. Rather, they are productive, performative and continually contested. A policy finds expression through sequences of events; it creates new social and semantic spaces, new sets
of relations, new political subjects and new webs of meaning.“ (Shore
& Wright, 2003, 2011: 1)
Mit Michel Foucault gehe ich davon aus, dass Versuche des Regierens
untrennbar mit spezifischen Macht-Wissen-Komplexen zusammenhängen, das heißt, mit verschiedenen Rationalitäten und Vorstellungen von
der Welt, ihren Problemen und möglichen Lösungen. Von Versuchen des
Regierens spreche ich, um zu betonen, dass diese nie genau das erreichen, was sie anstreben (falls sie ein definiertes Ziel haben), sondern
Teil von Aushandlungsprozessen und Auseinandersetzungen sind.
38
�Den Staat verstehe ich mit dem marxistischen Theoretiker Nicos Poulantzas, als kontingente, materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen, also weder als unabhängigen Akteur noch als Instrument in der
Hand der herrschenden Klasse, sondern als „sowohl Kristallisationspunkt als auch Ort der Klassenauseinandersetzungen“ (Karakayalı &
Tsianos, 2002: 262), der eine relative Autonomie besitzt. Versuche des
Regierens gehen aber nicht nur auf Staatsapparate (vgl. Althusser, 1977)
zurück, sondern auf eine Vielfalt von Akteurskonstellationen aus (internationaler) Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, etc. und sind in
einem foucauldianischen Machtverständnis auch nicht auf die Praktiken
individueller Akteure – seien es Personen oder Institutionen zu reduzieren.
Michel Foucault macht verschiedene, an spezifische historische Konjunkturen geknüpfte Technologien des Regierens aus. Er wendet sich
gegen eine juridische Konzeption von Macht und die Repressionshypothese, die Regieren nur als Unterdrückung, Verbot und Beschränkung
begreifen lassen und betont die produktiven Aspekte des Regierens (vgl.
Foucault, 1983; Lemke, 1997: 99ff., 129ff.). Ich greife unter anderem auf
sein Konzept der Biopolitik zurück, denn es hilft, die Fragmentierung
des Sozialen, die zwischen guten und schlechten Teilen der Gesellschaft
unterscheidet (vgl. Lemke, 1997: 134f.; Pieper, Atzert, Karakayalı & Tsianos, 2011), ins Auge zu nehmen. Nach Michel Foucault (1999) versuchen biopolitische Technologien des Regierens, das Leben der Bevölkerung zu fördern – auch, indem sie im Sinne des Schutzes des Lebens
nicht-lebenswertes Leben konstruiert, abspaltet und ‚sterben lässt‘.
Foucault verkürzt dies auf die Formel „Leben machen und sterben lassen“ (Foucault, 1999; vgl. auch Pieper & Gutiérrez Rodríguez, 2003). Die
Bio-Macht hat nach Foucault zwei Pole: die Disziplinierung der Körper
und die Regulierung der Bevölkerung (vgl. Foucault, 1987). Mit dem Begriff der Disziplinierung beschreibt er, wie Institutionen wie z.B. Schule, Gefängnis oder Fabrik „Wahrnehmungsformen und Gewohnheiten“
(Lemke, 1997: 73f.) konstituieren und strukturieren, mit dem Ziel der
effektiven Nutzung und optimalen Kontrolle der Körper (vgl. ebd.). Die
Regulierung des Bevölkerungskörpers hingegen strebt nach „der Sicherheit des Ganzen […] nicht durch individuelle Dressuren, sondern durch
ein globales Gleichgewicht“ (Foucault, 1999: 288). Ein weiteres foucauldianisches Konzept ist die Gouvernementalität, die Verquickung des Regierens mit Technologien der Selbstführung (vgl. Lorey, 2012; Pieper &
39
�Gutiérrez Rodríguez, 2003). Es erlaubt, das Verhältnis von Subjektivierung und Staat bzw. Machttechnologien in den Blick zu nehmen. Die
produktive Bio-Macht und ihre Technologien grenzt er von der negativ-restriktiven Souveränitätsmacht ab, die über Verbote und Rechte auf
Rechtssubjekte zugreift und ihnen Produkte, Güter und Dienste (vgl.
Lemke, 1997: 135) entzieht und ihre Handlungsräume beschneidet. Dadurch wendet er sich gegen die Repressionshypothese, die nur letztere
greifbar macht. In Anschluss an Foucault ist viel Aufmerksamkeit darauf
gerichtet worden, wie neoliberale Regierenstechnologien unternehmerische Individuen herstellen (wollen) (vgl. etwa Bröckling, 2013; Lanz,
2009; Rose, 2000). Neoliberales Regieren sucht das rationale Prinzip für
die Regulierung und die Begrenzung des Regierungshandelns nicht
mehr in der natürlichen Freiheit, die es zu respektieren gilt, sondern
findet es in einer künstlich arrangierten Freiheit: „in dem unternehmerischen und konkurrenziellen Verhalten der ökonomisch-rationalen Individuen“ (Lemke, 1997: 236). Loïc Wacquants Analysen der Rolle der
Sicherheitsapparate, vor allem der Gefängnisse in den USA, betonen
dagegen die zentrale Rolle des Strafens im neoliberalen Regieren. Bigo
(2008) zeigt, wie sich das Feld der Sicherheitspolitik – bzw. die „Politiken
der Unsicherheit“ transformiert bzw. transnationalisiert und spricht von
„globalized (in)security“. Im zweiten Kapitel werde ich näher auf Isabel
Loreys Theorie der Prekarisierung als gouvernementaler Regierenstechnologie, die soziale Sicherheit zu minimieren sucht, eingehen.
Die Verschiebung der Skalen und Akteure sowie das Netzwerkhafte
aktueller Formen der Macht wird auch in den Debatten zu governance
aufgegriffen, auch wenn diese oft im Positivismus verharren und politikberatende Perspektiven einnehmen. Governance wird als Versuch gehandelt, Probleme unter Einbeziehung bzw. Schaffung eines Netzwerks
an gesellschaftlichen Akteuren unterschiedlicher Ebenen zu lösen. Es
geht dabei um die Einbindung vielfältiger Interessen unter der Vorstellung, dass eine pragmatische Einigung und effektive Lösung innerhalb
des abgesteckten Rahmens möglich ist, wobei tiefgreifendere Antagonismen ausgeblendet werden (vgl. Shore, 2009; Walters, 2004).
In Anschluss an den poststrukturalistischen Denker Gilles Deleuze wird
zudem noch die Regierungstechnologie der Kontrolle ausgemacht, die
auf Fragmentierung, Sortierung und Modularisierung beruht (vgl. Deleuze, 1992; Kurz, 2012; Walters, 2006).
40
�Bis hierher habe ich anhand der Figur des ‚Tagelöhnermarktes‘ und der
sozialen Formation des selbstorganisierten Arbeitsmarktes eine rassismus- und kapitalismusanalytisch informierte Perspektive der Kämpfe
entwickelt, die ökonomistische und deterministische Ansätze zu überwinden sucht. Aus dieser Perspektive möchte ich nun nach den Versuchen des Regierens in einer Reihe von Aushandlungszonen fragen.
Fragestellung und Ausblick auf die Kapitel
In diesem Buch geht es darum, wie EU-interne Migration in München
regiert wurde und in welchen Prozessen die Verhältnisse der EU-internen Migration und die Versuche, sie zu regieren, ausgehandelt wurden.
Ich möchte so auch einen Beitrag zum Verständnis des aktuellen Migrations- und Grenzregimes leisten, der aber schon alleine deswegen nicht
mehr als ein Fragment eines größeren kritischen Wissensprojektes sein
kann, weil die Auseinandersetzungen um EU-Migration nicht isoliert,
sondern nur in ihrem Verhältnis zu den Kämpfen um (Flucht-)Migration
in die EU hinein und zu weiteren sozialen Dynamiken und Antagonismen verstanden werden können27.
Ich frage also: Welche Versuche des Regierens waren in die lokalen
Auseinandersetzungen um den ‚Tagelöhnermarkt‘ und die EU-interne
Migration in München involviert? Welche Akteure, Diskursfiguren,
Konfliktlinien und Praktiken ließen sich erkennen? Zu welchen Brüchen
und Transformationen kam es und wie entstanden Probleme, Begriffe,
Rationalitäten und Praktiken in den Auseinandersetzungen um die EUinterne Migration? Inwiefern haben sich Rassismen artikuliert und wie
haben sie sich mit Ausbeutungs- und Machtverhältnissen verschränkt?
Welche Rolle spielten Europäisierungs- und (Re-)Nationalisierungsprozesse dabei? Wie wurde EU-interne Migration in München regiert?
Ich bin in meiner Forschung den verschiedensten Versuchen des Regierens des ‚Tagelöhnermarkts‘ und der EU-internen Migration begegnet.
27
Hier möchte ich die Forschungen von Veit Schwab (University of
Warwick) und Raia Apostolova (Central European University) erwähnen, die
die kategoriale Trennung zwischen ‚Flucht‘ und ‚Arbeitsmigration‘ in den Blick
nehmen. Unsere gemeinsamen Diskussionen haben viel zu der vorliegenden
Arbeit beigetragen und ich kann es kaum erwarten, ihre Dissertationen zu lesen.
41
�In den sieben Kapiteln dieser Arbeit werde ich auf einige dieser Auseinandersetzungen näher eingehen und Transformationsprozesse nachvollziehen. Die jeweiligen Aushandlungszonen sind an unterschiedlichen Orten, auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen
Zeiträumen angesiedelt. Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, direkte kausale Verhältnisse zwischen den verschiedenen Prozessen nachzuweisen.
Die Kapitel sind also in keiner speziellen konsekutiven oder kausalen
Folge zu lesen; sie stehen vielmehr nebeneinander – auch wenn immer
wieder Verschränkungen, Resonanzen und Verbindungen deutlich werden. Sie tragen zu verschiedenen Debatten bei und können durchaus
auch einzeln gelesen werden.
Nach dem ersten Kapitel, in dem ich mit Konflikt als Methode meine forscherische Herangehensweise vorstelle und reflektiere, beschreibe ich
im zweiten Kapitel einen im Jahr 2014 ausgefochtenen Arbeitskampf vierer Reinigungsarbeiterinnen sowie ihr über zwanzigjähriges transnationales Migrationsprojekt zwischen München und der Provinzhauptstadt
Pazarjik in Bulgarien. Der gerichtliche und außergerichtliche Kampf der
vier Frauen um vorenthaltene Löhne ermöglicht den Blick auf ihre Arbeitsverhältnisse im Reinigungsgewerbe und die (Un-)Möglichkeit gerichtlicher Auseinandersetzung. Aus der Perspektive ihrer Kämpfe gehe
ich kurz auf die Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse im
postsozialistischen Bulgarien und auf die sie betreffenden Transformationen des europäischen Migrationsregimes ein. So werden die Auseinandersetzungen um EU-interne Migrant*innen in München historisch,
sozial und ökonomisch kontextualisiert.
Im dritten Kapitel analysiere ich, wie die hegemoniale Deutung des
‚Tagelöhnermarkts‘ zwischen den Jahren 2010 und 2013 umkämpft und
verschoben wurde. Dabei untersuche ich 23 Medienartikel zum ‚Tagelöhnermarkt‘ oder ‚Arbeiterstrich‘ in München und kontextualisiere sie
mit Ereignissen und anderem diskursivem Material. Zuerst zeichne ich
den Kampf um Hegemonie anhand der Schlüsselereignisse nach, wobei
es auch um die Rolle meiner eigenen Wissenspraktiken als Aktivistin
der Initiative Zivilcourage gehen wird. In einem zweiten Schritt untersuche ich die Medienberichte als „Assemblage des Rassismus“ (Tsianos
& Pieper, 2011) und „Spektakel des ‚Anderen‘“ (Hall, 2004) auf rassistische Stereotypen und Logiken. Bemerkenswert ist, dass hier zugleich
alte, brachiale Stereotypen des Rassismus zum Ausdruck kamen, die
mit Hautfarbe, Hygiene, etc. argumentierten, und subtilere, flexiblere,
42
�postliberale Formen des Rassismus. So betonen liberale Stimmen, dass
die meisten ‚Tagelöhner*innen‘ erfolgreich nach Arbeit suchten, es aber
trotzdem eine ‚Schattenseite‘ gäbe, die es zu bekämpfen gelte. Ich werde
diese Assemblage des Rassismus analysieren und nachverfolgen, wie sie
zu einer „urbanen Panik“ (Tsianos & Pieper, 2011) geführt haben, die
zur Grundlage für repressive und konservative Versuche des Regierens
wurde.
Im vierten Kapitel geht es dann um practices of security (vgl. Bigo, 2002;
Fassin, 2012), die den ‚Tagelöhnermarkt‘ und die ‚Tagelöhner*innen‘
zum Sicherheitsproblem gemacht haben. Welche konkreten Sicherheitspraktiken und -diskurse lassen sich erkennen und was sind ihre Effekte?
Zum Ausgangspunkt nehme ich eine Zollrazzia am ‚Arbeiterstrich‘ im
Oktober 2013, während der die Kontrollierten mit neongrünen Armbändern markiert wurden. Diese Razzia war ein direkter Effekt der im zweiten Kapitel beschriebenen „urbanen Panik“ (Tsianos & Pieper, 2011),
die auch ranghohe konservative Politiker alarmiert hatte. Praktiken der
Polizei und des Zolls gehörten aber auch zum Alltag des selbstorganisierten Arbeitsmarkts. Polizeibeamt*innen kontrollierten Personalien,
verhafteten Personen, erteilten Platzverweise, forderten zum Gehen auf
oder zeigten einfach nur Präsenz. Zudem schaue ich mir anhand des
städtischen Sicherheitsberichts von 2013 und weiterer städtischer Dokumente an, wie die Kommunalpolitik den ‚Tagelöhnermarkt‘ und ‚Armutszuwanderung‘ als Sicherheitsproblem rahmte. Es zeigt sich, dass
den Sicherheitsbeamt*innen und Kommunalpolitiker*innen der ‚Tagelöhnermarkt‘ als Gefahr für den ‚sozialen Frieden‘ und die ‚positive Diversität‘ des Bahnhofsviertels gilt und wie diese Zuschreibungen und
Versuche des Regierens Hand in Hand greifen. Es zeigt sich auch, wie
die Problemdefinitionen umkämpft wurden und die Lösungsversuche
schwankten. Ich argumentiere, dass es zu kurz greift, die Sicherheitspraktiken als repressiv zu betrachten, sondern dass nach ihrer Produktivität zu fragen ist. Sie siebten aus, „dämm[t]en ein“ (Interview mit Polizeibeamten), sorgten für rassistisch definierte Ordnung und Sauberkeit
im öffentlichen Raum und koproduzierten Deutungsmuster und urbane
Raumordnungen.
Im fünften Kapitel geht es darum, was passiert, wenn obdachlose
Unionsbürger*innen in München ihre Unterbringung in eine städtische Notunterkunft beantragen, wie die Trennlinie zwischen ‚unseren‘ Obdachlosen und obdachlosen Nicht-Münchner*innen kommunal
43
�ausgehandelt wird, welche Politiken und Praktiken damit einhergehen
und wie diese wiederum die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der EUMigrant*innen beeinflussen. Die städtischen Akteure haben in der Obdachlosenpolitik viel Handlungsspielraum und in den letzten Jahren
haben tiefgreifende Auseinandersetzungen stattgefunden, so dass sich
die kommunalen Rationalitäten gut nachvollziehen lassen. Ich untersuche einige Schlaglichter: Konflikte beim Antrag auf Notunterbringung,
interne Dienstanweisungen des Amtes für Wohnen und Migration, die
Argumentationsmuster des Leiters dieses Amtes sowie Berichte und
Beschlussentwürfe, die im Münchner Stadtrat diskutiert wurden. Ich
zeichne damit eine knappe Genealogie der Münchner Wohnungslosenpolitik gegenüber Unionsbürger*innen zwischen den Jahren 2006 und
2014 und analysiere sie auf ihre vorherrschenden Rationalitäten. Verschiedene Logiken stehen in Aushandlung und verschränken sich: Das
Aktivierungsparadigma des workfare, die Versicherheitlichung der ‚Armutszuwanderung‘, Konstruktionen der Münchner Stadtbürgerschaft
und die Suche nach humanitären Notlösungen.
Im sechsten Kapitel geht es um die Aushandlungen des Anspruchs nichterwerbstätiger Unionsbürger*innen auf Sozialleistungen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH). Der EuGH hat zwischen 1998 und 2015
eine Reihe von 13 Urteilen gefällt, die maßgeblich daran beteiligt waren,
dass auch nicht erwerbstätige Unionsbürger*innen Anspruch auf Sozialleistungen haben können. Die Forderung nach einer sozialen Union
schien zeitweise einen mächtigen Unterstützer gefunden zu haben und
in Reichweite gerückt zu sein. Statt soziale Rechte als Grundrechte zu
etablieren, folgte die Rechtsprechung allerdings eher den Prinzipien der
Aktivierung und der Verhältnismäßigkeit. Der Siegeszug des Begriffs
‚Sozialhilfebetrug‘ um das Jahr 2013 – angetrieben durch die populärnationalistischen Debatten in den Mitgliedsstaaten – sollte die Kräfteverhältnisse und Diskurskonstellationen dann aber kräftig in Richtung
nationaler Wohlfahrtssouveränität verschieben.
Das siebte Kapitel geht von einer Stellungnahme des Deutschen Städtetages vom Januar 2013 aus, die vor der Bedrohung des ‚sozialen Friedens‘
in den Städten durch die ‚Armutszuwanderung‘ warnte. Das Papier des
Städtetages, das urbane soziale Verhältnisse rassifizierte und skandalisierte, hat sowohl die sogenannte Armutszuwanderungsdebatte in den
Medien wie auch einen Gesetzgebungsprozess eingeleitet, der zur Verschärfung des Freizügigkeitsgesetzes/EU im Jahr 2014 führen sollte. Es
44
�problematisierte nicht die Armut von EU-Migrant*innen, sondern die
sogenannte ‚Armutszuwanderung‘ als Problem und Bedrohung. Anschließend untersuche ich anhand von verschiedenen Konflikten mit
Ausländerbehörde und Jobcenter sowie anhand von Interviews mit
Vertretern dieser Behörden, die im Zeitraum 2012-2013 stattgefunden
haben, wie die EU-europäischen und deutschen Regelungen von Freizügigkeit und Unionsbürgerschaft in die kommunale Amtspraxis hineinwirkten, wie sie sich brachen und wie sie von den kommunalen Akteuren ausgelegt wurden. Ich zeige, wie diese kreativ mit dem Widerspruch
zwischen nationalstaatlicher Exklusion und EU-europäischer Inklusion
umgingen, indem sie den Fluchtlinien des workfare folgten und aus der
Unionsbürgerschaft eine Aktivierungs-, Selektions- und Abwehrtechnologie machten.
In der Zusammenschau dieser sieben Kapitel erlaubt diese Arbeit in konkreten Auseinandersetzungen verwurzelte Einblicke in die Turbulenzen
und Widersprüche der aktuellen gesellschaftlichen Transformationen,
wie sie im EU-europäischen Projekt und in den urbanen Migrationsregimen ihren Ausdruck finden. Es zeigt sich, wie verschiedene Akteure des
Regierens auf die Bewegungen der freizügigen EU-Migration reagieren
und versuchen, Migration und urbane Bevölkerung auch ohne Kontrolle
an nationalen Außengrenzen zu regieren.
Bis hierher habe ich am Beispiel der Aushandlungen am und um den
‚Tagelöhnermarkt‘ die Perspektive, das Interesse und die Felder der vorliegenden Arbeit umrissen sowie einige zentrale Konzepte eingeführt.
Bevor ich also anhand von konkretem ethnografischen Material in die
Debatten eintauche, stellt sich noch die Frage nach den Methoden und
der Methodologie dieses Forschungsprojektes.
45
�46
�Konflikt als Methode – Ein Ansatz zwischen
Wissenschaft und Aktivismus
Ethnographic research revisited
„Imagine yourself suddenly set down surrounded by all your gear, alone on a tropical beach close to a native village, while the launch or
dinghy which has brought you sails away out of sight.“ (Malinowski,
2002: 45)
Wenn ich am Anfang dieser Arbeit beschreibe, wie ich alleine, nur
mit Flyern bewehrt, auf einem Bordstein im Bahnhofsviertel saß und
es zur ersten unbeholfenen Kommunikation mit EU-migrantischen
Arbeiter*innen kam, spiele ich an auf den Mythos der ethnografischen
‚Begegnung mit dem Fremden‘ à la Bronislaw Malinowski, den sogenannten ‚Vater der Feldforschung‘, dessen hier zitierte Ankunftsszene nicht
nur von Generationen kulturanthropologischer Erstsemester*innen
gelesen, sondern auch in vielen Einleitungen ethnografischer Texte reproduziert wurde. Dieses stilistische Mittel enthält nicht nur ein Augenzwinkern, ich möchte damit auch die Ambivalenzen und Fallstricke
einer ethnografischen, insbesondere einer eingreifend-ethnografischen
Forschung zum Thema machen und exotisierende Lesegewohnheiten
zum Stolpern bringen. Malinowski, wie den von ihm beeinflussten Generationen, ging es um eine möglichst dichte und genaue Beschreibung
‚fremder Lebenswelten‘, bzw. in seinen damaligen Worten, des ‚Stammeslebens‘. Er sah sich erst einmal vielfältigen Schwierigkeiten gegenüber:
„I was quite unable to enter into any more detailed or explicit conversation with them at first. I knew well that the best remedy for this was
to collect concrete data, and accordingly I took a village census, wrote
down genealogies, drew up plans and collected the terms of kinship.
But all this remained dead material, which led no further into the understanding of real native mentality or behaviour, since I could neither
47
�procure a good native interpretation of any of these items, nor get what
could be called the hand of tribal life.“ (ebd.: 46)
Ethnografische Forschung besteht nach dieser Darstellung zum einen
aus der Erhebung von konkreten Daten über die erforschte Gruppe,
zum anderen aus Kommunikation. Ziel ist es, die ‚eingeborene Mentalität‘ bzw. das ‚Stammesleben‘ zu verstehen. Auch heute geht es
oft noch darum, die ‚Mentalität‘ oder das Verhalten von ‚fremden
Kulturen‘ authentisch und echt zu beschreiben. Dieses Wissen ist gefragt. Im Frühjahr 2016 erreichte mich über den Verteiler des ethnologischen Instituts der Ludwig-Maximillians-Universität die Anfrage
einer christlichen Wohlfahrtsorganisation, die für eine Fortbildung
in der Flüchtlingsarbeit eine*n Ethnolog*in mit Expertise über „Reaktionsmuster, Erziehungsstile, Wertesysteme, Kommunikationsstile, Verhältnis Mann/Frau, Fluchtgründe, Fluchtrouten“ in Bezug auf
Syrien und Irak suchte. Im Sommer 2010 wurde ich von der Caritas
München angefragt, ob ich eine Auftragsforschung zum ‚Tagelöhnermarkt‘ machen könne. Ziel war, mit dieser Forschung das Thema
‚Tagelöhnermarkt‘ kommunalpolitisch auf den Tisch zu bringen und
so auch die Finanzierung einer neuen Beratungsstelle anzustoßen.
Nach einigem Hin und Her schrieb ich ein Angebot, welches schließlich abgelehnt wurde. Ob der Grund dafür darin lag, dass ich vor allem die Perspektiven und Forderungen der Arbeiter*innen festhalten
wollte, war nicht mehr herauszufinden. Die gleiche Stelle beteiligte sich 2012 an einer Forschungsreise, deren Ergebnis der Reisebericht „Die Koffer sind schon gepackt – Viele Bulgaren streben nach
München“ (Caritas, Malteser & Männerfürsorge, 2012) war. Der Bericht zeichnet ein düsteres Bild der Lebensverhältnisse der Roma in
Bulgarien und deutet diese als „Zwänge zur Arbeitsmigration nach
München“ (ebd.: 27). Einige Details dieses Berichts zeigen, dass Kulturen auch hier als Container, zwischen denen nur in historischen
Ausnahmefällen und unter Zwang ein Austausch stattfinden kann,
betrachtet werden. So zeigt der Bericht das Foto eines Kindes mit
blonden Haaren vor dem Hintergrund einer ungeteerten Straße und
kommentiert es wie folgt:
„Beim Anblick einiger blonder und blauäugiger Kinder im Roma Viertel drängt sich bei uns der Verdacht auf, dass es sich hierbei nicht um
48
�Relikte aus den Kreuzzügen handelt, sondern viel mehr die Prostitution dahinter steckt.“ (ebd.: 24)
Auch Malinowski wäre mit einer solchen Aussage wohl nicht einverstanden gewesen, da sie sich für die Sichtweise der Bewohner*innen
nicht interessiert, sondern alleine anhand von Beobachtungen (Augenund Haarfarbe) und ethnisierenden sowie heteronormativen Vorannahmen darauf schließt, dass der mutmaßlich blonde Vater des Kindes aus
dem Westen (als Kreuzzügler oder Freier) kommen müsse und nicht Teil
der Roma-Community sein könne. Der Grund für den Austausch zwischen den biologischen Elternteilen unterschiedlichen Phänotyps könne nur Gewalt bzw. ökonomische Not sein.
Gemeinsam ist diesen Repräsentationen und Forschungsanfragen zu
einzelnen Nationalitäten, zu dem ‚Tagelöhnermarkt‘ oder zu dem ‚Roma
Viertel‘ aber, dass sie sich für eine abgegrenzte soziokulturelle Formation interessieren und über diese objektives Wissen produzieren möchten, indem sie an einem Ort forschen, der mit der erforschten Gruppe
verschmolzen wird. Die Forschenden nehmen eine Position außerhalb
der fremden Einheit ein, auf die sie ihr Forschungsinteresse richten.
Forscher*innen und Forschungsobjekte kommen aus zwei getrennten
Welten und haben keinen Einfluss aufeinander. Spätestens mit der sogenannten Krise der Repräsentation und der writing-culture-Debatte
ist es innerhalb des Faches der Kulturanthropologie zu einer Kritik solcher Wissenspraktiken gekommen (vgl. Clifford & Marcus, 1986; Hymes, 1972; Tyler, 1987). Dabei ging es nicht nur um Fragen, wie und
mit welchen Methoden Kulturen bzw. soziale Formationen und Verhältnisse zutreffend dargestellt werden können. Insbesondere feministische
und postkoloniale Kritiken haben herausgestellt, dass Wissenschaften
im Allgemeinen und die Kulturanthropologie im Speziellen zu kolonialen, nationalistischen, paternalistischen und dichotomen Konstruktionen des ‚Fremden‘ und des ‚Eigenen‘, des ‚Westens‘ und des ‚Orients‘
beigetragen haben und dies auch immer noch tun (vgl. Restrepo &
Escobar, 2005; Stacey, 1988). Auch die Kulturanthropologinnen Sabine
Hess und Maria Schwertl (2013) haben sich in die Debatte um kulturanthropologische Methoden eingemischt. Sie sehen neben dem ethnologischen Feldbegriff noch drei weiter methodologische Probleme des
Ethnografierens: erstens den Prozess des ‚Othering‘ – die Konstruktion des Anderen, des Fremden. Damit einher ginge ein „theoretischer
49
�und methodischer Kulturalismus, welcher kulturell homogene Gruppen
imaginiert und essenzialisierend festschreibt“ (Hess & Schwertl, 2013).
Zweitens kritisieren sie das Herausschreiben der „Beobachtungseffekte“
(ebd.) aus ethnografischen Texten: Eingriffe, die schon alleine durch die
Anwesenheit des Forschenden geschähen, würden selten thematisiert.
Dies ist eng verknüpft mit dem dritten Problem: Indem ethnografisches
Schreiben ein kohärentes Narrativ vom auktorialen Selbst konstruiert,
würden die vielfachen Begegnungen und Erfahrungen des Forschungsprozesses vereinfacht sowie Komplexität und körperliche Erfahrungswelten reduziert. Die Problematik ethnografischer Konstruktion fassen
sie folgendermaßen zusammen:
„Ethnografien übersetzen im Forschungsprozess unmittelbar Erlebtes,
Gehörtes, Gesehenes, Empfundenes in eine Argumentation, die sich
auf Grundannahmen und Konventionen innerhalb der (Europäischen)
Ethnologie genauso beziehen wie auf andere gesellschaftliche Normierungen und (hegemoniale) Anrufungen.“ (ebd.)
Aus diesen Überlegungen ergeben sich die folgenden Fragen: Wie kann
eine ethnografische Forschung aussehen, die sich nicht auf eine klar abgegrenzte Gruppe an einem Ort konzentriert, soziokulturelle Figurationen nicht in Container steckt, verräumlicht und kulturalisiert, sondern
globale Verbindungen und transnationale Machtverhältnisse mit einbezieht? Wie können Ethnograf*innen mit ihren Forschungspartner*innen
zusammenarbeiten, statt Forschungsobjekte bzw. Informant*innen zu
instrumentalisieren? Wie können ethnografische Forscher*innen den
eigenen Blick in den vermachteten Aushandlungsfeldern situieren und
sich nicht als objektiven „gaze from above“ (Haraway, 1988) aus den Situationen hinaus schreiben? Wie kann die Konstruktion des auktorialen
Selbst und des Feldes transparent gemacht werden?
Um diese Fragen zu bearbeiten, muss ich das Rad nicht neu erfinden.
Es gibt zahlreiche neuere methodische und konzeptuelle Ansätze, wie
50
�ethnografisches Forschen aussehen kann. Zum einen wurden neue Forschungsrichtungen gesucht – weg von einem ‚studying down‘, hin zu
einem „studying up“ (Nader, 1969) oder „studying through“ (Shore &
Wright, 1997: 14). Mit gesteigertem Interesse an Prozessen der Globalisierung versuchen auch immer mehr Anthropolog*innen, die Lokalisierung von Feld und Kultur zu überwinden, indem sie im Sinne einer
„global ethnography“ (Burawoy, 2000) die Verschränkungen, Konnektivitäten und Wechselwirkungen zwischen Lokalem und Globalem in den
Fokus nehmen und konkrete soziale Formationen nicht mehr nur rein
lokal denken, sondern immer auch schon global und in Bewegung (vgl.
Weissmann, 2011). Für die Forschungspraxis kann das heißen, zu reisen, statt an einem Ort zu bleiben: „traveling not dwelling“ (Hess, 2005:
26). George Marcus spricht von einer „multisited ethnography“ (Marcus,
1995), Gisela Welz von „moving targets“ (Welz, 1998). Es geht aber nicht
nur darum, dass soziale Formationen und Dynamiken sich bewegen und
nicht auf einen geografischen Raum festzunageln sind. Vielmehr müssen auch translokale und globale Verbindungen und Wechselwirkungen
mit lokalen Situationen nachvollzogen werden, um aus ihnen Sinn zu
machen. Zudem kann eine solche Forschungsperspektive und -praxis,
die ihr potenzielles Feld soweit erweitert, dass sie ohne Zweifel niemals
alles erfassen kann, sichtbar machen, dass ethnografische Repräsentation immer konstruiert ist – Produkt der kreativen Entscheidungen der
Forschenden, die Verbindungen folgen und neue knüpfen, bruchstückhaft wahrnehmen, von ihren eigenen Vorannahmen, Interessen und
Begehren geleitet. Aus der Kritik der Ethnografie und besonders des
Feldbegriffs zu lernen, bedeutet also mehr, als an mehreren Orten und
reisend zu forschen. Im Folgenden möchte ich auf die ethnografische
Regimeanalyse, auf der ich meinen methodologischen Ansatz aufbaue,
eingehen. Sie versucht, „die Konstruktivität gezielt zu nutzen“ (Hess &
Schwertl, 2013).
Regime als ontologisches Konzept28
Von den Aufbrüchen in der ethnografischen Forschungsmethodologie
ausgehend hat die transdisziplinäre Forschungsgruppe des Projekts
28
Vorarbeiten zu den in diesem Kapitel ausgeführten Überlegungen finden sich in Riedner & Weissmann, 2013 und in Riedner, 2014.
51
�TRANSIT MIGRATION29 (vgl. TRANSIT MIGRATION Forschungsgruppe, 2007) die ethnografische Migrations- und Grenzregimeanalyse entwickelt, die, wie der Name schon sagt, Regime analysiert. Mit der Forschungsgruppe begreife ich Regime als Aushandlungsfelder, in denen
die verschiedensten Praktiken und materielle und diskursive Strukturen
interagieren:
„Unter Regime verstehen wir also ein Ensemble von gesellschaftlichen
Praktiken und Strukturen – Diskurse, Subjekte, staatliche Praktiken
– deren Anordnung nicht von vorneherein gegeben ist, sondern das genau darin besteht, Antworten auf die durch die dynamischen Elemente und Prozesse aufgeworfenen Fragen und Probleme, zu generieren.“
(Karakayalı & Tsianos, 2007: 14)
Diese Aushandlungsfelder sind nicht allein lokal zu erklären, sondern
stehen in Verbindung und im Verhältnis zu Diskursen, Prozessen und
Konstellationen, die räumlich weit vernetzt sind. Ein Regime beinhaltet sowohl die Versuche des Regierens wie auch Auseinandersetzungen
um sie und Widerstandsbewegungen gegen sie. Weil der Regimebegriff
Konflikte, Machtdynamiken und Veränderung betont, kann ich mit ihm
gut nach politischen Auseinandersetzungen in ihrer Komplexität, Widersprüchlichkeit und Kontingenz fragen30. Aus der Regimeperspektive
betrachtet sind die erforschten Realitäten ständig ausgehandelt und als
Aushandlungsfelder sowohl von sedimentierten Konzepten und Materialitäten wie auch von Brüchen, Unfällen und improvisierten Reparaturarbeiten durchzogen:
„It is [...] a mix of implicit conceptual frames, generations of turf wars
among bureaucracies and waves after waves of ‚quick fix‘ to emergencies, triggered by changing political constellations of actors. The
29
Die aus diesem Forschungsprojekt (und anderen kritischen, antirassistischen Projekten) entstandenen wissenschaftlichen Zusammenhänge, vor
allem das Netzwerk für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung (kritnet) und die hier entwickelten Perspektiven, Haltungen und Analysen haben
mein Promotionsprojekt nachhaltig beeinflusst.
30
Ich bevorzuge den Regimebegriff deswegen auch gegenüber anderen
ontologisch-methodologischen Konzepten wie Assemblage (vgl. Ong & Collier,
2005; Schwertl, 2015), actor-network (vgl. Latour, 2005) oder space (vgl. Massey,
2005).
52
�notion of a migration regime allows room for gaps, ambiguities and
outright strains: the live of a regime is a result of continuous repair
work through practices.“ (Sciortino, 2004: 32)
Ethnografische Regimeanalysen nutzen dabei intensiv foucauldianische
Begriffe wie Technologien des Regierens, Subjektivierung oder das Dispositiv, das relativ eng an dem Begriff des Regimes liegt. In Dispositiven
verknüpfen sich nach Michel Foucault Machttechnologien (vgl. Lemke,
1997: 137), die aus diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken und Vergegenständlichungen (z. B. Dokumente oder Gebäude) sowie deren Verhältnis zueinander bestehen. In Bezug auf Subjektivierung hat Foucault
diskutiert, wie Menschen zu spezifischen Subjekten (gemacht), also subjektiviert werden und wie Subjekte in ihre eigene Subjektivierung eingreifen können (vgl. Foucault, 1983, 1992).
Um Veränderung und Prozesse des Werdens denken zu können, macht
der Regimebegriff unter anderem Anleihen bei Gilles Deleuze und Félix
Guattari, die eine ständige Bewegung zwischen der Territorialisierung
und Deterritorialisierung von Dynamiken, ein Hin und Her zwischen
Verfestigung in „gekerbte“ und Verflüssigung in „glatte Räume“ beobachten (Deleuze & Guattari, 1997):
„Die Kerbung ist ein Vorgang, bei dem der gelebte Raum reterritorialisiert, d. h. zählbar, regierbar und planbar gemacht wird. Dagegen beinhaltet der transnationale Raum Momente der Deterritorialisierung,
in denen die MigrantInnen jenen oben beschriebenen Verengungen
gleichsam ‚fliehen‘. Diese Flucht und die institutionalisierten Versuche, die Flucht zu ‚Binden‘, sie zu regulieren und in Bahnen zu lenken,
konstituieren den Raum der Migration. Deterritorialisierung hängt auf
diese Weise intrinsisch mit Reterritorialisierung zusammen.“ (Tsianos
& Karakayalı, 2008: 331)
Wichtig erscheint mir zudem noch der (post-)operaistische, (post-)marxistische Dreh des Regimebegriffs, der gesellschaftliche Antagonismen
als Hintergrund sozialer Dynamiken begreift und die Kämpfe der (migrantischen) Arbeiter*innen als deren Erstbeweger setzt (vgl. das Unterkapitel Die relationale Autonomie von Migration und Arbeiter*innen
der Einleitung). Das hier skizzierte Verständnis von Veränderung ermöglicht, politische (Widerstands-)Praxis nicht auf das Stellen von
53
�Forderungen durch eine sich in Relation zum Staat identifizierende
Gruppe zu reduzieren, sondern auch (Alltags-)Praktiken des Entziehens
und Entfliehens als politisch zu begreifen, worauf ich im dritten Kapitel
noch näher eingehen werde.
Wie schon deutlich geworden ist, fußt der Regimebegriff auf einem radikal sozialkonstruktivistischen Standpunkt: Kategorien wie ‚Migration‘
sind den Regimen nicht vorausgesetzt, sind keine objektive Abbildung
von Wirklichkeit, sondern werden in komplexen Verflechtungszusammenhängen gesellschaftlich ausgehandelt. Sie können nicht nur als Produkt dieser Aushandlungen betrachtet werden, sondern „Wissen wirkt“
(Riedner, 2014). Dies wurde auch unter dem Stichwort ‚Performativität‘
von Judith Butler – etwa in Hinsicht darauf, wie die gesellschaftlichen
Vorstellungen von Geschlecht (gender) das ‚Körpergeschlecht‘ (sex) diskursiv erzeugt (Butler, 2010) – beschrieben (vgl. Riedner, 2014; Riedner
& Weissmann, 2013). Weiter oben ist schon die Wirkmächtigkeit der
Figur des ‚Tagelöhnermarkts‘ und der Begriffe des ‚Feldes‘ und der ‚Kultur‘ deutlich geworden. Hier möchte ich noch ein weiteres Beispiel nennen: Das ‚Individuum‘ bzw. die liberale Vorstellung, individuelle Personen seien die zentralen willentlich handelnden Entitäten, die durch ihre
Handlungen die Welt verändern, ist ein liberales Konstrukt, das auch in
den von mir untersuchten Regimen wirkmächtig ist. „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“, so begründete der Leiter des Amtes für Wohnen und Migration die restriktive Unterbringungspolitik in München im
Interview. Es gilt, eine Forschungsperspektive zu entwickeln, die sichtbar macht, dass Subjekte von Affizierungen, Affekten und Ideen geprägt
sind und dass sie in ihrer Subjektivierung stetig Teil gesellschaftlicher
Prozesse sind – Aushandlungslinien durchziehen sie und gehen über sie
hinaus (vgl. Pieper; Panagiotidis & Tsianos, 2009).
Wenn Wissen wirkt, kann auch der bzw. die Forscher*in sich nicht aus
den Aushandlungsfeldern bzw. Regimen hinausziehen, sondern ist Teil
von ihnen. Im Sinne neuerer, radikal konstruktivistischer oder neomaterialistischer Ansätze (vgl. Casas-Cortés, 2009: 93) gilt es dann, das
notwendige Wirken nicht nur als Nebenprodukt des Forschens, das es
möglichst zu vermeiden gelte, um das Forschungsergebnis nicht zu verfremden, zu betrachten, sondern zu einem proaktiven, reflexiven Umgang mit dem unvermeidlichen Wirken zu finden (vgl. Casas-Cortés,
2009; Escobar, 2007; Riedner & Weissmann, 2013; Weissmann, 2011). Die
54
�beiden Soziologen John Law und John Urry bringen dies mit der Idee der
ontological politics auf den Punkt:
„First, we argue that social inquiry and its methods are productive: they
(help to) make social realities and social worlds. They do not simply
describe the world as it is, but also enact it. Second, we press some of
the implications of this claim. In particular, we suggest that, if social
investigation makes worlds, then it can, in some measure, think about
the worlds it wants to help to make. It gets involved, in other words, in
the business of ‚ontological politics‘.“ (Law & Urry, 2004: 390 f.)
Die ethnografische Regimeanalyse
Das Forschungsinteresse der ethnografischen Regimeanalyse im radikal
konstruktivistischen Sinne gilt der Produktivität und nicht der Wahrheit von Konzepten und der Aushandlung von multiskalaren Realitäten.
Dabei wird auch die eigene Forschungs- und Wissenspraxis in den Aushandlungsfeldern produktiv, in denen sich der oder die Ethnograf*in
positioniert. Erkenntnistheoretisch muss die Wissenspraxis der Regimeanalyse dann nicht nur als beschreibendes, sondern auch als produktive
Tätigkeit begriffen werden, die das eigene ‚Feld‘ mit produziert:
„Es handelt sich um ein radikal konstruktivistisches Unterfangen, eine
erkenntnistheoretisch angeleitete Praxis der Konstruktion von Elementen und Akteuren und um ihr In-Beziehung-Setzen in einem von den
Forschenden selbst imaginierten, konstruierten Raum.“ (Hess & Tsianos, 2010: 253)
Welche Methoden kommen dabei aber konkret zur Anwendung? Sabine
Hess und Vassilis Tsianos schlagen für die Analyse von Grenzregimen
einen „heuristischen Methodenmix“ vor,
„bestehend aus einer ‚symptomatischen Diskursanalyse‘, ethnografischer teilnehmender Beobachtung und Gesprächen an verschiedenen
Orten sowie verschiedenen Formen von fokussierten Interviews“ (ebd.).
55
�In ähnlicher Weise habe auch ich verschiedene qualitative Methoden
angewendet. Etwas über ein Jahr (2010-2011) habe ich mit dezidiertem
Forschungsinteresse bei der Initiative Zivilcourage mitgearbeitet und
regelmäßig ein Forschungstagebuch geschrieben. Weitere zwei Jahre,
während derer ich schwerpunktmäßig als Aktivistin mit der Initiative
Zivilcourage aktiv war, habe ich spontan an bestimmten Situationen, die
für meine Forschung besonders relevant schienen und unter ethischen
Gesichtspunkten unproblematisch waren, als Forscherin teilgenommen
und Aufzeichnungen gemacht. Zwar habe ich mir durch die alltägliche Kommunikation mit türkischsprachigen Menschen (vor allem im
Workers’ Center) und einem einmonatigen Sprachkurs in Istanbul Türkischkenntnisse auf Anfänger*innenniveau angeeignet, für detaillierte
Gespräch und Interviews auf Türkisch war ich aber trotzdem auf Übersetzung angewiesen. In den Jahren 2010 bis 2013 habe ich fünfundzwanzig qualitative, offene Interviews mit verschiedenen Akteuren, denen
ich in den Aushandlungen begegnet bin, geführt und fast alle auf Band
aufgenommen, transkribiert und symptomatisch ausgewertet. Zudem
habe ich an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen, von denen ich
auch Audioaufzeichnungen gemacht habe, und Medienberichte sowie
weiteres diskursives Material gesammelt, wie zum Beispiel policy-papers auf Stadt-, Bundes- und EU-Ebene31.
Der innovative Einsatz der ontological politics besteht aber meiner Meinung nach weniger aus den Methoden an sich, sondern darin, wie sie
im Sinne des Konzepts des Regimes und der sich so ergebenden Erkenntnisinteressen eingesetzt und verstanden werden. Verlassen wird
nicht nur die Vorstellung des verräumlichten, in Gänze erklärbaren,
lokalisierten ‚Feldes‘, sondern auch der Standpunkt des/der forschenden Beobachter*in. Der/Die Forscher*in wird zum aktiven Teil in den
Prozessen des world making und konstruiert dabei auch das eigene Forschungsfeld mit.
31
Auf Interviews, Audioaufzeichnungen von Veranstaltungen, Tagebuchnotizen und schriftliches Forschungsmaterial, das nicht öffentlich zur Verfügung steht, verweise ich im Fließtext unter Angabe relevanter Details (z.B. in
welchem Monat und Jahr das Interview stattgefunden hat). Ich habe sie, auch
aus Gründen der Anonymität, aber nicht in die Literaturliste aufgenommen
oder extra aufgelistet. Das Forschungsmaterial ist bei mir passwortgeschützt
hinterlegt.
56
�Perspektive der Kämpfe und Konflikt als Methode
Als der Polizist in der Anfangsszene zu mir als Aktivistin sagte, dass
wir doch dasselbe wollen, nämlich Probleme lösen, wies ich diese Behauptung zwar vehement ab, es blieben aber Fragen: Was nehme ich
als akademische Wissensproduzentin (und als Aktivistin der Initiative
Zivilcourage) als Problem wahr – aus welcher Perspektive, aus wessen Perspektive? Worin sehe ich die Lösung dieser Probleme und wie
komme ich zu diesen Lösungsstrategien? Zwar sind die Perspektiven
einzelner Polizeibeamter sicher nicht zu verallgemeinern, im Kapitel
zu den practices of security am ‚Tagelöhnermarkt‘ wird sich aber trotzdem zeigen, dass die sicherheitsrechtlichen Akteure tendenziell eine
Perspektive des Regierens ‚von oben herab‘ einnehmen und dabei die
Arbeiter*innen als Gefahr für die öffentliche Sauberkeit, Sicherheit und
Ordnung begreifen, repressiv bekämpfen oder als Opfer von kriminellen
Menschenhändlern retten wollen. Wo liegt der Unterschied zwischen
den Problemdefinitionen aus der Perspektive des Regierens und denen
der Initiative Zivilcourage bzw. mir als Wissenschaftler*in? Was ist der
Unterschied zwischen Perspektiven des Regierens und Perspektiven der
Kämpfe?
An dieser Stelle möchte ich auf die These der Autonomie der Migration
zurückkommen und sie mit Serhat Karakayalı als Untersuchungsperspektive begreifen. Dieser schreibt im Schlussteil seines Buches Gespenster der Migration:
„Vor dem Hintergrund meiner Arbeit erscheint es sinnvoller, Autonomie der Migration nicht als Unabhängigkeit von etwas – Strukturen,
Machtverhältnissen etc. – zu konzeptionalisieren, sondern als eine
Untersuchungsperspektive, welche die der Migration eigenen Konfliktfelder und -formen in den Blick nimmt. Eine derart verstandene
Perspektive ermöglicht es, in den Kämpfen um Migration den methodologischen und politischen ‚Nationalismus‘ zu verlassen und sich in
der Politik der Migration auf die konkreten Praktiken der klandestinen
transnationalen Migrant*innen zu stützen anstatt auf die durch sie
vermeintlich verursachten ‚Probleme‘ oder auf das Leiden der MigrantInnen an den prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen in der Migration.“ (Karakayalı, 2008: 258)
57
�Es gilt also, von den Praktiken der Migrant*innen auszugehen, statt von
den Versuchen, sie zu problematisieren und zu regieren, um aus der
Perspektive der ersteren die letzteren analysieren zu können.
Desweiteren beziehe ich mich auf Sandro Mezzadra und Brett Neilson,
die in ihrem Buch Border as Method (2013) vorschlagen, die Grenze als
epistemologische Sichtweise zu verwenden. Sie meinen damit, dass es
durch die Aufmerksamkeit auf Verschiebungen, Konflikte und Brüche
gelingen kann, falsche Vereinheitlichungen wahrzunehmen, zu analysieren und anzugreifen:
„[T]o approach the border as a method means to suspend, to recall a
phenomenological category, the set of disciplinary practices that present the objects of knowledge as already constituted and investigate
instead the processes by which these objects are constituted.“ (Mezzadra & Neilson, 2013: 17)
Es handelt sich um eine geschickte Doppelbewegung, denn die Fokussierung auf Konflikte um Grenzen ist sowohl im epistemologischen Sinne (Grenzen von Kategorien und Diskursen), wie auch im ganz praktischen Sinne zu verstehen:
„the border is for us not so much a research object as an epistemological viewpoint that allows an acute critical analysis not only of how
relations of domination, dispossession, and exploitation are being redefined presently but also of the struggles that take shape around these
changing relations. The border can be a method precisely insofar as it
is conceived of as a site of struggle. As we have already stressed, it is
the intensity of the struggles fought on borders around the world that
prompts our research and theoretical elaborations.“ (ebd.: 16 f.)
Dem Buch Border as Method ist zudem die These zentral, dass Grenzen
sich trotz der aktuellen Transformationen des national-sozialen Staates
nicht auflösen, sondern rekonfigurieren und multiplizieren (ebd.).
Ich habe eine Perspektive der Autonomie der Migration, der Grenze und des Konflikts eingenommen, indem ich mich ganz konkret mit
den Kämpfen und Praktiken der migrantischen Arbeiter*innen positioniert habe und so in Konflikte mit den Versuchen des Regierens und
58
�den von ihnen gezogenen Grenzen (sowohl im kategorialen, rechtlichen
wie auch territorialen Sinne) gekommen bin. So bin ich auf Brüche, Widersprüche und produktive Auseinandersetzungen gestoßen, die ich
dann in meiner Analyse nachverfolgen konnte. Bevor ich konkreter
auf meine Forschungspraxis und die Spannungsfelder, in denen sie sich
bewegt hat, eingehe, möchte ich noch der Frage nachgehen, inwiefern
es denn überhaupt möglich ist, zu wählen, welche Perspektive ich einnehme. Schließlich bin ich nicht in der Situation der EU-migrantischen
Arbeiter*innen. Meine gesellschaftliche Positionierung ist sogar eher
mit den Polizist*innen oder städtischen Entscheidungsträger*innen zu
vergleichen: weiß, deutsche Staatsbürgerschaft, bürgerlich. Kann ich da
überhaupt eine Perspektive der Kämpfe, eine Perspektive der Migration
einnehmen? Ich sage nicht, dass ich die bestehenden Macht-, Sozialisierungs- und Erfahrungsunterschiede wegwischen und die Perspektive
einer Subalternen/Migrantin einnehmen kann – wohl kann ich aber versuchen, an den Kämpfen teilzunehmen und eine Perspektive der Kämpfe
der Migration einzunehmen. Wenn Arturo Escobar, Kulturanthropologe
in Kalifornien und Eduardo Restrepo, der als Kulturwissenschaftler in
Bogota arbeitet, über das „project of border thinking“ als epistemische
Perspektive nachdenken, stellen sie klar, dass es für sie nicht zwingend
von den jeweiligen gesellschaftlichen Positionierung und eigenen Privilegien abhängt, ob eine solche Perspektive eingenommen werden kann:
„From the modernity/coloniality perspective it is possible to talk about
(non-Eurocentric) epistemic perspective(s) that can be occupied by a
host of social actors in many geopolitical locations and in multiple
ways; in this way, it is not the identity of the subject that matters
most, but the subject’s ability to inhabit a border space of thought and
practice. It could perhaps be claimed that, historically and socially,
subaltern groups are more attuned to this epistemic perspective and
are thus more likely to occupy effectively the spaces of transformation
(the borders of the modern colonial world system), but of course no
identity guarantees a politics or a perspective, and non-subaltern actors might find the project of border thinking enabling.“ (Restrepo &
Escobar, 2005: 113)
Wie aber kann ich eine solche Perspektive der Kämpfe, der Grenze, der
Autonomie der Migration einnehmen? Situierung geht sicherlich zuerst
59
�einmal mit Selbstreflexion einher – die eigenen Positionalitäten zu befragen, deutlich zu machen und von ihnen aus zu sprechen. Gleichzeitig
handelt es sich auch um eine aktive Entscheidung, was für ein Wissen
wir aus welcher Perspektive produzieren möchten. Hier möchte ich auf
feministische Debatten zur Situierung von Wissen rekurrieren, die die
Idee von der „Perspektive der Autonomie“ und „Grenze als Methode“
ein wenig greifbarer machen. Die feministische Wissenschaftlerin Donna Haraway kritisiert den „god trick“ eines „Blickes von überall und nirgends“ als paternalistische Machttechnik und schlägt situiertes Wissen
als Gegenprojekt vor, das Partialität statt Transzendenz beansprucht:
„Feminist objectivity is about limited location and situated knowledge,
not about transcendence and splitting of subject and object” (Haraway,
1988: 583). Die feministische Kritik geht davon aus, dass Wissen immer
einen Ort hat, immer verkörpert ist. Oder in den evokativen Worten von
Marta Malo de Molina:
„Nein, meine Herren: Das Denken durchzieht immer den Körper, und
daher handelt es sich stets um ein situiertes, involviertes Denken, das
von einer Seite her Aufstellung nimmt. Die Frage ist also, von welcher
Seite her nehmen wir Aufstellung? Oder was dasselbe ist, mit wem
denken wir? Mit den Arbeitskämpfen, den Dynamiken der Konfliktualität und der sozialen Kooperation, den Frauen, den Verrückten, den
Kindern, den lokalen Gemeinschaften, den unterdrückten Gruppen,
den selbstorganisierten Initiativen ...“ (Malo de Molina, 2004b: 4)
Meiner Meinung nach kann eine Perspektive der Kämpfe nur aus
der bewussten, positionierten Teilnahme an Kämpfen heraus entstehen. Dort, wo sie diesen Bezug verliert, weist sie bestenfalls
ins Leere. Ein*e Wissensproduzent*in, die annimmt, sich aus den
erforschten Aushandlungen heraushalten zu können (und zu sollen), kann nur aus einer Perspektive des Abstands (und Regierens)
auf ihr Forschungsobjekt blicken, und nicht mit emanzipativen
und widerständigen Bewegungen aus der Perspektive des geteilten
Kampfes.
Was heißt es aber für eine Wissenspraxis, an Kämpfen teilzunehmen? Selbstverständlich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, in
einen Kampf involviert zu sein. Kann z. B. eine Diskursanalyse, die
kein Verlassen des Schreibtisches verlangt, aus der Perspektive der
60
�Kämpfe an Aushandlungen teilnehmen? Meiner Meinung nach ist
auch eine solche ‚rein‘ diskursive Teilnahme denkbar. Auch diskursive Praktiken wirken subjektivierend, körperlich und materiell.
Zentral ist vielmehr, dass der/die Wissensproduzent*in sich einmischt in dem Sinne, dass sie vor ihrer notwendigen Teilnahme
nicht flieht, sondern sie anerkennt und nutzt. Sie tritt so aus der
geschützten Position des wissenschaftlichen Abstands heraus, tritt
in Kommunikation und macht sich so auch verletzlich.
Auch wenn es also andere Möglichkeiten gibt, teilzunehmen, habe
ich mich doch für die konkrete Teilnahme vor Ort und innerhalb
der Beziehungsgeflechte als die zentrale Methode meiner Wissenspraxis entschieden. Denn in meiner Erfahrung wurde es durch die
konkrete Teilnahme an und Begleitung in Konflikten einfacher, die
Perspektive der Kämpfe einzunehmen. Dies ergänzt sich gut mit
der ethnografischen Forschungsmethode. Ethnografisch forschen,
teilnehmend beobachten heißt, mit dem eigenen Körper Teil konkreter Situationen zu sein und in diesen zu handeln, zu interagieren
und zu kommunizieren. Der ethnografischen Regimeanalyse ist die
These zentral, dass Brüche und Ambivalenzen der hochkomplexen
und stets umkämpften Regime nur konkret und emisch erfahren
werden können. Nur durch „Lokalisierung […] Involviert-Werden
[…] Selbst-Erleben [… und] Vertrautwerden“ (Hess & Tsianos, 2010:
256 f.) sei es möglich, „die Vielzahl der Akteure zu ermitteln“ (ebd.),
„die konflikthafte Genese und Implementierung des Grenzregimes
aus einer Multiakteursperspektive“ (ebd.) zu analysieren und die
„immense Kluft zwischen Theorie, ‚Papier‘ und Praxis“ (ebd.) zu
reflektieren, erklären Vassilis Tsianos und Sabine Hess. Als Methode bietet dies also eine gute Grundlage für eine im feministischen
Sinne situierte Wissensproduktion.
Ich habe die Involvierung beim Wort genommen und bin noch einen Schritt weiter gegangen. Im Sinne einer Perspektive der Kämpfe und der Grenze als Methode habe ich während meiner ethnografischen Forschung nicht nur als Beobachterin teilgenommen, die
ihr notwendiges Wirken zwar reflektiert aber auch versucht, es zu
minimieren, sondern mich auch nicht gescheut, selbst aktiv zu werden und in Konflikte zu geraten. Im Gegenteil, ich habe versucht,
mich tatsächlich auch an Konflikten und Kämpfen direkt zu beteiligen. In diesen konkreten Konflikten konnte ich nicht mehr neutral
61
�bleiben, oder diesen Anschein erwecken und war gezwungen, mich
sichtbar zu positionieren. In den Konflikten, und auch in Interviews
und beim Lesen von policy papers, konnte ich gleichzeitig beobachten, wie leicht ich mich in die Perspektive des Regierens, die von
den Beamt*innen eingenommen wurde, die mir in Bezug auf bürgerliche Sozialisierung, Habitus und Sprache oft sehr nahe waren,
hineinversetzen konnte.32 Auch, wenn ich als Aktivistin der Initiative
Zivilcourage an kommunalen Gesprächen teilnahm, handelte es sich oft
um einen Drahtseilakt, in dem ich beobachten konnte, wie mir meine Sozialisierung die Perspektive des Regierens näher legte als die der Kämpfe. Doch auf dieser Grundlage konnte ich diese Perspektive auch besser
kritisieren, ihr entgegentreten und teilweise strategisch auf sie eingehen. Der Versuch, aus der Perspektive der Kämpfe auf die Versuche des
Regierens zu schauen, diese zu verstehen, zu beschreiben und gleichzeitig mit den Kämpfen an der Grenze situiert zu bleiben, durchzieht
diese Arbeit. Erst, indem ich im Zuge von Auseinandersetzungen – ich
begleitete Arbeiter*innen in Konflikten gegenüber Arbeitgeber*innen,
Ämtern, Polizei und Geschäftsleuten im Bahnhofsviertel – auf sie stieß,
wurde ich auf viele Grenzziehungen, ihre Brüche und Ambivalenzen,
die Logiken des Regierens und die Handlungsmöglichkeiten in den
Aushandlungen mit diesen aufmerksam. Diese konkreten, individuellen Konflikte habe ich dann durch Recherchen und Interviews kontextualisiert und bin dabei ausgewählten Konfliktlinien gefolgt. Auch in
Interviews mit kommunalpolitischen Akteuren habe ich aber meine
Positionierung nicht versteckt, sondern meine Interviewpartner*innen
eher konfrontiert und mit ihnen diskutiert. In der Verschriftlichung bin
ich dann von konkreten Konfliktsituationen ausgegangen und habe einzelne Trajektorien über sie hinausgehend verfolgt. Das zweite Kapitel
beginnt mit einer konfliktiven Szene vor dem Arbeitsgericht und bettet
diese in das transnationale Migrationsprojekt der vier Kläger*innen ein.
Das dritte Kapitel geht von Hegemoniekämpfen um den öffentlichen
Raum im Bahnhofsviertel und die mediale Deutung des ‚Tagelöhnermarktes‘ aus und führt zu aktuellen Konjunkturen des (postliberalen)
Rassismus. Das vierte Kapitel nimmt, wie erwähnt, seinen Ausgang bei
den Protesten gegen eine Zollrazzia und landet bei der Sicherheits- und
32
Hier ist zu beachten, dass es sich bei diesen oft um Personen handelte,
die Migration, Diversität etc. durchaus befürworteten und sich als fortschrittlich und liberal begriffen.
62
�Ordnungspolitik der Stadt München gegenüber ‚Armutszuwanderung‘.
Den weiteren Kapiteln sind verschiedene konflikthafte Situationen im
Wohnungsamt, der Ausländerbehörde und im Jobcenter zentral.
Die Auswahl der Aushandlungsfelder, über die ich schreibe, ist kontingent, könnte auch anders sein: Ich habe sowohl in der konkreten Forschungssituation, wie auch in der Analyse und Verschriftlichung (mehr
oder weniger bewusst) entschieden, wohin ich meine Aufmerksamkeit
richte und welchen Trajektorien ich folge. So sind sehr spezifische, situierte und kontingente Repräsentationen der realen Aushandlungsfelder
entstanden. Es ist aber noch in einem weiteren Sinne von radikalem
Konstruktivismus zu sprechen. Wie jede Forscherin habe ich die Aushandlungsfelder beeinflusst. Indem ich Konflikt als Methode gewählt
habe, habe ich mich aktiv und bewusst an den Aushandlungen und Konflikten beteiligt. Viele der Situationen und Zusammenhänge, über die
ich schreibe, hätte es ohne mein Zutun in dieser Form nicht gegeben.
Mit diesem intervenierenden Ansatz möchte ich zu den Debatten um
die ethnografische Regimeanalyse und die ihr zu Grunde liegenden epistemologischen, ontologischen und methodologischen Überlegungen
beitragen. Im Zuge der noch jungen Debatte zur ethnografischen Regimeanalyse – auch in der Kulturanthropologie – ist noch kaum dezidiert
auf die Dimension des eingreifenden Forschens eingegangen worden
(vgl. Riedner, 2014), es gibt im Fach aber sehr wohl Ansätze der involvierten Forschung. Wie ethnografisches Forschen und kulturanthropologische Wissensproduktion aktiv und wirksam werden können, wurde
immer wieder diskutiert – wovon mehrere Sammelbände zeugen (vgl.
Binder et al., 2013; Hale, 2008; Hymes, 1974; Lem & Leach, 2002; Smith,
1999). Hier sei nur die zusammenfassende Darstellung der beiden Kulturanthropologinnen Setha M. Low und Sally Engle Merry erwähnt, die
in ihrer Einleitung der Ausgabe Engaged Anthropology – Diversity and
Dilemmas der Zeitschrift Current Anthropology zahlreiche Spielarten
engagierter Social Anthropology aufzählen: Neben „social critique“ auch
„sharing and support“, „teaching and public education“, „collaboration“,
„advocacy“ und „activism“ (Low & Merry, 2010: 204). Die Möglichkeiten des Wirkens während der Forschung reichen ihnen zufolge von
„alltäglichen Praxen der Teilens, Unterstützens und der persönlichen
Interaktion“ (ebd.: 207, Übersetzung der Autorin), dem Ausführen der
Ziele von lokalen Organisationen oder sozialen Bewegungen und ihrer Unterstützung durch Organisierungsversuche bis hin zum Erstellen
63
�von Expertisen und Übersetzungsarbeiten (vgl. ebd.: 210). Auf der einen
Seite gibt es Ansätze, die über ihre Forschungspraxis wirken und die
erforschten Gruppen unterstützen möchten, auf der anderen Seite lässt
sich eine akademische Präferenz für Ansätze feststellen, die sich – wenn
auch kritisch – in ihren Elfenbeinturm zurückziehen und eine direkte
Involvierung, in der sie sich auch die Hände schmutzig machen könnten, eher ablehnen (vgl. kritisch dazu Hale, 2006; Shukaitis & Graeber,
2007). Die meisten bisherigen Versuche der „engaged anthropology“
haben die Involvierung in Konflikte und Kämpfe aber meines Wissens
nach nicht explizit zur Grundlage der eigenen Ontologie und Methodologie gemacht.
Auf einen Ansatz, der Wissensproduktion und Aktivismus ganz grundlegend miteinander verbindet, bin ich in der Tradition der militanten
Untersuchung in sozialen Bewegungen gestoßen (vgl. etwa kolinko,
2002; FelS, 2011; arranca!-Redaktion, 2008). Auf die militante Untersuchung wurde schon von vielen politischen Projekten Bezug genommen (vgl. Malo de Molina, 2004b; precarias a la deriva, 2007; Shukaitis
& Graeber, 2007). In einer militanten Untersuchung, so schreibt Gigi
Roggero, ist
„the production of knowledge [...] in the same moment the production
of subjectivity and the agency, of common practices and languages,
and the construction of a political self-organization.“ (Roggero, o.J.: 1).
Handelt es sich bei meiner Promotionsforschung also um eine militante Untersuchung? Mit Teilnahme, Wissensproduktionen und Reflexionen habe ich mich zwar sicherlich in Organisierungsprozesse
eingebracht, trotzdem möchte ich die vorliegende Untersuchung nur
bedingt als militante Untersuchung bezeichnen, da sie doch ein in der
Wissenschaft positioniertes Projekt blieb, das als solches von mir individuell geplant und umgesetzt wurde. So blieb die Beziehung zu meinen Forschungspartner*innen in gewissem Maße eine ausbeuterische,
weil ich aus den gemeinsamen Tätigkeiten Mehrwert in Form von einer Doktorarbeit und Distinktionsgewinn (nicht nur) im gesellschaftlich anerkannten Feld der Wissenschaft gezogen habe. So steht auf
diesem Buch mein individueller Name – so habe ich die gemeinsame
(Wissens-)Praxis für mich persönlich in Wert gesetzt. Ein Projekt, in
das verschiedene Personen gemeinsam Arbeit und Ideen einbringen,
64
�dient mir als Akademikerin als Stufe in der Karriereleiter, die ich alleine erklimme. Als Wissenschaftler*in konnte ich den Widerspruch zwischen den ungleichen Macht- und Ausbeutungsverhältnissen und dem
Versuch, diese zu überwinden sowie niemanden zum Objekt zu machen, nicht gänzlich auflösen, weil er Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, in denen wir uns bewegen. Diese Widersprüche verbieten den Versuch einer (möglichst) emanzipatorischen und kritischen
wissenschaftlichen Praxis nicht, aber sie müssen immer wieder neu
analysiert und die Schlussfolgerungen konsequent umgesetzt werden.
Nicht alle meine Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Kämpfen der
EU-migrantischen Arbeiter*innen standen dabei unter dem Schirm
der wissenschaftlichen Arbeit, sondern meine akademischen Praktiken waren vielmehr ein verknüpfter Teilbereich einer Assemblage aus
Tätigkeiten, die in verschiedensten Diskursen und Zusammenhängen
positioniert waren. Neben diesem Buch und wissenschaftlichen Artikeln hat es so etwa noch viel mehr diskursive Interventionen gegeben.
Zu welchen Widersprüchen, Herausforderungen und Konvergenzen
es in dieser Verschränkung von akademischer und aktivistischer Arbeit und den damit einhergehenden Beziehungen in vermachteten, ungleichen gesellschaftlichen Verhältnissen gekommen ist, möchte ich
im Folgenden genauer reflektieren.
Verhältnis Wissenschaft und Aktivismus?
Eine Perspektive der Kämpfe einzunehmen und sich aktiv an den erforschten Aushandlungsfeldern zu beteiligen, heißt nicht, sich unüberlegt und unreflektiert in Gemengelage von Konflikten und Machtverhältnissen zu werfen mit dem Ziel, so wirksam wie möglich zu sein.
Auch und gerade eine Forschungspraxis, die aktiv intervenieren möchte, verlangt nach der Auseinandersetzung mit den Anforderungen, Positionierungen, Widersprüchen und Ungleichheiten, in denen geforscht
wird. Dabei möchte ich nicht a priori zwischen den Bereichen der Wissenschaft und des Aktivismus unterscheiden. Sehr wohl gibt es aber
Unterschiede zwischen Infrastrukturen, Handlungsmodi, Gütekriterien
und Wissensordnungen (vgl. Hutta et al., 2013). Nach Jasbir Puar handelt es sich nicht um konzeptuelle Unterschiede:
65
�„What interests me is how to ... attend to the historically hierarchical
relations of the two realms. Differing institutional spaces may entail
different forms of output, media, and energy, but that does not then
reduce to an easy equivalence of those differences to conceptual ones.“
(Greyser, 2012: 841)
Diese Unterschiede machten sich während meiner Forschung durchaus bemerkbar. So bin ich zum Beispiel auf Seiten des Aktivismus auf
Kritik an wissenschaftlicher Praxis gestoßen. Meine erste Forschungsanfrage bei einer aktivistischen Gruppe in Berlin wurde abgelehnt
mit der pragmatischen Begründung, dass die Zusammenarbeit mit
Wissenschaftler*innen einfach zu viel Zeit koste und keinen Mehrwert
verspreche. Sie hätten sich entschieden, die vielen Anfragen aus dem
wissenschaftlichen Feld abzulehnen. Dies hatte mit einem Mangel an
Kapazitäten zu tun, verwies aber auch darauf, dass die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen für sie keinen hohen Stellenwert hatte.
Auch die Initiative Zivilcourage bekam immer wieder Anfragen, sowohl
von Kulturproduzent*innen als auch von Wissenschaftler*innen und
Studierenden. Viele wollten uns als Zugang zu den Arbeiter*innen benutzen. Wir sagten nie direkt zu oder ab, sondern telefonierten erst mit
ihnen. Wenn sie zum einen eine Perspektive der Kämpfe einzunehmen
schienen, also auf der Seite der Arbeiter*innen zu stehen schienen und
sie nicht als Problem betrachteten, sondern sich für ihre Probleme interessierten, und zum anderen auch bereit waren, direkt im Workers’
Center mitzuarbeiten, dann luden wir sie ein. Manchmal haben wir
Wissensproduzent*innen auch direkt eingeladen und ihnen erst einmal
eine Aufgabe wie ein auszufüllendes Formular oder ein Gespräch mit
einem oder einer Arbeitgeber*in aufgetragen oder ließen sie einfach mit
am Tisch sitzen und beobachteten, wie sie sich dabei verhielten. Manche
waren brüskiert und lehnten eine solche Arbeit ab, andere trauten sich
nicht, aber manche machten sich auf Anhieb nützlich. Manche kamen
von selbst und auf Augenhöhe mit Arbeiter*innen in die Kommunikation, andere rutschten unruhig auf ihrem Stuhl herum und drängten
darauf, dass wir ihre Fragen übersetzten, die oft weitgehend den Stereotypen des hegemonialen Diskurses folgten.
Die Kritik an Wissensproduzent*innen geht über eine reine Kapazitätenfrage hinaus. Während einer Tagung in Berlin im Jahr 2010 berichteten die Frauen einer Gruppe, die gegen Gentrifizierung eintrat, dass es
66
�geradezu einen Hype um ihre Projekte gegeben habe, sie die Forschungsanfragen kaum bewältigen hätten können. Zum einen kritisierten sie,
dass viele der Forscher*innen mit hohen Erwartungen an zeitliche Ressourcen kämen und z. B. keine eigenen Dolmetscher*innen mitbrächten, zum anderen, dass die Forscher*innen extrem selten ihre Produkte
zurückspiegelten. Am schwerwiegendsten erschien mir aber die Kritik,
dass bei vielen akademischen Wissensprojekten das Forschungsdesign
und die Forschungsfragen schon im Vorhinein feststanden und keine Bereitschaft bestand, hier kollaborativ und/oder an Fragen zu forschen, die für die Aktivitäten der Gruppe direkt von Bedeutung wären.
Auch in der Initiative Zivilcourage machten wir die Beobachtung, dass
Wissensproduzent*innen allzu oft kein kollaboratives Verständnis ihrer
Arbeit hatten, sondern die Initiative und die Arbeiter*innen als Objekte
verstanden, auf die sie ihre vorgefertigten Fragen und auch Antworten
projizierten.
Nach Jan Simon Hutta, der zur LGBT Bewegungen in Brasilien geforscht
hat und in diesen auch aktiv war, stellen die aktivistische und die akademische Praxis grundlegend ganz unterschiedliche Anforderungen:
„Von der aktivistischen Praxis ergeht oftmals die Anforderung, dass ich
mich klar in dem aktivistischen Diskurs positioniere, wo mit bestimmten Begriffen ganz selbstverständlich und ungebrochen agiert wird –
sei es ‚Homophobie‘ oder ‚Vulnerabilität‘. Andererseits ergeht von der
wissenschaftlichen Seite – zumindest im Kontext der kritischen Debatten, in denen ich mich bewege, – eine Anforderung, Dinge permanent
zu hinterfragen und sich klar auf der Seite von Kritik zu positionieren.
Es scheint in beiden Feldern den Wunsch nach einer klaren und daher
scheinbar unangreifbaren oder gar moralisch höherwertigen Position
des Sprechens und Handelns zu geben. Die sich jeweils durch Affirmation bzw. Kritik bestimmt – im Aktivismus: ‚Ich agiere, also bin ich!‘,
und in der kritischen Wissenschaft: ‚Ich kritisiere, also bin ich!‘“ (Hutta
et al., 2013: 155)
Ähnliche Spannungsfelder haben sich auch während meiner Forschung
immer wieder ergeben. Dies wird unter anderem im dritten Kapitel
zu den medialen Aushandlungen der Deutung des ‚Tagelöhnermarkts‘
deutlich, in denen ich als Aktivistin manchmal strategisch Leistungslogiken bediente, indem ich die Nützlichkeit der Arbeiter*innen betonte,
67
�auch wenn ich auf wissenschaftlicher Ebene genau diese Nützlichkeitslogiken analysierte und kritisierte. Doch auch die aktivistischen Zusammenhänge reflektierten, welche Effekte ihre Konzepte und Analysen
hatten. Eine klare Trennung zwischen Aktivismus-Agieren und Wissenschaft-Kritisieren war in den Zusammenhängen, in denen ich mich
bewegt habe, nicht aufrechtzuerhalten. Ich habe diese Spannungsfelder
als Bereicherung empfunden, weil sie mich davon abgehalten haben, unkritisch Kategorien und Argumentationen zu reproduzieren,
die im jeweiligen Moment wirkmächtig erschienen, oder mich ganz
ohne direkten Bezug zu konkreten Auseinandersetzungen in theoretischen Abstraktionen zu ergehen. Auch für Jan Simon Hutta stellt
sich, mit Verweis auf Donna Haraway (1997, 2007), die feministisches
Wissen „im ‚beschmutzende[n]‘ Feld der action“ (Hutta et al., 2013:
201, Hervorhebung im Original) situiert, „die Paradoxalität als Potenzial und politische Notwendigkeit heraus“ (ebd.: 156).
Zu Konflikten zwischen ‚Agieren‘ und ‚Kritisieren‘ kam es in meiner
Forschung weniger in Bezug auf die Form der Wissensproduktion,
wohl aber ganz konkret in Bezug auf die Frage, ob ich meine Zeit
und Energie auf die Arbeit im Workers’ Center, oder auf die akademische Arbeit verwendete. Dies ging solange gut, wie sich die
beiden Bereiche überschnitten, die aktivistische Arbeit also gleichzeitig auch Forschungsarbeit darstellte. Auch ein intervenierendes
Promotionsprojekt besteht aber nicht nur aus aktivistischer Feldforschung, sondern auch aus vielen Stunden des Lesens, Denkens und
Schreibens am Schreibtisch, während im Workers’ Center Zeit und
Kapazitäten immer knapp waren. Die Entscheidung, wie viel Zeit
andere Aktivist*innen und ich hier verbrachten, hatte ganz konkrete
Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse und auch die körperliche
Situation anderer Menschen. Die Betreiber der Räume, in denen wir
uns trafen, knüpften deren Nutzung an die Bedingung, dass eine Person von der Initiative Zivilcourage dabei war. Wir hatten nie unsere
eigenen Räume. Dies hieß, dass allzu oft Personen auf die Straße
gehen mussten, wenn ich aufbrach, um in der Bibliothek an meiner
Doktorarbeit zu schreiben. Nach Abschluss der ethnografischen Forschung, und vor allem, seitdem ich mich in der Verschriftlichungsphase befinde, habe ich meine Arbeit mit der Initiative Zivilcourage
zeitlich streng eingegrenzt und begleite beispielsweise kaum noch
Personen zu Terminen auf die Ämter. Diese Entscheidung treffe ich
68
�jedes Mal wieder neu, und sie ist immer schwierig, wenn ich im Workers’ Center beispielsweise einer obdachlosen Person gegenüber sitze
und weiß, dass sie mit meiner Begleitung um vieles größere Chancen
hätte, wieder ein Dach über dem Kopf und soziale Leistungen zu
bekommen. Diese Entscheidungen waren, zumindest zu einem gewissen Maße, Bedingung dafür, dass ich dieses Buch schreiben konnte. Hier gerieten die konkreten Anforderungen des Aktivismus und der
Wissenschaft aneinander.
Natürlich besteht dieses Spannungsfeld nicht nur zwischen diesen beiden Bereichen. So kann ich das Workers’ Center auch abschließen, weil
ich keine Lust mehr habe, weil ich mich mit Freund*innen treffe, ohne
akademischen Mehrwert in der Bibliothek Texte studieren möchte oder
einer anderen Erwerbsarbeit nachgehe.
Es geht mir hier auch nicht um eine ethische und moralische Diskussion um Privilegien. Ich sehe keinen Sinn darin, soziale Verhältnisse
in Privilegien zu vermessen, wobei die mit Privilegien einhergehende
Schuld durch Aktivismus abgeglichen werden müsse. Meiner Meinung
nach geht es vielmehr darum, sich gemeinsam gegen oder für etwas zu
organisieren und dabei einen aktiven Umgang mit bestehenden Machtungleichheiten und sozial-ökonomischen Unterschieden zu finden, der
auf gegenseitigem Respekt, Augenhöhe und dem Kampf gegen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse beruht. Eine allgemeine Lösung
dieses Spannungsfeldes habe ich nicht gefunden, vielmehr bin ich mit
diesen Konflikten und Entscheidungszwängen immer situativ umgegangen. Dies hieß auch, dass ich in manchen Fällen dann doch Personen zu
Terminen begleitete, dass ich fast durchgängig mindestens jede zweite
Woche im Workers’ Center mitarbeitete, aber mich auch mal für zwei
Monate aus der konkreten aktivistischen Arbeit zurückzog. Neben diesen konkreten Konflikten ist aber auch zu betonen, dass nicht nur meine
aktivistischen Tätigkeiten meine Forschung informiert haben, sondern
mein Forschungsprojekt auch immer wieder die aktivistische Tätigkeit
zurück gefüttert hat. So war meine akademische Arbeit nicht nur in Form
von direkt handelnder aktivistischer Teilnahme ‚nützlich‘ für den Aktivismus. Interviews haben zu Bekanntschaften geführt, an die ich dann
im Rahmen des Aktivismus anknüpfen konnte. Des weiteren kam es immer wieder zu Feedbackloops, Kurzschlüssen zwischen Wissensproduktion und aktivistischer Verwertung, die oft eine sehr viel kürzere Zeitspanne aufwiesen, als wenn erst die veröffentlichten wissenschaftlichen
69
�Arbeiten zu Rate gezogen worden wären. Zum Beispiel nutze ich das in
den letzten Monaten verfasste sechste Kapitel während der Verfassung
des vorliegenden ersten Kapitels dazu, mit der Initiative Zivilcourage
eine Kampagne gegen den Ausschluss von Obdachlosen aus den städtischen Notunterkünften zu planen. Und heute morgen [29.01.2016] habe
ich eine leitende Angestellte der Stadt München angerufen, um sie zu
fragen, ob es neue Pläne gäbe, einen privaten Sicherheitsdienst am ‚Tagelöhnermarkt‘ öffentlich zu finanzieren und davor noch kurzerhand im
Entwurf des dritten Kapitels nachgelesen, wieso die Argumentation und
die Praktiken der Auftraggeber des Sicherheitsdienstes rassistisch sind.
Manchmal war es mir aus forschungsethischen Gründen unmöglich,
Wissen weiterzugeben. Etwa, wenn mir als Doktorandin eine interne
Dienstanweisung vertraulich überlassen wurde, die für die Arbeit der
Initiative Zivilcourage sehr nützlich gewesen wäre. Aus Gründen der
Forschungsethik kann ich in der vorliegenden Arbeit auch nicht alles
Wissen und alle Erfahrungen, die ich als Aktivistin gemacht habe, einfließen lassen. Meine Teilnahme an kommunalpolitischen Treffen, in
denen ich mich nicht als Forscherin zu erkennen gab, thematisiere ich
nicht. Insbesondere zu den Aushandlungen um eine Anlaufstelle für
EU-Migrant*innen hätte ich sehr Spannendes zu erzählen, habe mich
aus forschungsethischen Gründen aber dagegen entschieden. Interna
der Initiative Zivilcourage und Details der Strategien und Praktiken der
EU-migrantischen Arbeiter*innen thematisiere ich zwar schon alleine
deswegen nicht, weil diese von meinem Forschungsziel her uninteressant sind, aber auch, weil ich hier vieles Wissen erlangt habe, ohne als
Forscher*in erkennbar gewesen zu sein. Eine Ausnahme stellen konfliktive Situationen in den Ämtern dar, in denen ich nur das Einverständnis
der Personen einholte, die ich begleitete, und die Sachbearbeiter*innen,
denen ich so begegnete, nicht immer über meine Forschung aufklärte.
Neben diesen Fragen zum Verhältnis von Wissenschaft und Aktivismus
im Forschungsprozess, stellt sich auch die Frage, wie die aus dem Forschungsprojekt resultierenden Publikationen wirken und wirken sollen.
Migrationspolitik ist extrem eng mit den Migrationswissenschaften verknüpft, wie Joshua Hatton (2011) in seiner Promotion zur Migrationsund Flüchtlingsforschung im Vereinigten Königreich herausstellt. Wie
kann ich verhindern, dass das von mir produzierte Wissen für Versuche
des Regierens genutzt wird? Oder möchte ich mit meiner Kritik strategisch in Versuche des Regierens intervenieren? Sicherlich kann ich
70
�nicht vermeiden, dass die publizierte Arbeit von Akteuren des Regierens gelesen wird, gerade auch auf kommunaler Ebene, auf der viele
Akteure von meiner Arbeit wissen. Ich kann nur versuchen, ein Wissen
zu produzieren, dass sich den Versuchen des Regierens versperrt und
den Bewegungen zuarbeitet. So habe ich mich gezielt dagegen entschieden, Wissen über die EU-Migrant*innen zu produzieren. Dies stellt diese
Arbeit aber vor ein Dilemma: Regime der EU-Migration zu analysieren,
ohne die Handlungen der EU-Migrant*innen einzubeziehen, lässt leicht
ein einseitiges, unidirektionales, vom Regieren gesteuertes Bild entstehen, wenn es doch gerade um die Kämpfe, Konflikte und Transformationen gehen sollte. Wie kann ich also die Kämpfe der Subalternen und der
sozialen Bewegungen miteinbeziehen, dabei aber vermeiden, ein von
Versuchen des Regierens nutzbares Wissen über sie zu produzieren?
Auch aus dieser Sicht ist der Versuch zu verstehen, eine Perspektive der
Kämpfe einzunehmen und Konflikt als Methode einzusetzen. So kann
ich konfliktive Schnittstellen thematisieren, ohne ‚über‘ die EU-internen
Migrant*innen zu schreiben. Dies stellt aber auch eine Gratwanderung
dar, wie insbesondere am zweiten Kapitel deutlich wird, in dessen Zentrum ein Arbeitskampf und das Migrationsprojekt einer Gruppe von
Frauen stehen. Auch hier versuche ich, die Schreibperspektive mit den
Migrantinnen zu positionieren und nach Antagonismen, Widersprüchen und politischen Handlungsstrategien zu fragen, statt aus einer
Perspektive des Regierens ihre Praktiken mit soziologische Kategorien
zu erfassen.
Diese Dissertation ist als Versuch zu verstehen, Teil eines größeren Zusammenhangs, einer Wolke an Kämpfen zu werden. Mit ihr möchte ich
Versuche des Regierens analysieren, um so sowohl zu Debatten in der
Kulturanthropologie und den kritischen Migrationswissenschaften beizutragen wie auch zu sozialen, antirassistischen Bewegungen – wobei
beide Bereiche auch hier nicht klar voneinander abgegrenzt sind. Die
(urbanen) Kämpfe von EU-internen Migrant*innen zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch kaum auf der Tagesordnung sichtbar-werdender sozialer Bewegungen sind und auch von wissenschaftlicher Seite
bisher wenig thematisiert wurden (für Ausnahmen vgl. etwa Alberti,
2017; Bouali, 2018; Buckel, 2013; Deneva, 2014; Hielscher, 2013; Richter,
2017; Schoenes & Schultes, 2014; Van Baar, 2012). Auch der rassistische
Diskurs zur ‚Armutszuwanderung‘ und die Kämpfe um soziale Rechte
für Unionsbürger*innen erfahren wenig Aufmerksamkeit. Es gibt wenig
71
�Problematisierungen, die von der hegemonialen Sichtweise abweichen,
kaum Angebote kritischer Perspektiven, fast kein geteiltes Wissen, wodurch soziale Bewegungen, akademische Debatten und auch situative
Strategien inspiriert und kritisiert werden könnten. Indem ich diese
Leerstelle zu füllen helfe, möchte ich zu den Kämpfen der EU-internen
Migration beitragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verschränkung von Wissenschaft und Aktivismus – zwei Felder, die zwar nicht a priori zu unterscheiden sind, aber durchaus unterschiedliche Anforderungen stellen –
immer mit Spannungen verbunden ist, aber genau deswegen auch hoch
produktiv sein kann. Aktivistische Forscher*innen werden sich zwar
immer die Finger schmutzig und sich angreifbar machen, sie haben aber
auch das Potenzial nahes, immanentes und relevantes Wissen zu produzieren. Grundlage dafür ist aber auch die kritische Analyse und der
konsequente Umgang mit ungleichen Macht- und Ausbeutungsverhältnissen im Forschungsprozess und darüber hinaus.
Konflikt als Methode ist gleichzeitig Forschungsmethode, die ein situiertes Wissen verspricht, wie auch konkretes world making. Indem ich
Konflikt als Methode vorschlage, möchte ich einen Beitrag zu methodologischen und theoriepolitischen Debatten leisten und zu neuen Formen
der (akademischen) Wissensproduktion beitragen, die versuchen, aus
der Kritik der Wissenschaften zu lernen.
72
�Justice for Janitors? Unwahrnehmbare und
sichtbarwerdende Kämpfe gegen Prekarisierung, Ausbeutung und Migrationskontrolle33
Vor dem Arbeitsgericht
Es geht um 2.374 Euro. Vier Reinigungsarbeiterinnen aus Bulgarien haben ihren ehemaligen Arbeitgeber auf vorenthaltenen Lohn verklagt.
In wenigen Minuten beginnt der erste Gerichtstermin vor dem Arbeitsgericht München und die vier Klägerinnen werden ihrem ehemaligen
Arbeitgeber entgegentreten. Ihre Anwesenheit vor Gericht war zwar
nicht ausdrücklich verlangt, aber die vier hatten sich trotzdem dazu entschlossen, gemeinsam mit Unterstützerinnen am Prozess teilzunehmen,
um ihrer Klage Nachdruck zu verleihen. Spannung lag in der Luft, aber
nichtsdestotrotz unterhielten wir uns und lachten. Das Sicherheitspersonal, das uns schmunzelnd durch die Sicherheitsschleuse lotste, wirkte auf mich überrascht und vielleicht sogar erfreut, einer Gruppe von
acht scherzenden Frauen in den sterilen Hallen des Arbeitsgerichts zu
begegnen. Das gemeinsame Lachen brach mit der Ernsthaftigkeit der
Situation und entzog sich der Ehrfurcht, die die Institution Gericht gebietet. Im Vorraum trafen wir die Anwältin. Sie fragte die Klägerinnen
auf Türkisch, ob sie gegebenenfalls mit einem Vergleich einverstanden
wären. Ihrer Einschätzung nach würde der Richter vorschlagen, dass
der Unternehmer einen Teil des eingeklagten Betrages zahlen und die
Frauen die Klage einstellen sollten. Diese stimmten zu und äußerten,
dass sie das Geld dringend bräuchten.
33
Eine frühere Version dieses Kapitels wurde in der Zeitschrift movements – Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung veröffentlicht (Riedner, 2015).
73
�Die Verhandlung
Dann betraten wir den Gerichtssaal. Auf der einen Seite des Raumes, die
etwas erhöht und von einem raumbreiten Tisch vom Rest des Raumes
abgegrenzt war, saß schon der Richter. Die Anwältin der Klägerinnen in
schwarzer Robe und der Angeklagte Dr. Goffmann, der sich selbst verteidigte, schauten von zwei einzelnen Tischen schräg zu ihm auf. Neben
dem Unternehmer saß die Objektleiterin der Schule, in der die Frauen
gereinigt hatten – sie war die direkte Vorgesetzte der vier Klägerinnen.
Wir setzten uns in die Stuhlreihen, die für Zuschauer*innen aufgestellt
waren, neben eine Journalistin des bayerischen Rundfunks, die am vorherigen Tag schon ein Interview mit den Kläger*innen geführt hatte.
Ich begleitete die Klägerinnen Nadja Bozhkova, Zümbül Eseva, Bozhurka Chavdarova und Nonka Angelova im Rahmen unserer Tätigkeiten
für die Initiative Zivilcourage. Meine Beziehung zu den Klägerinnen, die
ich zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung schon seit mehr als drei
Jahren kannte, geht über eine beratende und unterstützende Funktion
hinaus. Wir haben in den letzten Jahren zusammen gelacht, getanzt und
geweint. Die vier Frauen und einige weitere Freundinnen, von denen
Penka Radkova und Tanja Mihaylova mit zum Prozess gekommen sind,
halten eng zusammen und unterstützen sich gegenseitig im Alltag. Ihre
Wohnverhältnisse schwanken zwischen Obdachlosigkeit und höchst
beengten Arrangements, die oft extrem überteuert sind und nicht selten
eine Gegenleistung für Sex- und/oder care-Arbeit für Männer darstellen. Sie arbeiten meist im Reinigungsgewerbe, oft handelt es sich um
kurzfristige Gelegenheitsjobs, die von Perioden der Arbeitssuche unterbrochen sind. Ihr soziales Netzwerk setzt sich vor allem aus alten
Freund*innen, Kolleg*innen und Verwandten aus der bulgarischen Stadt
Pazarjik zusammen. Der selbstorganisierte Arbeitsmarkt auf den Straßen des Münchner Bahnhofsviertels ist einer ihrer Treffpunkte. Auch
die Allianz mit der Initiative Zivilcourage ist Teil ihres sozialen Umfeldes. Ich bin voll tiefer Bewunderung für die Frauen, die sich trotz der
widrigen Umstände ihren Kampfgeist und ihr Lachen erhalten haben.
Gleichzeitig bleibt unsere Beziehung auch eine ungleiche, was immer
dann deutlich wird, wenn ich gerade keine Zeit habe, mit bürokratischen Angelegenheiten zu helfen. Ebenfalls offensichtlich wurde dies,
als Penka Radkova, gerade obdachlos, bei einer Preisverleihung für die
Initiative Zivilcourage früher gehen musste, um sich einen Schlafplatz
74
�zu suchen, während ich blieb, um den Preis in Empfang zu nehmen,
Sekt zu trinken und mich anschließend in meinen privaten Wohnraum
zurückzuziehen.
Mit einem Mal ging alles sehr schnell. Der Richter legte kurz den Klageinhalt dar und bat den Arbeitgeber um Stellungnahme. Dieser, ein weißer
Mann um die 60 Jahre im Rollstuhl, erklärte mit ruhiger Stimme, er könne sich die Forderungen nicht erklären, „weil wir nachweisen können,
dass wir jede gearbeitete Stunde gezahlt haben“. Sein nüchterner und
eloquenter Auftritt würde auf mich wohl glaubhaft wirken, wäre ich
nicht von der Darstellung der Klägerinnen überzeugt und wüsste, dass
ein solcher Betrug gängige Praxis in der Reinigungsbranche ist. Das Verhalten des Unternehmers Dr. Goffmann wurde kontrastiert von Geflüster, Kichern und Handyklingeln im Zuschauerraum. Wir flüsterten uns
Kommentare zu über den Unternehmer und die Objektleiterin. Immer
wieder versuchte ich, mit einigen Worten das Geschehen ins Türkische
zu übersetzen. Dann wandte sich der Richter verärgert an uns im Zuschauerbereich und erklärte, es handele sich um ein Gerichtsverfahren
und die Zuhörenden hätten sich still zu verhalten. Ich übersetzte, was
er gesagt hatte und wir verstummten. Erst nach kurzem abwartendem
Schweigen unter dem strafenden Blick des Richters verstand ich, dass er
eine Antwort erwartete. Ich sagte in verhalten herausforderndem Ton
„Ja, verstanden.“ - und kam mir dabei vor wie in der Schule. Das letzte
Mal hatte mich ein Lehrer auf diese Art und Weise zurechtgewiesen, als
ich mich im Unterricht ‚fehl benahm‘. Im Gegensatz zu unserem offensichtlich unpassenden Benehmen brachte Dr. Goffmann sein kulturelles
Kapital ganz im Sinne der impliziten Verhaltensregeln des Gerichtssettings zur Geltung. Er lehnte die Forderungen der Klägerinnen nicht nur
rundweg ab, sondern stellte auch mit verschiedenen Mitteln ihre Glaubwürdigkeit in Frage. Die Stundenzettel seiner ehemaligen Angestellten
nannte er „Notizen, die sehr durcheinander sind“. Sie hätten zudem den
Hausmeister verärgert, weil sie während der Arbeitszeit herumgesessen seien. Dann bezeichnete er sie als „verschworenen Familienclan“
und nannte wie nebenbei ein Beispiel, durch das deutlich wurde, was er
inhaltlich mit der Bezeichnung „Clan“ verband. Seine Firma hätte eine
der Frauen weiter beschäftigen wollen, um ihr „noch eine Chance zu
geben“. Diese habe aber abgelehnt mit der Begründung, sie könne sich
ihrer Familie - sprich: ihrem „Clan“ - „nicht widersetzen“, sie müsse sich
diesem „beugen“.
75
�Zum Ende der Verhandlung kündigte der Richter entgegen der Ersteinschätzung der Anwältin an, zu einer Beweisaufnahme einzuladen, da keine Einigung in Sicht sei. Er war sichtlich verärgert: Eine
der zwei Parteien mache sich hier der Falschaussage schuldig und
er werde nicht zögern, diese strafrechtlich zu verfolgen. Nach etwa
15 Minuten war der Gerichtstermin beendet. Danach trafen sich die
Klägerinnen, ihre Begleiterinnen und die Anwältin zu einem kurzen
Gespräch im Eingangsbereich des Gerichtsgebäudes. Die Anwältin
schätzte die Lage sehr kritisch ein, da der Arbeitgeber und die Objektleiterin glaubwürdig aufträten und die Klägerinnen wenig belastbare Beweise hätten. Außerdem hätten wir uns durch unser auffälliges Verhalten im Gerichtssaal beim Richter jetzt schon unbeliebt
gemacht. Wenn die Frauen ihre Anklage nicht glaubhafter machen
könnten als der Arbeitgeber seine Verteidigung, müssten sie nicht
nur mit einer Niederlage und dem Verlust des ausstehenden Lohns
rechnen, sondern gar mit strafrechtlichen Konsequenzen. Die Klägerinnen waren erbost, denn Dr. Goffmann habe dreist gelogen. Er
habe sie beleidigt und beschämt. Sie würden die Klage auf keinen
Fall fallen lassen.
Fragestellung
In diesem Kapitel geht es um die Kämpfe der vier Klägerinnen und
ihrer Freund*innen. Die Gerichtsverhandlung ist nur ein Ausgangspunkt: Seit Anfang der 1990er Jahre leben die Frauen ein transnationales Leben – mit den, entgegen und über die staatlichen Regulationen und die Interessen der Unternehmen hinaus. Ihre Kämpfe
eröffnen Einblicke in aktuelle Prozesse der Prekarisierung von Ausbeutungsverhältnissen, die anhand der Arbeitsverhältnisse im Reinigungsgewerbe und im Kontext des ‚Tagelöhnermarktes‘ skizziert
werden sollen, und in die Transformationen des Migrationsregimes
zwischen Deutschland und Bulgarien seit den frühen 1990er Jahren.
Dabei knüpfe ich an den weiten Arbeitsbegriff neuerer kulturanthropologischer Ansätze an, die an Aushandlungen gesellschaftlicher
Transformationen im Feld der Arbeit interessiert sind (vgl. Götz
et.al., 2010; Hess & Moser, 2003). Der Münchner Kulturanthropologin
Irene Götz zufolge geht es um einen Arbeitsbegriff,
76
�„der kreative, eigensinnige Praktiken der Akteurinnen und Akteure
in ihrer Verwobenheit mit gouvernementalen Regulationsstrukturen
von Arbeit und Nicht-Arbeit einbezieht und insbesondere [um] Wandlungsprozesse, wie sie sich mit den Begriffen vom Fordismus zum Postfordismus oder auch mit Hilfe der Konzepte Flexibilisierung, Subjektivierung und Prekarisierung analysieren lassen.“ (Götz, 2011: 88)
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den „kreative[n], eigensinnige[n]
Praktiken“ (ebd.), auf den Kämpfen der Migration und der Arbeit und
darauf, wie diese in Aushandlung treten mit Prozessen der Prekarisierung, Rassifizierung und Ausbeutung. Ich zeige auf, dass die Arbeitskämpfe nicht von denen der Migration und von sozialen Kämpfen zu
trennen sind, und gehe darauf ein, wie Konzeptualisierungen der Prekarisierung und Analysen von Ausbeutungsverhältnissen einander ergänzen können. Dabei nehme ich Bezug auf theoretische Debatten, die
Prekarisierung als gouvernementale Regierenstechnologie diskutieren
(vgl. Lorey, 2012; Papadopoulos, Stephenson & Tsianos, 2008) und in den
– unter dem Namen EuroMayday34 bekannten – sozialen Bewegungen
der Prekären der 2000er Jahre ihren Ausgang nahmen. Darauf aufbauend werfe ich die Frage auf, inwiefern die Differenzierung zwischen
imperceptible politics (unwahrnehmbare Politiken) und representational
politics (sichtbarwerdende Politiken) (vgl. Papadopoulos, Stephenson
& Tsianos, 2008; Tsianios, 2007) hilfreich ist, um die aktuellen Kämpfe
der EU-Migrant*innen gegen Prekarisierung, Kontrolle und Ausbeutung, die teilweise über den (Sozial-)Staat hinausgehen, aus kulturanthropologischer Perspektive zu verstehen. Als erstes möchte ich aber
noch einmal auf die Szene vor Gericht zurückkommen, um genauer
zu betrachten, wie die Frauen hier versuchen, der Rassifizierung und
34
Der Euromayday ist ein transnationaler Organisierungsversuch, der
auf die Krise der traditionellen Gewerkschaftsbewegungen reagierte, in dem er
von der Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse ausging und nach
neuen, kreativen Widerstandsmöglichkeiten und Formen der Kollektivierung
der Prekären suchte (vgl. Birkner & Mennel, 2006; Casas-Cortés, 2009; Frassanitos-Netzwerk, 2005). Der traditionelle Arbeiterkampftag des Ersten Mais wurde
als (Euro-)Mayday umgetauft. Von Mailand, wo im Jahr 2001 die erste MayDayParade stattfand, breitete sich die Bewegung auf bis zu 40 europäische Städte
aus (vgl. Hamm & Sutter, 2010). Ein Archiv der EuroMayDay-Bewegung findet
sich auf http://www.protestmedia.net.
77
�der disziplinierenden Zurückweisung auf ihre untergeordnete Rolle als
Arbeiter*innen zu begegnen.
Rassistische Anrufungen vor Gericht
In der Szene vor Gericht wurde das ungleiche Verhältnis zwischen Arbeiterinnen und Unternehmer sowohl (re-)produziert wie auch angegriffen. Auf der einen Seite ermöglichte das Gericht als Staatsapparat
den Frauen, ihren ehemaligen Arbeitgeber dazu zu zwingen, ihnen gegenüberzutreten und ihn im Sinne des Vertrages über den Verkauf ihrer Arbeitskraft dafür verantwortlich zu machen, dass er ihnen Lohn
vorenthalten hatte. Auf der anderen Seite wurden sie mit Dynamiken
konfrontiert, die die Ungleichheit des Verhältnisses perpetuierten und
das Einfordern ihrer Arbeitsrechte erschwerten. Die Frauen wurden vor
Gericht als Angehörige des (migrantischen) Lumpenproletariats angerufen, weil sie sich während der Verhandlung nicht so verhielten „wie
es sich gehört“. Weil wir miteinander geflüstert und gelacht hatten, statt
der Autorität des Gerichts zu lauschen, weil die Frauen kein Deutsch
sprachen, weil sie ein Kopftuch trugen und weil sie Forderungen stellten, die auf handschriftlichen Notizen und mündlichen Aussagen beruhten, entsprach ihr Auftritt vor Gericht dem bürgerlichen Habitus
nicht. Das Arbeitsgericht kanalisierte den Arbeitskampf in die Raster
der Rechtsform sowie des bürgerlich-disziplinierten und deutschsprachigen Settings, innerhalb dessen ihr - bzw. unser - Auftreten als ungenügend und ungehörig markiert wurde. Das souveräne Auftreten des
Arbeitgebers hingegen wurde seitens des Gerichts honoriert. Dass die
Situation auch von rassistischen Logiken und Machtverhältnissen geprägt war, lässt sich an der Verwendung des Begriffs „Clan“ festmachen, mit dem der Beklagte die Klägerinnen und ihr Verhalten während
des Arbeitsverhältnisses markierte. Das Wort „Clan“ steht als rassistische, antiziganistische Kennzeichnung in der Nähe von Vorstellungen
der „Mafia“, organisierter Kriminalität und Bildern „vormoderner“
Gesellschaft (vgl. End, 2014). Dr. Goffmann untergrub die individuelle Vernunft und Freiheit der Frauen, indem er eine Art vormodernen
Gruppenzwang skizzierte, der vom „Clan“ ausginge und dem die Individualität der Einzelnen unterläge. Er legte dem Gericht nahe, es habe
sich um einen geschickt eingefädelten Betrugsversuch gehandelt - quasi
um organisierte Kriminalität. Sein rechtschaffenes Unternehmen und
78
�die liberalen Werte der Individualität, Vernunft und Freiheit sehe er
von einer kriminellen Clanstruktur bedroht. Der Unternehmer stellte
sich so in einer Art Opfer-Täter-Umkehr indirekt selbst als Opfer dar35.
Gleichzeitig versteckten sich in dieser Täter-Opfer-Analogie auch sexistische Logiken, indem die Frauen als Opfer patriarchaler Clanstrukturen
dargestellt wurden. Verschiedene Studien haben in den letzten Jahren
aufgezeigt, wie Frauen in der Migration eher als Opfer von Kriminalität und vormodernen Familienstrukturen, denn als Akteure gesehen
werden (vgl. Andrijašević, 2007; Bahl & Ginal, 2009; Bahl, Ginal & Hess,
2010). Darüber hinaus waren die rassistischen Artikulationen, die in der
Gerichtsverhandlung zum Ausdruck kamen und insofern sie hier als Gefahren für die persönliche Freiheit, die Emanzipation der Frau und das
Selbstunternehmertum konstruiert wurden, typisch für die aktuellen
Formationen des postliberalen Rassismus, in denen die liberalen Werte
der ,aufgeklärten‘ westlichen Gesellschaft vermeintlich durch illiberale
Minderheiten, Fremde, Andere in Gefahr gebracht werden (vgl. Lentin
& Titley, 2011; Tsianos & Pieper, 2011). Durch diese flexibilisierten rassistischen Dynamiken, die sich mit dem ungleichen sozialen Verhältnis
zwischen den Subproletarierinnen und dem Unternehmer mit bürgerlichem Habitus verschränkten, wurde die Machtposition des Unternehmers vor Gericht gestärkt, während der Widerstandsversuch der Arbeiterinnen sogar davon bedroht war, strafrechtlich verfolgt zu werden.
Der rassifizierende Blick des Unternehmers auf seine Angestellten war
mir schon zuvor aufgefallen. Als ich die Telefonnummer des Unternehmens im Internet suchte, stieß ich auf seine Internet-Präsenz, in der sich
Kontinuitäten kolonialer Blickregime und exotisierender Fantasien von
weiblicher, rassifizierter Hausarbeit zeigten. Konkret handelt es sich um
das Intro der Website, mit dem Dr. Goffmann potenzielle Kundschaft
und andere Besucher*innen begrüßt. Es zeigt eine Figur – den Griff eines Staubwedels? – mit weißem Bastrock – die Haare des Putzwerkzeugs? –, die sich im Takt gedämpfter Tangomusik wiegt. Die Figur
ist aus dunkelbraunem Holz, poliert und phallusförmig. Oberhalb von
35
Diese Strategie der Opfer-Täter-Umkehr wurde noch deutlicher, als
der Beklagte für den nächsten Verhandlungstermin Polizeischutz für die Objektleiterin beantragte, da diese angeblich während des hier beschriebenen Termins von Seiten der Klägerinnen bedroht worden sei. Die Anwältin der Klägerinnen konnte belegen, dass es sich dabei um eine Lüge handelte, die offenbar
als gezielter Versuch der Diffamierung der Klägerinnen dem Gericht gegenüber
wirken sollte.
79
�dieser ist eine Grafik einmontiert mit großen roten, geöffneten Lippen,
zwischen denen zwei sehr weiße Schneidezähne über einer rosa Zunge
zu sehen sind. Während sich die augenlose, aber durch den Mund als
Gesicht markierte Grafik dem Betrachter zuwendet, weisen die hochhackigen Stiefel, die unterhalb des Bastrocks als schwarze Piktogramme zu
erkennen sind, nach rechts. Durch diese Drehhaltung wird der kokette
Ausdruck der wiegenden Bewegung noch verstärkt. Bildlich hat der Unternehmer sein Angebot also auf eine historisch entstandene kulturelle Imagination von einer guten Putzkraft als weiblich (sexy, verfügbar,
ohne Verstand oder gar aktiven Blick) und Schwarz (primitiv, tanzend,
weiße Zähne im lächelnden Mund) abgestimmt – wohl ohne dies selbst
zu reflektieren oder zu intendieren, aber nichtsdestotrotz in der Folge
der subkutanen Kontinuitäten kolonialer Blickregime, Macht- und Ausbeutungsverhältnisse. Denken wir die Analyse der Ausbeutungs- und
Machtverhältnisse in diese Richtung konsequent weiter, entsteht ein
Bild von sexualisierten, rassifizierten Marionetten, die nach den Interessen des Kapitals tanzen. Doch dieses Szenario stimmt nicht mit der
Realität des Arbeitskampfs von Nadja Bozhkova und ihren Freundinnen, die sich gegen ihre (Über-)Ausbeutung wehrten, überein. Es stellt
gesellschaftliche Verhältnisse als zu determiniert dar und unterschlägt,
dass diese ein Effekt ständiger antagonistischer Aushandlungen sind.
Die Arbeiterinnen lassen sich nicht auf das Bild der Marionetten, noch
auf den Gegenentwurf des betrügerischen Clans, aber auch nicht auf
Vorstellungen von Klägerinnen im bürgerlichen Rechtsstaat beschränken.
Representational und Imperceptible Politics
Indem sie vor Gericht gingen, beschritten Nadja Bozhkova und ihre
Freundinnen zum einen den staatlich vorgegebenen Weg, um ihre
Rechte einzuklagen und ihren Lohn einzufordern. Ziel des Arbeitskampfes war, dass der Unternehmer den vereinbarten Lohn auszahlt.
Das Gericht und die staatlich garantierten Arbeitsrechte stellten ein
Instrument dafür dar, dieses Ziel durchsetzen zu können. Um es nutzen zu können, mussten die Frauen als Subjekte sichtbar werden,
das heißt, sich in die staatlichen Raster der Anerkennung als Subjekt
einpassen, um so rechtlich wahrgenommen zu werden. Dies wurde
nicht erst während der Gerichtsverhandlung, sondern bereits dann
80
�zum Problem, als wir Gerichtskostenhilfe beantragten. Der Zugang zu
Prozesskostenhilfe stellte für die Klägerinnen eine Bedingung dar, um
überhaupt vor Gericht gehen zu können, da sie ihre Anwältin sonst
nicht hätten bezahlen können. Prozesskostenhilfe muss mit einem
mehrseitigen Antrag – der als Vorlage nur auf Deutsch zur Verfügung
steht – beantragt werden. Als Nachweis der Angaben verlangt die zuständige Stelle eine Reihe von Papieren, zum Beispiel Einkommensnachweise, Kontoauszüge, Mietverträge.36 Die Lebensrealität der Klägerinnen produzierte aber nicht all diese Papiere. Nicht alle der vier
Klägerinnen hatten ein Konto, geschweige denn einen schriftlichen
Mietvertrag oder gar eine (lückenlose) Dokumentation ihres Einkommens oder überhaupt ein Einkommen – schon alleine deswegen, weil
sie nicht durchgängig und nicht immer dokumentiert Geld verdienten.
Wir sandten die wenigen vorhandenen Papiere und einen erklärenden
Brief ein, aber dies reichte noch nicht aus, um das Problem zu lösen.
Bei einer Klägerin äußerte die zuständige Rechtspflegerin schriftlich
den Verdacht, dass das „Einkommen aus [sic] Minijob kaum ausreichend für Lebenserhaltungskosten, Mietkosten“ sei, die Klägerinnen
also falsche bzw. unvollständige Angaben machten. Wegen eines zu
geringen Einkommens – sprich: Armut – verdächtigte sie diese also
des Betrugs und wollte den Antrag ablehnen. Erst nach einem langwierigen Telefonat, in dem ich ihr erklärte, dass die prekären Lebensrealitäten der Antragstellenden eben über ihre Vorstellungen eines
‚normalen‘ Lebens hinaus gingen, dass es sich hier um ein Leben ‚von
der Hand in den Mund‘ handelte, ließ sie sich von der tatsächlichen
Bedürftigkeit und somit dem Anspruch auf Prozesskostenhilfe überzeugen. Die Antragstellenden mussten neben den vorhandenen Papieren nur noch eine eidesstattliche Bezeugung der Hilfebedürftigkeit
einreichen. Staatliche Leistungen wie Prozesskostenhilfe zu beantragen, ist für Personen, die (Amts-)Deutsch nicht gut beherrschen und
außerhalb der Papiere produzierenden ‚Normalität‘ stehen, also extrem schwierig. Sie müssen erst als anerkannte Subjekte wahrnehmbar
werden und sich so in das Raster des „double-r-axiom“ (Papadopoulos,
Stephenson & Tsianos, 2008: xiv) einpassen, beziehungsweise die Anerkennung ihrer Lebensform aus der Perspektive des Regierens erstreiten.
36
Diese und ähnliche Papiere sind nicht nur Voraussetzung für Gerichtskostenhilfe, sondern auch für viele andere staatliche Leistungen wie die
Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialhilfe, Notunterbringung, etc.
81
�Als „double-r-axiom“ benennen Dimitris Papadopoulos, Vassilis Tsianos
und Niamh Stephenson (2008) in ihrem Buch Escape Routes – Control
and Subversion in the Twenty-first Century die Kopplung von Rechten
und Repräsentation, die das Fundament staatlicher Souveränität darstellt. Subjekten, die der Nationalstaat einer anerkannten sozialen Gruppe zugeordnet hat, teilt er entsprechend ihrer Zuordnung Rechte zu:
„[I]n the process of the expansion and consolidation of the nation state,
exclusion is not the primary concern; rather what solidifies the centrality of the state in modern sovereigntly is a form of differential inclusion of certain social groups through granting rights (social, civil and
political).“ (ebd.: 5)
Die Zugehörigkeit von Individuen zum Staat wird auch als Bürgerschaft
gefasst, an die Bürgerschaftsrechte geknüpft sind. Bürgerschaft geht im
Umkehrschluss immer auch mit Grenzen und mit Souveränität einher:
„This is the predicament of citizenship. It feeds from the power of sovereignty to erect and maintain borders – borders that it cannot ultimately fully control. Citizenship cannot be thought outside of sovereignty and control.“ (Papadopoulos & Tsianos 2013: 183)
Weil Bürgerschaft also immer schon auf Ausschluss beruht und nicht
von der „Desorganisation der Beherrschten“ (Karakayalı & Tsianos,
2002: 263) zu trennen ist, habe ich mich dagegen entschieden, den Begriff
der acts of citizenship von Engin Isin und Greg Nielsen (2008) zu nutzen.
Statt von Vornherein politische Kämpfe, die sich auch an den Grenzen
und außerhalb von bürgerschaftlichen Feldern und (in)formellen Gesellschaftsverträgen bewegen, auf das Feld der citizenship zu begrenzen, konzeptionalisiere ich sie lieber mit den Autor*innen von Escape
Routes als imperceptible und representational politics (Papadopoulos,
Stephenson & Tsianos, 2008: xv). Representational politics bezeichnet
in diesem Rahmen die klassische Form des Stellens von Ansprüchen auf
Anerkennung und/oder Ressourcen und/oder Rechte einer sich in Relation mit dem Staat identifizierenden Gruppe. Es geht dabei nicht unbedingt um bürokratische Praktiken, sondern darum, aus der Perspektive
des staatlichen Regierens sichtbar zu werden, um Politik im liberaldemokratischen Verständnis. Beispiele für representational politics sind
82
�Petitionen, Rechte und Anerkennung fordernde Demonstrationen, aber
auch andere Ausdrucksweisen, die Subjekte identifizieren und in deren Namen Forderungen an den Staat stellen. Klassisches Beispiel sind
die Forderungen nach Gleichberechtigung von Frauen, Homosexuellen,
Menschen mit Behinderung oder Migrant*innen – die Liste lässt sich
noch viel weiter führen.
Auch wir versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen, um die widerfahrene Ungerechtigkeit und die Forderungen der Arbeiterinnen an die
Öffentlichkeit zu bringen und so auch den Druck auf den Arbeitgeber
zu erhöhen. Neben der Klage vor dem Arbeitsgericht, die sich direkt
an den Staat adressierte und Arbeitsrechte einforderte, veranstalteten
wir ein Pressegespräch, an dem einige interessierte Journalist*innen
teilnahmen. Doch diese erklärten, erst berichten zu können, sobald ein
Gerichtsurteil vorläge, denn der Beklagte habe gedroht, sie wegen Rufschädigung rechtlich zu belangen.
Die Autor*innen des Buches Escape routes argumentieren aber auch,
dass die identitäre Festschreibung und Sichtbarwerdung im Zuge von
representational politics dem Interesse des heutigen Regierens entsprechen, weil sie greifbare Subjekte schaffen und sozial-flexible Soziabilitäten einschränken. Zudem seien representational politics angesichts postnationaler und post-liberaler Versuche des Regierens, die nicht mehr auf
dem Double-R-Axiom des national-sozialen Staats beruhen, nur noch
eingeschränkt wirkmächtig. Neben den representational politics prägen sie den Begriff der imperceptible politics of escape. Diese „unwahrnehmbaren Politiken des Entfliehens und sich Entziehens“ (vgl. auch
Lorey, 2011) sehen sie als wichtigste Form des Widerstands in Zeiten
der postliberalen Technologien des Regierens, wie der gouvernementalen Regierungstechnologie der Prekarisierung, auf die ich weiter unten
noch eingehen werde. Hier möchte ich argumentieren, dass sich auch
die Praktiken der Frauen nicht auf die representational politics beschränken ließen, sondern darüber hinausgingen. Schon allein dadurch, dass
wir Spaß hatten und im Gerichtsgebäude gemeinsam lachten, entzogen
wir uns der Disziplinierung und den Subjekt-Anrufungen vor Gericht
vielmehr, als dass wir an ihnen scheiterten. Dies wurde noch unterstützt
dadurch, dass wir kollektiv auftraten und gegenseitige Unterstützung
übten. So erteilten wir dem Bild der disziplinierten Erwerbstätigen eine
Absage. Gleichzeitig drehten wir als kollektiver Akteur auch das rassifizierte Bild des „Familienclans“ um. Statt als passive Opfer die Erzählung
83
�des Unternehmers zu untermalen, wurden wir als selbstbewusste, fröhliche Frauen aktiv. Unsere eigenwilligen Praktiken stellten sich also
sowohl der Disziplinierung und rassistischen Markierung vor Gericht
wie auch der Viktimisierung durch den Arbeitgeber entgegen. Dies geschah aber ohne Intention oder politische Botschaft, sondern bloß aus
dem Verlangen heraus, über diese Ordnung hinauszukommen und sich
nicht zu stummen, passiven Besucherinnen machen zu lassen. Durch
unser Lachen verließen wir das Feld der Politik des Sichtbar-Werdens,
die Forderungen an den Staat stellt und durch Sichtbarkeit Erfolg hat,
und entwichen in unwahrnehmbare Politiken, in
„produktive Subjektivierungsprozesse, in denen [ ], ein überschüssiges Potential an Affektivität und Soziabilität produziert wird, das es
ermöglicht, den normativen Strukturierungen zu entfliehen.“ (Pieper,
Panagiotidis & Tsianos, 2011)
Gleichzeitig war das Ziel der Klage gegen den Arbeitgeber aber nicht,
den Versuchen des Regierens vor Gericht zu entgehen, das war sozusagen ein überschüssiges Nebenprodukt, sondern, den vorenthaltenen
Lohn einzuklagen. Ob es in Bezug auf dieses Ziel für die Frauen hilfreich
(etwa weil wir unberechenbar wirkten) oder doch eher kontraproduktiv
war, sich nicht gänzlich an die erwarteten Umgangsformen zu halten,
kann schwer festgehalten werden. Nach einigen Monaten Verhandlungen nahmen beide Parteien jedenfalls ein Vergleichsangebot des Richters an und die Klägerinnen erhielten etwa die Hälfte des ursprünglich geforderten Geldes. An die Öffentlichkeit konnten wir mit diesem
Ergebnis nicht gehen, da es ja immer noch zu keinem rechtskräftigen
Urteil gekommen war.
Im Folgenden möchte ich genauer auf den Arbeitskampf der Frauen eingehen. Ich bette ihn in die Arbeitsverhältnisse im Reinigungsgewerbe
und in den Kontext des Tagelöhnermarkts ein und frage, inwiefern die
Begriffe der Prekarisierung und Ausbeutung zu ihrem Verständnis weiterhelfen. Es stellt sich heraus, dass die Arbeitskämpfe der Frauen nicht
getrennt von ihrem Migrationsprojekt zu verstehen sind und auch die
Frage nach den imperceptible politics wird wieder eine Rolle spielen.
Mehr arbeiten für weniger Lohn?! Migrantische
Arbeit im Reinigungsgewerbe
84
�Der Arbeitskampf der Frauen ist Teil der aktuellen Entwicklungen im
Reinigungsgewerbe als Teil des Niedriglohnsektors und der migrantisch
geprägten Segmente des Arbeitsmarktes. Zum einen schwächt die relative Entrechtung migrantischer Lohnabhängiger ihre Verhandlungsstärke gegenüber den Arbeitgeber*innen. Dies trifft zwar ganz besonders bei aufenthaltsrechtlich illegalisierten Personen zu, die durch ihren
Status erpressbar werden, weil der*die Arbeitgeber*in sie bei der Polizei anzeigen kann, oder auch bei migrantischen Arbeitnehmer*innen,
deren Aufenthaltsgenehmigung an ihre Arbeitsvertrag gebunden ist,
denn sie müssen das Land verlassen bzw. in die Illegalisierung abtauchen, wenn ihnen gekündigt wird. Doch auch Unionsbürger*innen
haben gegenüber von Inländer*innen weniger Rechte. Ihr Zugang zu
sozialen Leistungen wird zunehmend erschwert, wie ich in Kapitel 5
bis 7 diskutiere. Bulgarische und rumänische Staatsbürger*innen durften zudem bis zum 1. Januar 2014 nur mit Arbeitserlaubnis arbeiten,
ihre Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit war noch eingeschränkt.37 Die
Ausschlüsse von Migrant*innen gehen aber über das Rechtliche hinaus und sind tief in rassistischen Praktiken verwurzelt. Insbesondere
die Einsprachigkeit der Behörden in einer mehrsprachigen Gesellschaft
führt zu erschwerten Bedingungen. Dazu kommen weitere Formen des
institutionellen Rassismus, die Migrant*innen tendenziell schnell des
‚Sozialschmarotzens‘, der Wegnahme von Arbeitsplätzen etc. verdächtigen. Schon die polizeiliche Anmeldung, die Voraussetzung für ein
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ist, wird (EU-)
Migrant*innen oft verweigert, wie noch deutlich werden wird.
37
Die Arbeitserlaubnis-EU musste bei der Zentralen Auslands- und
Fachvermittlung (ZAV) für einen konkreten Arbeitsplatz beantragt werden. Die
ZAV prüfte, ob es bevorrechtigte Bewerber*innen (Inländer*innen und auch
Unionsbürger*innen aus älteren Mitgliedsstaaten) gab und ob die Arbeitsstelle
das geltende Arbeitsrecht (z.B. den Tariflohn) erfüllte. Fachkräfte mit Hochschulabschluss mussten bei entsprechend qualifizierter Beschäftigung keine
Arbeitserlaubnis-EU beantragen. Seit der Aufhebung der Einschränkung der
Arbeitnehmerfreizügigkeit ist es für Arbeitssuchende tendenziell einfacher,
eine dokumentierte Arbeit zu finden. Ich frage in dieser Arbeit aber nicht zentral nach dieser Einschränkung, ihrer Effekte und ihrer Rolle in den Aushandlungen des Regierens der EU-internen Migration. Sie wird im Folgenden nur
gelegentlich eine untergeordnete Rolle spielen.
85
�Es ist aber nicht nur die besonders Migrant*innen betreffende Politik
der Entrechtung und der rassistischen Sonderbehandlung, sondern dazu
kommen eine Reihe politischer Instrumente zur Liberalisierung der
Arbeitsmärkte, die allesamt zu einer Verschärfung von Ausbeutungsverhältnissen führen. Der Ausbau des Niedriglohnsektors durch die
Förderung von flexiblen Arbeitsverhältnissen in Form von Leiharbeit,
Minijobs, (Schein-)Selbstständigkeit und Werkverträgen (vgl. Keller,
Schulz & Seifert, 2012; Riedner & Zehmisch, 2009; Schröder, 2015) sowie
der Abbau von Arbeitsrechten und die neoliberale Umstrukturierung
des Sozialwesens zur aktivierenden workfare-Politik (vgl. Hirsch, 2015;
Peck, 2001; Wacquant, 2011) verunsichern Arbeits- und Lebensverhältnisse, erhöhen Profitspannen und betreffen einen Großteil der Bevölkerung.
Private Unternehmen wie auch öffentliche Einrichtungen lagern anfallende Reinigungsarbeiten seit den 1970er Jahren zunehmend an private Reinigungsunternehmen aus und entledigen sich so der direkten
Verantwortung und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den
Lohnabhängigen. Die preisgünstigsten Angebote bekommen den Zuschlag für die ausgelagerten Reinigungsaufträge; es entsteht ein harter
Wettbewerb – ein race to the bottom. Reinigungsunternehmen haben
kaum eine andere Möglichkeit als die Lohnschraube anzuziehen, um
im Wettbewerb zu bestehen und ihren Profit zu maximieren. Denn die
Personalkosten machen mit bis zu 87 Prozent den größten Anteil der
Ausgaben der Betriebe aus, wie eine im Jahr 2005 veröffentlichte Studie
zeigt (vgl. Gather et al., 2005). Um die Lohnsenkungen zu begrenzen,
gibt es seit 2007 einen tariflichen Mindestlohn. Doch garantiert der im
Reinigungsgewerbe geltende Mindestlohn von 9,31 Euro brutto (Stand
2014), der bei Vollzeitarbeit einem Netto-Monatsgehalt von etwa 1000
Euro pro Monat entspricht, in München kaum einen guten Lebensstandard. Zudem wird auch dieser Mindestlohn systematisch unterschritten. Im Rahmen meiner Arbeit im Workers’ Center habe ich regelmäßig
Arbeiter*innen dabei unterstützt, gegen Lohnbetrug vorzugehen. Dabei
sind mir auch in anderen Branchen des Niedriglohnsektors, zum Beispiel in der Baubranche, eine Reihe von Strategien der Unternehmen begegnet, die Löhne zu senken, etwa durch versteckte Akkordarbeit (wenn
die Stundenzahl pro Fläche oder Stückzahl festgesetzt wird), durch unbezahlte Probe- und Überstunden oder durch gefälschte Abrechnungen.
86
�Immer wieder waren die Arbeitgeber*innen auch einfach nicht mehr zu
finden.
Es ist festzuhalten, dass die Bandbreite der Arbeitsverhältnisse von im
Niedriglohnbereich arbeitenden Unionsbürger*innen weiter gefasst ist,
als die öffentlich werdenden Berichte von fast ausnahmslos undokumentierten, extrem ausbeuterischen Verhältnissen glauben machen.38
Zum einen gehen nicht alle Arbeitsverhältnisse über den gesellschaftlich akzeptierten Grad der Ausbeutung hinaus, zum anderen sind nicht
alle Arbeitsverhältnisse undokumentiert. Neben den regulären sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen mit Arbeitserlaubnis und
selbstständigem Kleinunternehmertum gibt es nicht nur gänzlich informelle, mündliche Arbeitsverträge39, sondern auch eine große Bandbreite
dazwischen. Wichtig ist hier herauszustellen, dass weder formalisierte
Beschäftigungsverhältnisse vor Lohnbetrug gefeit noch informelle Beschäftigungsverhältnisse automatisch überausbeutend sind.
Die Arbeitnehmer*innen wechseln oft den Arbeitsplatz - sei es, weil
sie kündigen oder weil sie gekündigt werden; die Fluktuation ist also
insgesamt sehr hoch. Immer wieder finden Arbeiter*innen aber auch
längerfristige Anstellungen mit festen Arbeitszeiten. Den üblichen
38
Auch in meiner Forschung liegt ein Bias vor, da im Workers’ Center
der Initiative Zivilcourage und in anderen Beratungsangeboten natürlich diejenigen Arbeiter_innen vermehrt Unterstützung suchen, die betrogen wurden.
In Bezug auf den selbstorganisierten Arbeitsmarkt kann ich nur die Arbeitsverhältnisse, die mir während meiner Arbeit im Workers’ Center begegneten,
umreißen. Das Bild von den Arbeitsverhältnissen, das ich aus der Erfahrung
im Workers’ Center heraus zeichnen kann, ist deswegen sicherlich ein einseitiges, weil Arbeitnehmer*innen, die mit ihrem Arbeitsverhältnis zufrieden
waren, keinen Grund hatten, unsere Unterstützung zu suchen und Dienstag
vormittags tendenziell auch arbeiteten. Von Arbeitsverhältnissen, mit denen
die Arbeiter*innen zufrieden waren, erfuhr ich nur, wenn ich direkt nach vergangenen Arbeitsverhältnissen fragte oder mich mit von früher bekannten Personen über ihre aktuelle Lohnarbeit unterhielt. Für eine genauere Analyse der
Arbeitsverhältnisse war meine Forschung, wie in der Einleitung erwähnt, nicht
ausgelegt. Dazu wäre es unter anderem sinnvoll gewesen, am Arbeitsplatz zu
forschen.
39
Auch wenn informellen Arbeitsverhältnissen im Diskurs zu Migration meiner Ansicht nach überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit gewidmet
wird, sind sie selbstverständlich kein Alleinstellungsmerkmal migrantischer
Arbeit, sondern auch unter Lohnabhängigen mit deutschem Pass weit verbreitet.
87
�Stundenlohn schätze ich auf 8 bis 15 Euro (brutto) ein. Oft handelt es
sich um schwere körperliche Gelegenheitsarbeiten, die wenig oder
keine Ausbildung benötigen und deswegen spontan anzuwerben und
auch zu kündigen sind. In einer Art Zirkulationsverfahren können
Arbeitgeber*innen ihre ungelernten Kräfte abstoßen, sobald diese etwa
den verabredeten Lohn verlangen, und haben aufgrund des großen Angebots schnell neue Arbeitskraft zur Hand. Arbeitsverhältnisse bestehen oft nur für einige Wochen oder Monate. Die Arbeitsplatzmobilität kann auf der anderen Seite aber auch als Verhandlungsstärke der
Arbeiter*innen betrachtet werden, worauf ich später noch zurückkommen werde (vgl. Alberti, Holgate & Tapia, 2013).
Viele Arbeiter*innen fanden aufgrund ihrer Türkischkenntnisse Zugang zu türkischsprachigen ökonomischen Netzwerken, die vor allem
von ehemaligen „Gastarbeiter*innen“ im Laufe der letzten Jahrzehnte
aufgebaut wurden. Oft arbeiten Subunternehmen den größeren Reinigungsunternehmen zu und es entstehen schwer nachvollziehbare Ketten an Sub-Sub-Subunternehmen. Dies trägt zur Stratifizierung der Arbeitsverhältnisse bei, so dass die Beschäftigten an einem Arbeitsplatz
verschiedenen Chefs unterstellt sind und sich schwieriger kollektiv organisieren können.
In diesem Kontext haben Nadja Bozhkova und ihre Freundinnen Anfang 2014 - direkt nach dem Wegfall der Einschränkung der Freizügigkeit für bulgarische und rumänische Staatsbürger*innen - für
knappe sechs Wochen in einem öffentlichen Münchner Gymnasium
als Reinigungskräfte gearbeitet. Ohne weitere Subunternehmen waren sie direkt bei dem Unternehmen Dr. Goffmann sozialversicherungspflichtig dokumentiert angestellt. Sie putzten Klassenräume,
Büros, Toiletten und Gänge und arbeiteten so lange, bis die vorgegebene Fläche gereinigt war. Die Stundenzahl vermerkten sie auf
einem Notizzettel. Mitte Februar endete dann das Arbeitsverhältnis
im Zuge der Auseinandersetzung um die Höhe der Lohnzahlungen.
Das Unternehmen hatte nämlich weniger Stunden abgerechnet, als
die Arbeiterinnen auf ihren Stundenzetteln vermerkt hatten. Vereinbart hatten sie den tariflichen Mindestlohn von 9,31 Euro pro
Stunde brutto. Gezahlt wurde aber nicht pro gearbeiteter Stunde,
sondern für eine festgesetzte, pauschale Stundenzahl pro Fläche. So
wurden an neun Tagen nur vier Stunden abgerechnet, während die
88
�Frauen jeweils sechs Stunden notiert hatten.40 Zudem erhielten sie
für die ersten drei Tage und die letzte Woche gar keine Bezahlung.
Nadja Bozhkova und Bozhurka Chavdarova wurden so von 166 notierten Stunden nur 96 ausgezahlt. Auch die rechtlich zustehenden
Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit wurden nicht beglichen.
Das Unternehmen hatte unter dem Deckmantel von ‚Probezeit‘ bzw.
unbezahlter Vorableistung und durch versteckte Akkordarbeit Lohnkosten eingespart. Aber Nadja Bozhkova und ihre Freund*innen ließen sich das nicht gefallen. Zuerst leisteten sie am Arbeitsplatz Widerstand, indem sie gemeinsam arbeiteten, statt alleine, und Pausen
machten. So kam es schon während der Arbeitszeit zu Konflikten.
Nonka Angelova, die gar keinen Vertrag hatte, berichtete, wie ihr die
Objektleiterin eines Tages Hausverbot erteilte, sie beleidigte und ihr
den ausgestreckten Mittelfinger zeigte, weil sie ihren Freund*innen
bei der Arbeit geholfen hatte. Nachdem die Frauen im Zuge der Auseinandersetzungen um ihren Lohn die Arbeit verloren hatten, riefen
sie das Unternehmen mehrmals an und suchten das Büro des Unternehmens persönlich auf, um ihren Lohn einzufordern. Als dies zu
keinem Erfolg führte, suchten sie sich Verbündete und kamen in das
Workers’ Center. Auf Grundlage ihrer Stundenzettel und des tariflichen Mindestlohns überschlugen wir die ausstehenden Beträge von
etwa 700 Euro brutto pro Person. Ich sollte den Arbeitgeber anrufen
und das Geld einfordern. Die Gesprächspartner*innen, die sich dort
meldeten, wirkten auf mich durchweg sehr hilfsbereit und eloquent.
Sie versicherten, das Unternehmen sei rechtschaffen, eben „keine
dieser Hinterhoffirmen“, und die Angelegenheit würde selbstverständlich geklärt. Tatsächlich schickten sie uns auf unsere Aufforderung hin die Lohnabrechnungen der Frauen zu. Auf Grundlage dieser
Abrechnungen, des Mindestlohn- und Rahmentarifvertrages und der
Stundenzettel der Frauen erstellten wir Geltendmachungen - schriftliche Zahlungsaufforderungen mit Angabe der Stundenzahlen und
des ausstehenden Betrages. Die versprochene Stellungnahme wurde über zwei Monate lang Woche für Woche hinausgeschoben. Wir
blieben hartnäckig, fragten jede Woche telefonisch nach, erhielten
40
Nach Aussage der Anwältin der Klägerinnen ist dies gängige und sogar transparente Praxis im Reinigungsgewerbe, hat aber im Falle von Klagen
normalerweise keinen Bestand vor Arbeitsgerichten.
89
�aber bis auf aufschiebende Worte keine weitere Reaktion. Schließlich
entschieden sich die Frauen, vor Gericht zu gehen.41
Inzwischen hatten sie schon längst neue Arbeit gefunden. Zümbül Eseva
und Bozhurka Chavdarova reinigten KIK und EDEKA Filialen, während
Nadja Bozhkova Reinigungskraft bei Karstadt war. Sie arbeiteten für
eine Subunternehmerin, die für verschiedene Auftraggeber*innen tätig war. Auch hier waren sie nicht ganz zufrieden, weil sie unbezahlte
Überstunden leisten mussten. Diesmal wollten sie aber (noch) nicht gegen die Arbeitgeberin vorgehen, weil sich die Überstunden in Grenzen
hielten.
Ausbeutung und Überausbeutung
Dem marxistischen Verständnis von Ausbeutung folgend, verstehe ich
das Verhältnis zwischen Unternehmer und Lohnarbeiterinnen als ein
antagonistisches.42 Dr. Goffmann zahlt nur einen Teil des Wertes, der
durch die Arbeit der Lohnabhängigen entsteht, als Lohn sowie indirekten Lohn in Form von Sozialabgaben an die Arbeiter*innen aus. Um
seinen Profit zu steigern, liegt es in seinem Interesse, die Lohnkosten
zu senken. Im Interesse der Arbeiterinnen liegt es hingegen, möglichst
viel für den Verkauf ihrer Arbeitskraft zu erhalten - bzw. in diesem Fall
mindestens so viel wie eben anfangs und im Rahmen der staatlichen
Tarifvereinbarung vereinbart worden war. Eine andere Konfliktlinie in
Ausbeutungsverhältnissen läuft entlang der Produktivität und Effizienz
der Arbeitskraft. Auch bei den Frauen ging es schon während der Arbeitszeit um die Frage, wie viel Fläche sie in wie viel Zeit reinigen sollten und wie viele und wie lange ihnen Pausen zustanden. Ein Vorteil des
Marxschen Konzepts von Ausbeutung ist, dass es ein soziales Verhältnis beschreibt, in das die Widersprüche und die Widerständigkeit der
41
In vielen Fällen haben wir außergerichtlich Löhne eingetrieben. Zum
Beispiel erhielten vier Arbeiter, die Münchner U-Bahnhöfe gereinigt hatten
und insgesamt Euro 4.309,50 forderten, von dem Subunternehmer über 3.000
Euro ausgezahlt. Die Zahlung folgte auf unsere telefonischen und schriftlichen
Zahlungsaufforderungen, die sich über mehrere Wochen erstreckten.
42
Der Kampf für bessere Arbeitsverhältnisse wird dann erst ein Kampf
gegen Ausbeutung an sich, und nicht gegen zu viel Ausbeutung, wenn es sich
um einen Kampf handelt, der sich ganz grundsätzlich gegen die Verhältnisse
der Lohnarbeit richtet.
90
�Lohnarbeiter*innen schon eingeschrieben sind. Zudem wird durch eine
solche Perspektive, die Ausbeutungsverhältnisse nicht als Ausnahme,
sondern als Grundlage kapitalistischer Arbeitsverhältnisse begreift, der
Analysefehler vermieden, dass Ausbeutung eine Ausnahme sei, die nur
Arbeitsmigrant*innen, andere ‚Randgruppen‘ oder besonders skandalöse Arbeitsverhältnisse betrifft. Um aber genauer zu analysieren, in welchen Ausbeutungsverhältnissen die EU-migrantischen Arbeiterinnen
gearbeitet haben, möchte ich auf die Begriffe der Überausbeutung und
Debatten zur Prekarisierung zurückgreifen, die ich in der Einleitung
schon angeschnitten habe. Nach Étienne Balibar ist die „permanente
Tendenz zur Überausbeutung“ (Balibar, 1998: 216) Kennzeichen kapitalistischer Produktionsprozesse, die darauf angewiesen sind, die Profitrate immer weiter zu steigern. Überausbeutung gerät dabei aber leicht in
ein Spannungsfeld mit der „rationellen Organisation der Ausbeutung“
(ebd.) etwa
„wenn die Masse der Arbeiter auf einem sehr niedrigen Lebens- und
Qualifikationsniveau gehalten oder wenn es keine Sozialgesetzgebung
und demokratische Rechte gibt, die anderswo zur organischen Bedingung der Reproduktion und des Einsatzes der Arbeitskraft geworden
sind.“ (ebd.)
Sebastian Friedrich und Jens Zimmermann (2015) haben vorgeschlagen,
den Begriff der Überausbeutung explizit in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse von Migrant*innen zu verwenden. Die mit Rassismus verschränkte
Form von Überausbeutung43 funktioniere
„nur, wenn es Diskurse sowie juristische, politische und ökonomische
Praktiken gibt, die ‚migrantische Arbeitskraft‘ formieren und ihre Ausbeutung ‚unter dem Schnitt‘ legitimieren. [...] Rassismus als soziale
Praxis [...] sedimentiert sich in spezifischen Formen kapitalistischer
Ausbeutung.“ (ebd.)
43
Sie definieren Überausbeutung als „eine intensivere Ausbeutung der
Arbeitskraft durch Verringerung der Produktionskosten. Entweder, indem ein
im Verhältnis zum gesellschaftlichen Durchschnitt geringerer Lohn gezahlt
wird oder indem die Arbeitszeit im Verhältnis zum gesellschaftlichen Durchschnitt verlängert wird“ (Friedrich & Zimmermann, 2015).
91
�Während es auf der einen Seite zu kurz griffe, Migrationsregime und
Rassismus als Werkzeuge in den Händen des Kapitals und Lohnabhängige als nackte Arbeitskraft zu analysieren, heißt dies nicht, dass es
keinen Zusammenhang zwischen Regimen der Migration und Ausbeutungsverhältnissen gibt. Auch dies wird deutlich an der Geschichte und
den Arbeitsverhältnissen der vier Frauen. Sie mussten auch deswegen
relativ schlechte, überausbeutende Jobs annehmen, weil ihre Verhandlungsstärke durch die rassistische Strukturierung des Arbeitsmarkts und
des öffentlichen Diskurses, durch Ausschlüsse von staatlichen Leistungen und die Illegalisierung ihrer Arbeit über Jahre geschwächt wurde.44
Prekarisierung als Technologie des Regierens und
Quelle von Widerstand
Der aktuelle Prozess der Verunsicherung von Arbeits- (und Lebens-)
verhältnissen wird auch als Prekarisierung bezeichnet. In der weit gefächerten Forschungslandschaft zu den Stichworten Prekarität, Prekarisierung und Prekariat beziehe ich mich weniger auf die soziologischen
Kategorisierungen des einflussreichen französischen Soziologen Robert
Castel (2000, 2009), die im deutschsprachigen Bereich vor allem durch
Klaus Dörre und seine Kolleg*innen (vgl. z.B. Brinkmann et al., 2006)
bekannt geworden sind und die Gesellschaft in verschiedene Grade der
Verunsicherung einteilen, sondern auf Versuche, Prekarisierung als antagonistisches Feld zwischen Technologien des Regierens und den überschüssigen Praktiken der Arbeiter*innen zu konzeptionalisieren. Wird
der Begriff Prekarität oder insbesondere die Zuschreibung ‚Prekariat‘
als soziologische Kategorie zur Erklärung gesellschaftlicher Verhältnisse verwendet, droht er soziale Grenzen zu verschleiern (vgl. Lehnert,
2009: 27). Dies lässt sich exemplarisch festmachen an den Unterschieden
zwischen der sozialen Positionierung der migrantischen Reinigungsarbeiterinnen und der sozialen Verhältnisse der Akademiker*innen (inklusive mir), die sie begleiten. Dass sowohl die Klägerinnen als ungelernte
EU-migrantische Reinigungskräfte wie auch ich als Nachwuchsakademikerin mit Promotionsstipendium von Prekarisierung betroffen sind,
44
Es spielen sicherlich auch weitere Faktoren eine Rolle, wie die Segmentierung des Arbeitsmarktes und auch der Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten.
92
�ändert kaum etwas daran, dass sie als Angehörige des migrantischen
Subproletariats und ich als weiße, deutsche Bildungsbürgerin doch über
sehr unterschiedliche ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen,
gesellschaftliche Handlungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven
verfügen. Trotzdem erscheint mir die Frage interessant, welche Widersprüche sich in prekarisierten Verhältnissen auftun und welche Bündnisse und Widerstandsformen entstehen. Dabei orientiere ich mich an
Forschungen zu und aus der EuroMayDay-Bewegung und vor allem
an der Arbeit der Sozialwissenschaftlerin Isabel Lorey, die in Jahr 2012
das Buch Die Regierung der Prekären veröffentlicht hat. Sie spricht sich
dagegen aus, Prekarität im Sinne Castels (2000) – oder auch im Sinne
von Richard Sennett kulturpessimistischen Warnung vor der „Zersetzung des Charakters“ (Sennett, 1998) – „allein als Bedrohung und Unsicherheit“ (Lorey, 2012: 60) zu konzipieren, denn im „Modus der Abweichung“ (ebd.) sei es nicht möglich, die Prozesse der Prekarisierung
treffend zu analysieren. Dem hingegen gelte es zu fragen: „In welcher
Weise wird […] soziale Unsicherheit gegenwärtig zu einem Bestandteil gesellschaftlicher Normalität?“ (ebd.: 60). Zudem argumentiert sie,
dass Prekarität an sich nicht neu sei, sondern viel eher nur für einen
Teil der Bevölkerung – nämlich den männlichen, sesshaften, heterosexuellen und weißen Teil – im Sozialstaat des Fordismus durch soziale
Absicherung entschärft worden sei (vgl. auch Götz, 2012). Lorey unterscheidet zwischen drei Dimensionen des Prekären: Das Prekärsein, die
Prekarität und die Prekarisierung. Beim Prekärsein – in Anlehnung an
Judith Butlers „precariousness“ (Butler, 2006) – geht es um die „Gefährdetheit von Körpern, nicht nur weil sie sterblich, sondern gerade weil
sie sozial sind“ (Lorey 2012, 26). Das Prekärsein lässt sich also nicht als
individuelles, sondern nur als soziales, geteiltes Phänomen begreifen.
Bei der zweiten Dimension des Prekären, der Prekarität, handelt sich
um „gesellschaftliche Positionierungen der Unsicherheit“ (ebd.: 26), als
Effekt gesellschaftlicher Macht- und Ungleichheitsverhältnisse, die mit
Rasterungen, Aufteilungen und Prozessen des Othering einhergehen.
Die dritte Dimension ist eine dynamische: Prekarisierung als „biopolitische Gouvernementalität“, der es darum gehe, Absicherung soweit
wie möglich zu minimieren und Prekarität zu maximieren – „an der
Schwelle noch tolerierbarer sozialer Verletzbarkeit“ (ebd.: 88). Nach Michel Foucault definiert Lorey biopolitische Gouvernementalitat als „die
strukturelle Verstrickung zwischen der Regierung eines Staats und den
93
�Techniken der Selbstregulierung in modernen okzidentalen Gesellschaften“ (ebd.: 39). Diese Form des Regierens sei entstanden, „als das Leben
in die Politik eintrat” (Lorey, 2007), mit dem Beginn der Biopolitik des
späten 18. und 19. Jahrhunderts. Die biopolitische Gouvernementalität
normalisiert Prekarisierung und geht mit Neoliberalismus einher, während der liberale Sozialstaat darauf beruht hat, Prekarität zu bekämpfen
– auch durch den Ausschluss der als Gefahr stilisierten besonders prekären Anderen:
„Im Neoliberalismus befindet sich Prekarisierung nun in einem Normalisierungsprozess, in dem zwar liberale Ordnungsmuster der Prekarität modifiziert weiterbestehen, aber so, dass das existenzielle Prekärsein sich nicht mehr gänzlich durch die Konstruktion bedrohlicher
Anderer verschieben und als Prekarität abwehren lässt; es artikuliert
sich vielmehr in der individualisierten gouvernementalen Prekarisierung der neoliberal Normalisierten.“ (Lorey 2012, 28)
Neben der Aufmerksamkeit für Soziabilitäten und Versuche des Regierens erlaubt Loreys Theorie des Prekären zudem, gesellschaftliche Widersprüche und Antagonismen in die Analyse mit einzubeziehen. Sie
macht nachvollziehbar, wie Flexibilität sowohl Ausbeutungsmodus und
Widerstandsstrategie sein kann und weist darauf hin, das Arbeitskraft
durch unbezahlte care-Arbeit reproduziert wird, die kapitalistische
Wirtschaftsweisen stabilisiert, aber auch gleichzeitig Ausgangspunkt
für Praktiken des Entziehens und des Widerstands ist. Hier trifft sich
ihre Theorie des Prekären mit dem Konzept der imperceptible politics.
Auch Vassilis Tsianos warnt davor, Prekarität im Sinne Castels als soziologische Kategorie zu verwenden und verweist auf den Exzess, der
von jenem kategorialen soziologischen Zugriff eben nicht erfasst und
vereinheitlicht werden kann, sondern über ihn hinausgeht:
„In order to avoid just another apolitical sociological category, we need
to focus on the ruptures, blockades, and the lines of flight which are
immanent in the configuration of precarious labour. [...] Today’s emergent social subjectivities cannot be described as one unified social actor
with the same position in production and the same characteristics.“
(Tsianos, 2008: 198)
94
�Doch wie entsteht dieser Überschuss genau? Wie ist politische Praxis
möglich, die sich nicht im Sinne der representational politics als Subjekt
kategorisiert und Rechte fordert? Nach Isabel Lorey ist die
„Voraussetzung für die Entfaltung einer solchen konstituierenden
Macht [...] die gemeinsame Verweigerung und der gemeinsame Exodus, nicht um in der Negation oder der dekonstruktiven Infragestellung
zu verweilen, sondern um Neu-Zusammensetzungen erfinden zu können.“ (Lorey, 2012: 134)
Die Potenzialität, Prekarisierung als Regierungstechnologie zu unterwandern, entstehe durch „die permanenten singulären Verweigerungen, die kleinen Sabotagen und Widerständigkeiten des prekären
Alltags“ (ebd). Für Tsianos entsteht der Überschuss der imperceptible
politics of escape genau in den prekarisierten Situationen, in denen sich
die fordistischen Sicherungssysteme zurückgezogen haben und die Ausbeutungsverhältnisse so verschärft sind, dass weder Lohn noch soziale
Leistungen das Überleben, ein gutes Leben und/oder Soziabilität ermöglichen und die Menschen in diesem ‚gap‘ produktiv werden:
„[T]here is nothing mystical about this excess of sociability and subjectivity; it arises in specific conditions; i.e. when there is an unbreachable
gap between the conditions of work and its remuneration, a gap with
which people have to live. And by investing in this incommensurable
gap, people create an excess to the work they do. People mobilise social
and personal investments in order to produce (e.g. social relations, networks, ideas) – some of this is entailed in the ‚final product‘, but much
remains outside of it.“ (Tsianios, 2007: 190)
Mir geht es hier weder darum, Prekarisierung, Armut und die alltäglichen Praktiken und Kämpfe in solchen Verhältnissen zu glorifizieren,
noch möchte ich behaupten, dass extreme Verarmung notwendig ist,
um im Sinne der imperceptible politics politisch zu handeln, sondern ich
möchte die alltäglichen Praktiken des Sich-Entziehens, der Mobilität und
der gegenseitigen Unterstützung als politische Praktiken aufzeigen. Die
ethnografische Forschung der Sozialwissenschaftlerin Gabriella Alberti
(2014) zu migrantischen Arbeiter*innen im Londoner Hotelgewerbe ist
meiner Meinung nach ein Beispiel dafür, wie escape als politische Praxis
95
�wahrgenommen werden kann, ohne sie zu idealisieren. Sie zeigt, wie
sich migrantische Arbeiter*innen gegen schlechte Arbeitsbedingungen
wehren, indem sie Arbeitsplätze und lokale Arbeitsmärkte verlassen.
Ihre These ist, dass sich in der Exit-Strategie – der „transnational exit
power“ (ebd.: 1) – Arbeiter*innenmacht ausdrücke, welche die Annahme, dass migrantische Arbeiterinnen schlechte Arbeitsbedingungen akzeptieren müssen, zurückweise.
„[M]igrants in this study, drawing on their circuits of trans-local connections, appeared to find effective ways to overcome these constraints
and improve their harsh working lives through their occupational and
geographical mobility.“ (Alberti, 2014: 13)
Gleichzeitig würden Migrationskontrollen migrantische Arbeiter*innen
besonders anfällig für unsichere und kurzfristige Jobs machen. So macht
auch Alberti auf die Widersprüche und Spannungsverhältnisse aufmerksam, die in der Mobilität der Arbeit zum Ausdruck kommen: „migrants’ mobility and temporariness appear to constitute a double terrain
of control and resistance against the precarious conditions of life and
work“ (Alberti, 2014: 14, Hervorhebung im Original). Der Widerstand
käme auch darin zum Ausdruck, dass die Arbeiter*innen sich nicht nur
an ökonomischen Rationalitäten ausrichteten, sondern ihre Praktiken
an sozialen Bindungen oder Sympathien für bestimmte Orte orientierten und so unberechenbar blieben.
Was hat dies nun mit dem Arbeitskampf und den sozialen Verhältnissen der Klägerinnen zu tun? Loreys Theorie des Prekären erlaubt erstens, ihre Arbeits- und Lebensverhältnisse in der aktuellen historischen
Konjunktur zu kontextualisieren und die unsicheren und von Mangel
geprägten Lebensverhältnisse der EU-migrantischen Arbeiter*innen
nicht als Ausnahme, sondern als Norm in der heutigen Gesellschaft zu
begreifen. Außerdem schärft die konzeptuelle Unterscheidung zwischen
Prekär-Sein, Prekarität und Prekarisierung den Blick auf Versuche des
Regierens und ihre Effekte. So ist die Verunsicherung der Arbeitsverhältnisse der vier Frauen durch die Deregulierung des Arbeitsmarktes und
den Ausbau des Niedriglohnsektors in den Kontext der Prekarisierung
zu setzen. Gerade im Bau- und Reinigungsgewerbe wurde Lohnarbeit
durch die Förderung von Selbstständigkeit und Leiharbeit in den letzten
Jahren durch Gesetzesänderungen aktiv verunsichert. Diese sind von
96
�Techniken der Selbstregulierung, etwa der Anrufung des „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling, 2013), durchkreuzt, aber nicht auf diese zu
begrenzen. Die Frage, welche Rolle die gouvernementale Prekarisierung
in den Regimen der Arbeit und Migration in München spielen, wird
später in dieser Arbeit noch vertieft Thema sein. So werde ich in den Kapiteln 5 bis 7 thematisieren, wie die Gestaltung des Zugangs zu sozialen
Leistungen für Unionsbürger*innen von der Prämisse geprägt ist, soziale Leistungen nicht mehr als Grundrecht, sondern als Aktivierungswerkzeug für erwerbsfähige Individuen zu betrachten. Drittens erlaubt
dieser Analyserahmen, nach widerständigen Praktiken zu fragen, ohne
sie auf Politiken des Sichtbarwerdens zu reduzieren und gleichzeitig für
die Ambivalenzen der Politiken der Konstituierung und des Entgehens
zwischen Exzess und kapitalistischer Aneignung aufmerksam zu sein.
Vor diesem Hintergrund möchte ich die Arbeitskämpfe der vier Frauen
und ihrer Freundinnen im Kontext ihres transnationalen Migrationsprojekts verorten.
Transnationale Migrationsprojekte
Die Schwestern Nadja Bozhkova und Bozhurka Chavdarova, zwei der
Klägerinnen, und ihre Freundinnen führen seit über zwanzig Jahren
ein transnationales Leben zwischen Pazarjik und München, wobei die
kurzen Aufenthalte in Bulgarien meist zur Erholung dienen - denn ihr
Leben in München ist, wenn sie gerade keine Arbeit und keinen Wohnraum haben, oft noch entbehrungsreicher als in Pazarjik. Sie sind heute
beide um die 50 Jahre alt. Anfang der 1990er Jahre war Nadja Bozhkovas
Schwester Nonka Angelova als erste aufgebrochen. Nonka Angelova
kam als Touristin nach München und suchte sich eine undokumentierte Arbeit in einer Gärtnerei. Zuvor hatten sie über Jahre hinweg Autoteile und Gemüsekonserven produziert, aber nachdem die Fabriken
mit dem Ende der realsozialistischen bulgarischen Volksrepublik dicht
machten, gab es für sie in Pazarjik keine Arbeit mehr. Dazu kam, dass
sie aufgrund ihrer Diskriminierung als Angehörige der türkischen Minderheit in Bulgarien ihre Jobs als erste verloren hätten, so erzählte mir
Nadja Bozhkova in einem Interview. Staatliche Unterstützung habe es
so gut wie keine gegeben, dafür aber ein Darlehen bei der Bank, dessen Rückzahlung sie zusätzlich belastete. Ihre Freundin Zümbül Eseva
97
�folgte Nonka schnell und kam ebenfalls nach München. Nadja Bozhkova
blieb erst zurück, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie lebte in einem Haushalt mit ihrer Freundin Penka, während der Vater der Kinder
meist abwesend war, viel trank und „nicht einmal ein paar Socken“ zum
Lebensunterhalt beisteuerte. Als Penka Radkova als Letzte der Freundinnen die Arbeit in der Fabrik verlor, übernahm sie die Erziehungsarbeit von Nadja Bozhkovas Kindern und diese folgte ihren Freundinnen
und ihrer Schwester nach München. Sie erinnert sich gern an ihre erste
24-stündige Busfahrt von München nach Pazarjik zurück, da sie diese als
ein großes Abenteuer wahrgenommen hatte. Bozhurka Chavdarova und
ihre Tochter Danka kamen später nach.
Dies alles geschah nicht in einem luftleeren Raum, sondern in den geopolitischen Verschiebungen der postsozialistischen Transformationen
bzw. kapitalistischen Restrukturierungen in Bulgarien und des umkämpften Projekts EU. Bis 1991 war Bulgarien eine realsozialistische
Volksrepublik, in der (offiziell) Vollbeschäftigung herrschte. Mit deren
Ende näherte Bulgarien sich schnell der EU an. Innerhalb von zehn Jahren öffnete Bulgarien seine Märkte für die EU und passte seine Gesetze an die Vorgaben der EU an. Dies beinhaltete die Rationalisierung
und Privatisierung der zuvor zentral gesteuerten Staatsbetriebe und die
Restrukturierung der Sozialsysteme nach dem marktwirtschaftlichen
Vorbild des Westens. Diese neoliberale Umstrukturierung führte zum
Wegfall vieler Arbeitsplätze.
„In most eastern European countries, privatization accompanied by
redundancies and the introduction of hard budget constraints has resulted in large-scale job losses.“ (Van der Hoeven & Sziraczki, 1997: 10,)
so stellt eine von der International Labour Organization (ILO) publizierte Studie fest, die die Konsequenzen von Privatisierungspolitiken auf
die Arbeitsmärkte in „developing countries and transition economies“
(ebd.), u.a. in Bulgarien, untersucht hat.
Die Klägerinnen und ihre Freundinnen gehören zu den über 50.000 Personen, die in den ersten postsozialistischen Jahren ihre Arbeit in der
Lebensmittelproduktion verloren haben (vgl. ebd.).45 Gleichzeitig stie45
Die Statistik der ILO gibt an, dass von 107.300 Arbeitsplätzen vor dem
Ende des Realsozialismus in der Lebensmittelproduktion (food manufacturing)
1996 nur noch 55.600 übrig waren (vgl. International Labour Organisation 2001).
98
�gen die Lebenshaltungskosten dramatisch an. Nadja Bozhkova erzählte, dass Grundnahrungsmittel inzwischen etwa für den gleichen Preis
zu kaufen wären wie in Deutschland, während die Löhne immer noch
viel niedriger seien. Viele Menschen konnten in den 2000er Jahren ihre
Stromrechnungen, die im Zuge der Privatisierung der Energieversorgung enorm gestiegen waren, nicht mehr zahlen. Die Sozialwissenschaftlerin Mariya Ivancheva spricht von einer
„permanente[n] Krise [...], die die neoliberale Austeritätspolitik der
aufeinanderfolgenden Regierungen in Bulgarien bereits einige Zeit
vor der Weltwirtschaftskrise von 2008ff. eingeführt hatte.“ (Ivancheva,
2014: 72)
Zwei Millionen Bulgar*innen, die ihren Lebensunterhalt in Bulgarien
nur mehr schwer bestreiten konnten, nutzten die Escape-Option (vgl.
ebd). Sie machten sich auf und suchten Arbeit und ein besseres Leben
in wirtschaftlich besser gestellten geopolitischen Regionen, meist in den
wohlhabenderen älteren EU-Mitgliedsstaaten oder auch in die sich im
Aufschwung befindenden südlichen EU-Länder, wo insbesondere im
Bau und in der Landwirtschaft Arbeit zu finden war. Der Anthropologe
Noel David Nicolaus bezeichnet die „Zunahme und Neuausrichtung innereuropäischer Migrationsbewegungen im Rahmen der Krise“ auch als
„basisdemokratische Einforderung jenes Freizügigkeitsrechts […], das
nach wie vor eines der Kernelemente der Unionsbürgerschaft bildet“
(Nicolaus, 2014: 116). Gleichzeitig wurde durch diesen Exit der Massen
die aufgrund der Krise angespannte soziale Lage sicherlich entspannt.
In Bulgarien haben sich die sozialen Konflikte dann aber trotzdem in
einer Protestwelle ausgedrückt (vgl. Ivancheva 2014), die an dem Zorn
über erhöhte Energiekosten im Winter 2012/2013 entflammten.
Auch Nadja Bozhkova und ihre Freund*innen machten sich auf den
Weg in ein neues, transnationales Leben. Von den Transformationen der
deutschen, bulgarischen und EU-europäischen Versuche, Migration zu
regieren, ließen sie sich dabei nicht beirren. Den rechtlich-politischen
Entwicklungen des Migrationsregimes zwischen Deutschland, der EU/
EG und Bulgarien - vom Eisernen Vorhang zum Visa-Regime (1993)
über die eingeschränkten Einführung der Freizügigkeit im Zuge des
EU-Beitritts (2007) bis zur Aufgabe dieser Einschränkungen (2014) - begegneten sie mit Anpassungen ihrer Migrationsstrategien. Ihre sozialen
99
�und politischen Rechte waren im Vergleich zu deutschen Bürger*innen
immer eingeschränkt, wenn auch in unterschiedlichen Ausformungen
und Graden der Entrechtung. Im Laufe der Jahre passte Nonka Angelova, die schon seit den frühen 1990er Jahren und als erste der Freundinnen in München lebte, in die verschiedensten aufenthaltsrechtlichen
Kategorien: Asylbewerberin, Touristin mit Dreimonatsvisum, ‚Illegale‘
und (zunächst eingeschränkt) freizügige Unionsbürgerin erst ohne und
dann mit Daueraufenthaltsrecht.46 Anfang der 90er hatte sie Asyl beantragt. Der Status als Asylbewerberin verpflichtete sie, in einem Lager zu wohnen und die Residenzpflicht einzuhalten; zudem erhielt sie
grundsichernde Leistungen. Später konnte sie kein Asyl mehr beantragen, bekam aber relativ leicht ein Tourismus-Visum für jeweils drei Monate. Sie durfte in dieser Zeit wohnen, wo sie wollte, hatte aber keinen
Anspruch auf Wohnraum oder andere staatliche Leistungen. Wenn das
Tourismus-Visum nicht verlängert wurde, ging sie manchmal über die
grüne Grenze. Als aufenthaltsrechtlich illegalisierte Migrantin musste
sie vor Polizeikontrollen auf der Hut sein und hatte auch keinen Anspruch auf soziale Leistungen. In allen drei Kategorien durfte sie offiziell
nicht arbeiten - trotzdem arbeitete sie. In der Sylvesternacht 2006/2007
wurde sie im Zuge des EU-Beitritts Bulgariens dann schließlich Unionsbürgerin.
Die Einführung der Freizügigkeit gilt heute als eine der größten Legalisierungsaktionen der letzten Jahre, da viele Migrant*innen, die sich
bisher mit Touristenvisa oder ohne Aufenthaltserlaubnis im EU-Territorium aufhielten und oft lohnarbeiteten, nun keine Aufenthaltserlaubnis
mehr benötigten. Sie erhielten zudem das kommunale Wahlrecht (bei
Anmeldung des Wohnsitzes). Auf das transnationale Leben von Nonka Angelova und ihren Freundinnen hatte dies aber keine große Auswirkung - sie hatten ihre Bewegungsfreiheit ja zuvor schon ausgeübt.47
Ihre neuen sozialen Rechte, zum Beispiel als Arbeitnehmerinnen aufstockend Hartz IV zu beantragen, nahmen sie, soweit ich weiß, nicht wahr.
46
Das Daueraufenthaltsrecht erwarb sie, weil sie schon mehr als fünf
Jahre ihren rechtmäßigen Aufenthalt in München hatte und diesen nachweisen
konnte.
47
Wie ich schon mehrfach herausgearbeitet habe, stellen die rechtlichen
Regelungen eben nur eine Komponente der lebensweltlichen Aushandlungsprozesse dar. Trotzdem haben neue Gesetze Effekte, die auch in der Lebensund Arbeitsverhältnissen der Migrant*innen zu spüren sind.
100
�Entfliehen und Fordern
Das transnationale Migrationsprojekt von Nadja Bozhkova und ihren
Freund*innen im Kontext der kapitalistischen Strukturanpassung im
postsozialistischen Bulgarien stellt gleichzeitig einen Teil ihres Kampfes
für ein besseres Leben und eine Grundlage der Ausbeutung ihrer Arbeitskraft dar. Ihre Flexibilität und Hartnäckigkeit kann gleichzeitig als
Anpassungsfähigkeit, als Widerstand und als Praxis des Escape aufgefasst werden, die sich nicht nur gegen die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse wehrt, sondern gleichzeitig zu ihr beiträgt. Aus dem einzelnen Arbeitskampf mit Dr. Goffmann wurde ein Glied in einer Kette
an Arbeitskämpfen, aus der Ausnahme ein kontinuierlicher Kampf um
bessere Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Sie nutzten dabei sowohl die
Strukturen des Klassenkompromisses im national-sozialen Staat, indem
sie vor dem Arbeitsgericht im Namen ihrer Arbeitsrechte Klage erhoben,
und gingen darüber hinaus. Die unwahrnehmbaren Politiken schließen
Strategien des Sichtbar-Werdens und Forderungen-Stellens nicht aus,
wie ihre Klage gegen Dr. Goffmann zeigt. Die Klage war auch nicht der
einzige Moment, in dem sie sich an den Staat wandten. So habe ich Nadja Bozhkova und Penka Radkova kennengelernt, als sie an der gewerkschaftlichen Demonstration zum 1. Mai 2010 teilnahmen. Beide haben
sich im Anschluss an einem Fotoprojekt beteiligt, das in der Ausstellung
münchen PREKÄR mündete (vgl. Riedner, 2011). Nadja Bozhkova ließ
sich in diesem Kontext mit einem Schild in der Hand fotografieren, auf
dem „Ich bin gekommen, um selbstständig zu sein“ stand.
Während die Arbeiter*innen Forderungen nach einem selbstständigen und abgesicherten Leben und nach sozialen Rechten an die Stadt,
Deutschland und die EU richteten, ließen sie sich gleichzeitig in ihren
unwahrnehmbaren alltäglichen Kämpfen nicht aufhalten. Durch ihre
gegenseitige, reproduktive Unterstützung im Alltag, ihre Flexibilität bei
der Arbeitssuche und ihre territoriale Mobilität erfüllten sie zum einem
die unternehmerische Nachfrage nach billiger, flexibel verfügbarer Arbeitskraft, ließen sich aber nicht auf diese reduzieren. Genauso wenig
erfüllten sie das Wunschbild der EU-europäischen Mobilitätsregimes,
in dem mobile Unionsbürger*innen gut ausgebildet sind und arbeiten,
während Personen ohne formelle Ausbildung und Arbeitsplatz in den
von Austerität und Krise gebeutelten ‚Herkunftsländern‘ bleiben.
101
�In diesem Kapitel habe ich die in der Einleitung geforderte Analyseperspektive verfeinert, die die Frage nach den kapitalistischen Verhältnissen
mit einbezieht, dabei aber deterministische und ökonomistische Ansätze überwinden möchte und sich mit den Kämpfen positioniert. Ausgehend von einem Arbeitskampf und dem Migrationsprojekt von Nadja
Bozhkova und ihren Freundinnen habe ich den Antagonismus zwischen
den unwahrnehmbaren und sichtbarwerdenden politischen Praktiken
der EU-Migrant*innen und den Technologien der Prekarisierung und
(Über-)Ausbeutung im Reinigungsgewerbe, den sich transformierenden
Migrationspolitiken und der neoliberalen Restrukturierung Bulgariens
in den Blick genommen. Zumindest ansatzweise ist deutlich geworden,
wie es zu den extrem prekären und (über-)ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen kommt.
Im folgenden Kapitel geht es wieder zurück zum ‚Tagelöhnermarkt‘,
diesmal aber nicht, wie in der Einleitung, um relativ abstrakt über verschiedene Analyseperspektiven zu diskutieren, sondern ich begebe
mich tief in das diskursive Dickicht der Kämpfe um die Deutung des
‚Tagelöhnermarktes‘, um erstens nach den Akteuren, Konflikten und
Transformationen des Diskurses zu fragen und zweitens zu analysieren,
in welcher spezifischen Assemblage sich hier Rassismen artikulieren.
In den Kapiteln 4 bis 7 werde ich dann auf Grundlage der bereits entwickelten Perspektive der Kämpfe auf die gesellschaftlichen Antagonismen der Prekarisierung und der Migration und der nun folgenden
Rassismusanalyse, Schlaglichter auf spezifische, umkämpfte Regierensweisen werfen, in denen sich Rassismen, Versuche des Regierens (des
Sozialen, der Migration und der Bürgerschaft) sowie Ausbeutungsverhältnisse verschränken.
102
�Kampf um Deutung – Der ‚Tagelöhnermarkt‘
zwischen Ärger, Endstation und Sprungbrett
„Was, in München?!“
Vor 2010 hat der „Tagelöhnermarkt“ nicht existiert. Zwar kamen
schon länger vor allem türkischsprachige Arbeitssuchende in das
Südliche Bahnhofsviertel, um in den lokalen Geschäften und Unternehmen einen Job zu finden, wie ein türkischer ehemaliger Werkvertragsarbeiter berichtete. Und auch Arbeitssuchende aus Pazarjik
trafen sich hier schon seit Jahren, um auf dem Gehsteig, in Cafés und
an anderen (halb-)öffentlichen Orten auf Arbeitgeber*innen zu warten, Kontakte zu knüpfen, Neuigkeiten auszutauschen und Zeit zu
verbringen.48 Sie wurden jedoch im öffentlichen Diskurs nicht wahrgenommen und die Figur des ‚Tagelöhnermarktes‘ und die Figur der
‚Tagelöhner‘ waren als Bezeichnung für die Personen, die mit dem
Zweck der Arbeitssuche auf dem Gehsteig stehen und den Ort, an
dem sie dies regelmäßig in Gruppen tun, noch nicht erfunden. So
schreibt der Spiegel im Jahr 2006 in dem Artikel Wie ein Stück Fleisch
zwar, dass es „Tagelöhner“ auch in München gebe, nennt aber als
einzigen Treffpunkt die offizielle Vermittlungsstelle der Arbeitsagentur für Tagesjobs bei der Münchner Großmarkthalle (vgl. Deggerich,
2006). Anfang 2010 meldeten sich einige EU-Migrant*innen, die sich
regelmäßig im Bahnhofsviertel aufhielten, dann aber öffentlich zu
Wort und die Medien - und mit ihnen die Öffentlichkeit und auch
die Kommunalpolitik - entdeckten den ‚Tagelöhnermarkt‘. „Was, in
München?!“ - so reagierten viele Personen, denen ich von dem selbstorganisierten Arbeitsmarkt berichtete, ungläubig und die Nachricht hatte im öffentlichen Diskurs der wohlhabenden bayerischen
Landeshauptstadt durchaus Nachrichtenwert. So liegen mir für die
Zeit zwischen Juni 2010 und September 2013 19 Medienberichte vor,
in denen vom „Tagelöhnermarkt“ bzw. vom „Arbeiterstrich“ im Südlichen Bahnhofsviertel die Rede ist.
48
In Anlehnung an das letzte Kapitel ließe sich fragen, ob ihre Praktiken
als imperceptible politics gedeutet werden können.
103
�In diesem Kapitel möchte ich anhand der Medienartikel und den mit
ihnen verknüpften Diskursereignissen zeigen, wie die Figur „Tagelöhnermarkt“ entdeckt, umkämpft und kategorisiert wurde. Die Analyse
teilt sich in zwei Schritte: Zuerst zeichne ich die zeitlichen Entwicklungen des Mediendiskurses als Kampf um Hegemonie49 vertikal nach,
indem ich die Medienberichte mit Akteuren, Ereignissen und Konflikten
rund um den selbstorganisierten Arbeitsmarkt kontextualisiere. Welche
Diskursereignisse waren prägend? Wessen Stimme und Perspektive hat
sich wann und wie öffentlich Gehör verschafft? Ich gehe also auch hier
wieder von den Kämpfen aus. Die Medien begreife ich dabei als relativ
autonome Akteure, ihre Berichte aber auch als Artikulation der aktuellen Konjunkturen des Rassismus. Es wird sich nämlich zeigen, dass es
in den Hegemoniekämpfen um den ‚Tagelöhnermarkt‘ auf vielfältigste Weisen um die Repräsentation von Differenz geht. Die sich immer
wieder verschiebende Linie zwischen ‚Uns‘ und den ‚Anderen‘ – zwischen denen, die sich legitim im Münchner Bahnhofsviertel aufhalten,
und jenen, die ‚hier nicht hingehören‘ – ist Produkt dieser Aushandlungsprozesse. Deswegen analysiere ich in einem zweiten, horizontalen
Analyseschritt den Gesamtkorpus der Zeitungsartikel als Repräsentationsregime in Anlehnung an Stuart Hall (2004) auf verschiedene Formen
der rassistischen Stereotypisierung. Es ist ein zentrales Anliegen dieses
Buches, ein Beispiel dafür zu geben, wie Rassismus als soziales Verhältnis die Gesellschaft, in der wir leben, ganz grundlegend mitprägt. Rassismus bleibt nicht auf der sprachlichen Ebene, sondern greift tief in Gesellschaftsverhältnisse und ihre Aushandlungen ein. In diesem Kapitel
49
Mit dem Begriff der Hegemonie beziehe ich mich auf den marxistischen Denker Antonio Gramsci, der mit diesem Konzept zu verstehen suchte,
wieso die Beherrschten sich beherrschen lassen und oft sogar freiwillig in ihre
Beherrschung einwilligen. Dies sei nicht alleine auf physischen Zwang, sondern auch auf den „aktiven Konsens der Regierten“ (Gramsci, 1991) zurückzuführen. Dazu gehören ganz grundlegende Weltanschauungen, Wahrheiten,
Subjektivierungen und Deutungen sozialer Verhältnisse. Hegemonie muss
ständig hergestellt werden und ist umkämpft. Eine große Rolle bei der Aushandlung von Hegemonie gibt Gramsci dabei den Intellektuellen, zu denen er
auch die Bürokrat*innen, Journalist*innen, Anwält*innen etc. zählt (vgl. Buckel,
2013: 18). Das Konzept der Hegemonie lässt sich gut mit der foucauldianischen
Machtanalyse verbinden und erscheint mir für die Analyse der Aushandlungen der Deutung des ‚Tagelöhnermarktes‘ geeignet, da die Verschiebungen und
Vermachtungen im Diskurs mit seiner Hilfe gut erfasst werden können.
104
�interessiere ich mich aber explizit für die Ebene der Repräsentation und
beschränke mich auf die Teilfragen, wie die konkreten Aushandlungen
sich auf den Mediendiskurs auswirken und wie sich Rassismus in diesem artikuliert.
Endstation, Sprungbrett oder Ärger? Der Kampf
um die Deutung der Figur ‚Tagelöhnermarkt‘
Für den Zeitraum zwischen Juni 2010 und September 2013 habe ich 19
Medienberichte in Tageszeitungen, Magazinen und Fernsehformaten
gefunden, die ‚Tagelöhner‘, den ‚Tagelöhnermarkt‘ oder den ‚Arbeiterstrich‘ im Münchner Bahnhofsviertel erwähnen. Diese bilden den Korpus für die folgenden Analysen. Auch wenn sich der Diskurs zu den
‚Tagelöhnern im Bahnhofsviertel‘ nur künstlich von anderen Diskursbereichen – wie z.B. den zu ‚Betteln im Bahnhofsviertel‘, ‚Armutszuwanderung‘ oder ‚Ausbeutung von Wanderarbeitern‘ – abtrennen lässt,
fokussiere ich aber trotzdem auf Presseberichte zum ‚Tagelöhnermarkt‘,
weil sie die komplexe Entwicklung in einem überblickbaren Rahmen
aufzeigen und weil ich die Erfindung und die Kämpfe um die hegemoniale Deutung der Figur ‚Tagelöhner im Bahnhofsviertel‘ besonders gut
nachverfolgen kann, da ich in diesem Zeitraum an den Aushandlungen
teilgenommen habe. Außerdem spielt die Berichterstattung zum ‚Tagelöhnermarkt‘ in den lokalen Regimen durchaus eine wichtige Rolle, wie
sich unter anderem daran gezeigt hat, dass Lokalpolitiker*innen immer
wieder auf Medienberichte reagiert haben und auch in Interviews oder
bei Treffen oft auf diese Bezug genommen haben. Um die Hegemoniekämpfe zum Thema ‚Tagelöhner im Bahnhofsviertel‘ nachvollziehen zu
können, geht es im Folgenden also um die Fragen: Wie und aufgrund
welcher Ereignisse hat sich die Berichterstattung im Laufe der Jahre
2010 bis 2013 verändert? Über was wurde berichtet, was wurde problematisiert? Welche konkurrierenden Erzählungen gab es bzw. wie und
von wem wurden Probleme und Lösungsmöglichkeiten unterschiedlich
definiert? Wer kam zu Wort, wann und wie? Welche Stimmen wurden
ausgeschlossen?
Ich mache sechs verschiedene Phasen aus, die jeweils von spezifischen Diskursereignissen eingeleitet und geprägt wurden. Zum ersten
Mal wurden die Arbeitssuchenden und ihr Treffpunkt in dem Artikel
105
�Probebohrungen im Biotop der Süddeutschen Zeitung vom 4. Juni 2010
(Rühle, 2010) erwähnt. Anlass der Entdeckung des ‚Arbeiterstrichs‘ war,
dass sich das Theater Münchner Kammerspiele das Bahnhofsviertel für
ihr alljährliches Stadtteilprojekt ausgesucht hatte, wohl aufgrund der
auch im Artikel hervorgehobenen Besonderheiten dieses ‚Biotops‘:
Multikulturalität, türkische Gemüsehändler, Prostitution und der ‚Arbeiterstrich‘. Auf diesen wurden die Journalist*innen deshalb aufmerksam, weil in den Räumen des Theaterprojekts das Workers’ Center der
Initiative Zivilcourage Raum gefunden hatte. Kaum hatte das Projekt
gestartet, „da setzte sich die bulgarische community hier fest“50, so die
Darstellung des Artikels, der auch die Bezeichnung des „Arbeiterstrichs“
in den lokalen öffentlichen Diskurs einführte:
„An der Ecke Goethe-Landwehrstraße gibt es einen Arbeiterstrich, jeden Morgen um halb sechs stehen dort an die 150 Bulgaren und hoffen,
dass irgendein Bauunternehmer kommt und einige von ihnen brauchen kann. Diese Bulgaren sind die modernen Arbeitsnomaden, keiner von ihnen wurde mit Apfel, Banane und Birne am Hauptbahnhof
empfangen [wie die im Artikel zuvor erwähnten Gastarbeiter*innen in
den 1960er Jahren, Anmerkung der Autorin], keiner hat auf sie gewartet, sie ergattern, wenn sie Glück haben, einen bis drei Jobs im Monat,
das meiste auf Ausbeutungsbasis, schwarz. Alexander hat im Februar seinen rechten Zeigefinger verloren [...].“ (Rühle, 2010, Anmerkung
durch die Autorin)
Das Narrativ vom ‚Arbeiterstrich‘ wird dann aber nicht weiter vertieft,
sondern dient vielmehr dazu, die Charakterisierung des Hauptbahnhofviertels zu unterstreichen: Das „eigentliche Zentrum Münchens“
sei „provisorisch“, „[d]er reinste urbane Wildwuchs“, die „schillerndste, großstädtischste Ecke Münchens“ und das „Areal, durch das schon
immer das Fremde in die Stadt kam“ (ebd.). Diese fulminante Charakterisierung des Viertels artikuliert in ihrem exotisierend-rassistischen
Zungenschlag nicht nur die postkolonialen, orientalistischen Bilder von
Little Istanbul, wie das Viertel umgangssprachlich auch genannt wurde,
sondern sie gibt auch einen ersten Eindruck vom Kampf um die Hoheit
50
Die ‚bulgarische community‘ wird hier metaphorisch mit hartnäckigem Schmutz gleichgesetzt und abgewertet. Mehr zum Hygienediskurs folgt im
zweiten Teil des Kapitels.
106
�auf der Straße. Von Sauberkeit phantasierende Aufwertungsprojekte
stehen der eigensinnigen Präsenz der subalternen Arbeitssuchenden
entgegen, die sich trotz allen Gegenwindes weiter hier treffen und aufhalten. (Sub-)kulturelle Projekte wie das Stadtteilprojekt der Kammerspiele wie auch die mediale Betonung der Urbanität des Viertels können
dabei als die typischen Vorboten der Gentrifizierung verstanden werden.
Ein wichtiger Akteur, dessen Ziel es war, die öffentliche Aufmerksamkeit auf die urbanen Qualitäten des Bahnhofsviertels zu lenken und
die Gegend somit aufzuwerten, war der Verein Südliches Bahnhofsviertel. Lokale Gewerbetreibende hatten ihn im Jahr 2010 gegründet. Der
Stadtteil sollte „durch ein innovatives und aktivierendes Management
in verschiedener Hinsicht gefördert werden“ (Südliches Bahnhofsviertel
e.V., 2016a).51 Die Citymanager dachten sich einen Slogan aus, um den
„angeschlagenen Ruf“ des Viertels zu verbessern: „Das Südliche Bahnhofsviertel: Münchens Puls in die Welt“ (Südliches Bahnhofsviertel e.V.,
2016b). Auf seiner Webseite erklärt der Verein die Marketingstrategie
folgendermaßen:
„Das Bahnhofsviertel ist geprägt durch ein dichtes Nebeneinander verschiedener Nutzungen, Branchen und Bevölkerungsgruppen – hier ist
Raum für Großstadtflair und Multikultur genauso wie für innovative
Start-Up-Unternehmen und exklusive Hotels. Die spezifischen Qualitäten und Potenziale des Viertels überlagern sich mit der Dominanz
der Sexshops und Spielhallen. [...] Ziel des Projektes ‚Südliches Bahnhofsviertel‘ ist es, im Vorgriff auf die anstehenden Veränderungen die
vorhandenen spezifischen Qualitäten des Viertels zu stärken und das
Viertel für die Zukunft ‚fit‘ zu machen. [...] Ziel ist es, den authentischen Charakter, die Viertelidentität herauszuarbeiten und durch die
Entwicklung einer Marke kommunizierbar zu machen.“ (ebd.)
Insgesamt spielte das städtische Aufwertungsprojekt, das in den Tätigkeiten des Vereins seinen deutlichsten Ausdruck fand, auch eine nicht
51
Sie knüpften dabei an den Image-Feldzug des städtischen Pilotprojekts
Südliches Bahnhofsviertel an, das für seinen innovativen Ansatz 2007 mit dem
Bayerischen City- und Stadtmarketingpreis geehrt wurde, indem sie die Strategien des ‚Citymarketings‘ und ‚Quartiersmanagements‘ weiterführten.
107
�zu vernachlässigende Rolle in den Aushandlungen um die Präsenz der
Arbeitssuchenden im Viertel.52
Die erste Erwähnung des ‚Arbeiterstrichs‘ in dem SZ-Artikel zum
Kammerspieleprojekt wurde medial aber erst einmal nicht wieder
aufgegriffen. Aber schon acht Monate nach den Probebohrungen
im Biotop kam es zur zweiten und eigentlichen Entdeckung des
‚Tagelöhnermarktes‘, die die zweite Diskursphase einläutete. Die
Beratungsstelle für Sans-Papiers der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und gewerkschaftlich organisierte bulgarische
Arbeiter*innen53 luden Anfang August 2010 zu einer Pressekonferenz ein, die die Aufmerksamkeit der Medien auf die Probleme der
Tagelöhner lenken sollte. Sie stellten eine Resolution vor, die auf
dem von Arbeiter*innen mit der Initiative Zivilcourage gemeinsam
verfassten Flugblatt für die Demonstration am 1. Mai 2010 beruhte (vgl. Initiative Zivilcourage, 2010). Die Teilnahme an dieser Demonstration und das begleitende Flugblatt waren der erste Versuch
von EU-migrantischen Arbeiter*innen in Zusammenarbeit mit der
Initiative Zivilcourage, in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden.
Das Narrativ, das wir für das Flugblatt erarbeitet hatten, sollte für
die folgende Entwicklung des Mediendiskurses erst einmal prägend
sein. Im direkten Anschluss an die Pressekonferenz zitierte der einseitige SZ-Artikel Eingewandert, ausgegrenzt vom 8. August 2010
aus der Resolution:
52
Die Imagekampagne führte auch zu mehreren Presseartikeln – z.B.
Reizende Gegend aus der SZ vom 02.12.2012 (Handel, 2012) und Bahnhofsviertel:
14 Geschichten aus dem Schmelztiegel aus der tageszeitung (tz) vom 14.03.2015
(Huber & Gebharst, 2015). Da in ihnen der ‚Tagelöhnermarkt‘ jedoch nicht direkt genannt wird und sie auch außerhalb des Analysezeitraums liegen, wurden sie nicht in den Analysekorpus aufgenommen.
53
Zwischen 2010 und 2011 waren fast 400 bulgarische Arbeiter*innen
der Gewerkschaft ver.di beigetreten. Hintergrund war die Zusammenarbeit
der Initiative Zivilcourage mit der Sans-Papiers-Beratungsstelle des Fachbereichs 13 Besondere Dienstleistungen. Bis Ende 2012 war der Mehrzahl dieser
Arbeiter*innen die Mitgliedschaft von Seiten der ver.di jedoch wieder gekündigt worden. Als Grund wurde angegeben, dass Mitgliedsbeiträge ausgeblieben
seien. Ich habe mich dagegen entschieden, näher auf die Zusammenarbeit mit
der ver.di einzugehen, da dies den Rahmen des Buches gesprengt hätte.
108
�„Wir leben hier teilweise unter entsetzlichen Bedingungen. Oft ohne
Wohnung, Essen, Wasser und medizinische Versorgung. [...] Um zu
überleben und unsere Familien zu ernähren, sind wir gezwungen alle
möglichen schlecht bezahlten und unsicheren Jobs anzunehmen.“ (Tibudd, 2010)
Mit Ahmed Maksud stellte der Artikel einen „Vertreter eines neuen Typs
Einwanderer“ (ebd.) vor, „der legal nach Deutschland kommt, dem die
Umstände das Leben schwer machen – und für [den] sich keine Behörde
zuständig fühlt“ (ebd.). Hauptprotagonistin des Artikels stellte jedoch
die Leiterin des Fachbereichs 12 der Dienstleistungsgewerkschaft dar,
die auf die prekäre Situation und die Ausgrenzung, denen die Arbeiter
von verschiedenen Seiten begegneten, aufmerksam machte.
Gute zwei Wochen später veröffentlichte die SZ die erste Reportage
vom ‚Tagelöhnermarkt‘ mit dem Titel Lohn und Leid (24.8.2010). Eine
eindrückliche Fotografie, die eine sich in Schaufenstern spiegelnde, auf
der Straße stehenden Gruppe von Menschen zeigt54, sollte den ‚Tagelöhnermarkt‘ repräsentieren (vgl. Bacher, 2010). Anhand von Schicksalen und Originalzitaten von Arbeitssuchenden – die somit zum ersten
Mal in München öffentlich zu Wort kamen – porträtierte der Artikel die
„Hoffnungen“ (ebd.) der neuen Einwanderer. Er zeigte die „Suche nach
dem Glück“ (ebd.) aus der (imaginierten) Perspektive der ‚Tagelöhner‘.
Auch wenn die „Forderung, die Einschränkung der Freizügigkeit aufzuheben“ (Tibudd, 2010), sowie die „Verpflichtung öffentlicher Stellen,
[…] sich um die Angelegenheit zu kümmern“ (ebd.) aus der Resolution
wiedergegeben wurden, fällt in diesen ersten Artikeln auf, dass die Klagen von EU-Migrant*innen deutlich mehr Raum bekamen als ihre Forderungen. In Lohn und Leid z.B. wurden die Arbeitssuchenden folgendermaßen zitiert: „Wir stehen hier wie Tiere“ (Bacher, 2010) und: „Wenn
wir keine EU-Bürger wären, dann könnten wir wenigstens Asyl beantragen“ (ebd.), während ihre Forderungen gänzlich unerwähnt blieben.
Beide Artikel skandalisieren den Alltag des ‚Tagelöhnermarktes‘ und die
ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, beschreiben die rechtliche Situation (allerdings fehlerhaft) und erwähnen auch die Diskriminierung der
Arbeitssuchenden als Angehörige der türkischen Minderheit in Bulga54
Diese Fotografie und weitere aus derselben Reihe werden sich in diversen SZ-Artikeln wiederfinden und im Analyseteil noch näher betrachtet
werden.
109
�rien. Das Problem stelle – so die Analyse der Journalist*innen – das
fehlende Eingreifen des Staates dar, bzw. „dass sich niemand zuständig
fühlt“ (Tibudd, 2010), sowie die ausbeuterische Praxis von kriminellen
Arbeitgeber*innen.
Nach diesen ersten Artikeln, die das Phänomen entdeckt, definiert und
gedeutet hatten, entflammte das Interesse am ‚Tagelöhnermarkt‘, der
als Skandal im wohlhabenden München wahrgenommen wurde. Bei
der Initiative Zivilcourage häuften sich Anfragen von Journalist*innen,
da wir als Expert*innen und Mittelspersonen zu den Arbeitssuchenden galten. Es folgten Berichte, die den zwei zitierten SZ-Artikel ähnelten, nur dass sie weniger direkt von der Pressearbeit der Allianz
der EU-migrantischen Arbeiter*innen mit ver.di und Initiative Zivilcourage geprägt waren. Sie beschrieben den Alltag am ‚Tagelöhnermarkt‘ und porträtierten einzelne Arbeitssuchende und deren Probleme. In der TV-Kurzsendung Die dunkle Seite Deutschlands als Teil
der Abendschau des Bayerischen Rundfunks trat Ahmed Maksud im
Oktober 2010 als Protagonist auf („Die dunkle Seite Deutschlands“,
2010). Im Juni 2011 strahlte der Deutschlandfunk die Sendung Auf dem
Arbeiterstrich („Auf dem Arbeiterstrich“, 2011) aus und im Oktober
2011 titelte die Münchner Obdachlosenzeitschrift BISS: Suche Arbeit!
Unterwegs mit bulgarischen Tagelöhnern (Hoffinger, 2011). Im Oktober
2011 erschien in der SZ die preisgekrönte Reportage: Scheißegal, ich
mache alles (Reinsberg, 2012), die vom Alltag auf dem selbstorganisierten Arbeitsmarkt erzählt und dabei mit einer Vielzahl von wörtlichen
Zitaten arbeitet: „Irgendwas versautes“ (ebd.) sagt Hristo zu der Frage, was seine Tattoos bedeuten. „Alle funf Minute [sic]“ (ebd.) kämen
Polizisten vorbei. „Arbeit mit Geld: gut. Arbeit ohne Geld: schlecht“
(ebd.) und eben: „Scheißegal, was für ein Job, ich mache alles“ (ebd.).
Neben diesen viktimisierenden Zitaten, die die Sprecher*innen auf
ihre Grundbedürfnisse reduzieren, mit Tieren gleichsetzen und als
dem Arbeitsmarkt hilflos ausgesetzt darstellen, sind jedoch auch eine
Reihe von Statements enthalten, die politische Analyse, Humor und
Wut zum Ausdruck bringen. So spielt die Aussage „Wir müssen auf
den Straßen Europas gut aussehen“ (ebd.) humorvoll mit Sauberkeitsdiskursen und Vermarktungszwang. Direkt an die Lesenden richtet
sich folgende wütende Frage: „Was ist das für ein Land, in dem du
arbeitest, kein Geld kriegst und dann von der Straße gejagt wirst?“
(ebd.). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Artikel, auch wenn sie
110
�auch immer wieder viktimisierende und stereotype Töne anschlugen,
die prekarisierten Lebens- und Arbeitsverhältnissen und die Probleme
der EU-Migrant*innen an die Öffentlichkeit brachten und diese auch
selbst zu Wort kommen ließen. Dies sollte sich bald ändern.
Einen deutlich anderen Akzent setzte schon der Artikel Münchens Tagelöhner – ein Leben im Schatten aus dem Münchner Merkur vom Februar
2012 (Hampel, 2012), in dem ich den Beginn der vierten Phase ausmache.
Dies war der erste Artikel, in dem Vertreter*innen von Kommune, Polizei und Zoll als Betroffene zu Wort kamen. Die Problemdefinition fing
an, sich zu drehen. In der dritten Phase, die sich teils mit der zweiten
und den darauffolgenden zeitlich überschneidet, ging es nicht mehr um
die Probleme der Arbeitssuchenden, sondern um die Arbeitssuchenden
als Problem: „Bei der Stadt hat man das Problem erkannt – und erste
Schritte unternommen“ (ebd). Aus der Perspektive der Kommune ging
es um die „Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit“ (ebd.), wobei die Aufnahmefähigkeit von Hilfsangeboten, des Sozialhilfesystems und des Wohnungsmarktes gemeint waren. Die Benennung von Lösungen erfolgte
aber immer noch in Bezug auf die Probleme und Forderungen der Arbeitssuchenden: „Es fehlt eine zentrale Anlaufstelle für die bulgarischen
und rumänischen Tagelöhner“ (ebd.). Die ‚Tagelöhner‘ selber kamen in
diesem Artikel aber nicht zu Wort und die illustrierenden Fotografien
unterstreichen das ungleiche Verhältnis und Blickregime: Während Savas Tetik, aktiv bei der Initiative Zivilcourage, auf einem großformatigen
Porträt direkt in die Kamera schaut (Untertitel: „Bei jedem steckt eine
Geschichte dahinter“ – Savas Tetik kämpft um Gerechtigkeit für Tagelöhner“), wurden die ‚Tagelöhner‘ durch ein Bild von drei Silhouetten
von Menschen mit Schutzhelm, die sich gegen das Gegenlicht der Sonne
beim Arbeiten auf einer Baustelle abzeichnen, symbolisiert (Untertitel:
„Schuften auf dem Bau: Viele werden von Subunternehmern beschäftigt – manchmal ohne Lohn“) (ebd.). Der ehrenamtliche Helfer ‚kämpft‘,
während die Tagelöhner als Opfer von Ausbeutung ‚schuften‘.
Ein ähnliches Blickregime prägte eine Reihe von Artikeln, die die Arbeit
von Ehrenamtlichen und Sozialarbeiter*innen in den Vordergrund rückten: Auf der Suche nach dem Glück titelte am 20. Juni 2013 der Münchner Merkur (Hampel, 2013). Der Anlass für den Artikel war die Eröffnung des von der Arbeiterwohlfahrt getragenen und vom städtischen
Referat für Arbeit und Wirtschaft finanzierten Infozentrums Migration
und Arbeit, die als das Ergebnis lang andauernder Versuche gesehen
111
�werden kann, die Forderung nach einem Aufenthaltsraum umzusetzen, die bereits in dem erwähnten Flyer vom Mai 2010 formuliert worden war.55 In dem Artikel von Hampel (2013) wurde den bulgarischen
Münchner*innen, die das Thema des Artikels bilden, nicht nur Sprechposition und Expert*innenstatus, sondern auch ein persönlicher Name
verweigert. Während sie anonym mit „die Frau“ (ebb.), „der Mann“
(ebd.), das „Ehepaar“ (ebd.) oder „ein Mitglied“ (ebd.) bezeichnet wurden, wurden die zwei „Berater“ des städtischen Sozialprojekts namentlich genannt.56
Am 22. August 2013 berichtete die SZ über „[d]ie Straßenarbeiter“, wobei
hier nicht nur die Arbeitssuchenden gemeint waren, sondern in einem
Wortspiel auch Mitglieder bzw. „Helfer“ der Initiative Zivilcourage, die
mangels eines Raumes – das Haus, in dem die Kammerspiele die Zentrale ihres Stadtteilprojektes aufgebaut hatten, war im Rahmen der Aufwertung des Viertels inzwischen abgerissen worden – zwischenzeitlich
auf der Straße arbeiteten (vgl. Risel, 2013a). Der Bericht entstand aus
Anlass einer Pressemitteilung der Initiative Zivilcourage, die zu einem
Infostand einlud. Sein Untertitel lautete:
„Die Initiative Zivilcourage kümmert sich im Bahnhofsviertel um
Menschen, die auf dem ‚Arbeiterstrich‘ schuften. Weil das Haus abgerissen wird, in dem die Helfer einen Raum hatten, sitzen sie nun selbst
auf der Straße.“ (ebd.)
Den zentralen Erzählstrang in den letzten drei Artikeln bildeten die
Aktivitäten von Ehrenamtlichen und Sozialarbeiter*innen, während die
EU-migrantischen Arbeiter*innen nicht zu Wort kamen.
Bis zu diesem Zeitpunkt verknüpften sich die verschiedenen Erzählstränge in unterschiedlichen Gewichtungen und wurden kontextualisiert
55
Bis zum Sommer 2015 sollte das Infozentrum aber keinen geeigneten
und bezahlbaren Raum finden, um neben dem Beratungsangebot auch einen
Aufenthaltsraum anbieten zu können. Wie schon im ersten Kapitel erwähnt
verzichte ich aus forschungsethischen Gründen darauf, auf die Aushandlungen, die zu der Eröffnung des Aufenthaltsraumes führten, näher einzugehen.
Hier gebe ich nur, sozusagen als Nebenprodukt der Analyse des ‚Kampfes um
Deutung‘, einen kleinen Einblick.
56
Einer von ihnen war der Leiter des Stadtprojekts, der in dem Artikel
aus dem Münchner Merkur vom 25./26. Februar 2012 noch als Mitglied der Initiative Zivilcourage aufgetreten war.
112
�von (selten korrekten) Informationen z.B. zur rechtlichen Lage von
Bulgar*innen in Deutschland, zur Diskriminierung von Minderheiten
in Bulgarien und zu Statistiken der Ein- und Abwanderung. Festhalten
lässt sich, dass die EU-migrantischen Arbeiter*innen in Koalition mit
der Initiative Zivilcourage und auch mit gewerkschaftlichen Akteuren
den medialen Diskurs anfangs stark prägen konnten. Die bis hierher
analysierten Artikel, in denen Arbeiter*innen zu Wort kommen, sind so
auch als (relativ autonome) Produkte ihrer representational politics zu
lesen. Erst durch ihre Intervention im Jahr 2010 kam die Figur ‚Tagelöhnermarkt‘ in den öffentlichen Diskurs. Die Artikel problematisierten die
extrem ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse und den entbehrungsreichen Alltag am ‚Tagelöhnermarkt‘. Der Versuch, die Probleme der Arbeitssuchenden darzustellen und ihrer Repräsentation und ihren Forderungen eine hegemoniale Stellung im Diskurs zu geben, gelang aber nur
teilweise. Dagegen wirkten zum einen die Tendenz der Medien, rassistischen Blickregimen zu folgen. Sie ließen eher die ‚sich kümmernden‘
Personen als ‚Expert*innen‘ zu Wort kommen, als die EU-migrantischen
Arbeiter*innen selbst über ihre Situation berichten. Und wenn diese zu
Wort kamen, dann hatten ihre Worte oftmals eine rein ausschmückende und keine tragende Funktion. Der strukturelle Rassismus artikulierte sich zudem auch hier nicht nur in den Blickregimen, sondern auch
schon in rassistischen Stereotypen, die ich im zweiten Teil dieses Kapitels analysieren werde.
Bis Anfang 2013 wurde der Münchner ‚Tagelöhnermarkt‘ noch als
ein sehr lokales, spezifisches Phänomen wahrgenommen. Spätestens die sogenannten ‚Armutszuwanderungsdebatte‘ etablierte
einen bundesweiten Diskurs, in den die lokale Figur ‚Tagelöhnermarkt‘ eingebettet wurde. Dieser Medienhype zur ‚Armutszuwanderung‘ wurde im Januar 2013 von der im siebten Kapitel thematisierten Stellungnahme des Deutschen Städtetags (mit) ausgelöst
und u.a. von dem Wahlkampfslogan der CSU ‚Wer betrügt, der fliegt‘
angefacht (vgl. Roßmann, 2013).57 Im Zuge dieser ‚Debatte‘ kons57
Die Debatte drehte sich auch darum, welche Konsequenzen die Einführung der vollen Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit für bulgarische und rumänische Staatsbürger*innen am 1. Januar 2014 haben würde (sie mussten dann
keine Arbeitserlaubnis mehr beantragen). Im siebten Kapitel werde ich näher
auf das Positionspapier des Städtetages eingehen und nachvollziehen, welche
Effekte es auf die Gesetzgebung hatte.
113
�tituierte sich der Begriff der ‚Armutszuwanderung‘ als hegemoniale Bezeichnung für das neu entdeckte Problem der Migration aus
Bulgarien und Rumänien.58 Schwerpunktmäßig drehte sie sich um die
Frage, ob es sich bei den ‚Armutszuwanderer*innen aus Südosteuropa‘
um ‚Sozialleistungstourist*innen‘ oder um ‚steuerzahlende‘ Erwerbstätige handelte, die etwas zur ‚deutschen Wirtschaft‘ beitrugen. Der bundesweite Diskurs soll hier aber nicht im Vordergrund stehen; vielmehr
geht es mir darum zu zeigen, welche Effekte er in der lokalen Berichterstattung hatte. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint der SZ-Artikel
Arbeitsmigranten aus Osteuropa – Endstation „Arbeitsstrich“ (Öchsner,
2013) vom 10. Februar 2013 prägnant, der offenbar anlässlich des Städtetagpapiers geschrieben wurde und mit jenem Foto vom ‚Arbeiterstrich‘ illustriert war, welches auf Anlass der Reportage Lohn und Leid
(Bacher, 2010) entstanden war. Die Hauptaussage des Artikels lautete:
„Bund, Länder und Kommunen suchen nun nach Lösungen“ (Öchsner,
2013). Diese Aussage wurde mit einigen Hintergrundinformationen zur
„humanitäre[n] Katastrophe“ (ebd.) in verschiedenen deutschen Städten
und zu kommunalen Hilfeprojekten, und mit statistischen Angaben und
Aussagen aus dem Städtetagpapier (Deutscher Städtetag, 2013) kontextualisiert. Auch wenn der Münchner ‚Arbeiterstrich‘ bildlich dargestellt
wurde, wurde weder er noch München im Fließtext erwähnt. Das Foto
vom ‚Tagelöhnermarkt‘ wird hier zum Symbol für ‚Armutszuwanderung‘ beziehungsweise „Arbeitsmigranten aus Osteuropa“. Die Figur
des ‚Arbeiterstrichs‘ wurde (noch implizit) verknüpft mit dem neuen
Topos der Armutszuwanderung. Inwiefern die im Sommer 2013 folgende Diskursverschiebung (hin zu einer fünften – der wohl turbulentesten
– Phase) mit dem bundesweiten Medienhype zusammenhing, ist nicht
empirisch nachzuweisen, ich nehme aber einen engen Zusammenhang
an.
Ende August 2013, etwa ein halbes Jahr nach dem Aufflammen der bundesweiten Debatte zur Armutszuwanderung, schlug jedenfalls eine Bombe in den Mediendiskurs zum ‚Tagelöhnermarkt‘ ein und die Münchner
Lokalmedien stimmten in Bezug auf den ‚Tagelöhnermarkt‘ in den bundesweiten Chor der Skandalisierung von ‚Armutszuwanderung‘ ein. Bei
58
Die ‚Debatte‘ beruhte, wie Markus End (2014a) herausgearbeitet hat,
in weiten Teilen auf antiziganistischem Rassismus und auf einem verwertungslogischen Konsens, der zwischen den Nützlichen und den Unnützen unterscheidet (vgl. Friedrich, 2014).
114
�dieser ‚Bombe‘ handelte sich um eine Petition von „Anwohner[n] und
Arbeitnehmer[n] an der Kreuzung Goethestraße / Landwehrstraße“.
Federführend gewesen war der CSU-nahe Betreiber des gemeinnützigen Vereins Theatergemeinde (TheaGe), die Theatertickets zu ermäßigten Preisen verkaufte und deren Büro direkt an der zentralen Kreuzung
des selbstorganisierten Arbeitsmarktes lag. Unterschrieben hatten 18
Betreiber*innen oder Vertreter*innen der umliegenden Gewerbe – Hotels, die Theatergemeinde, ein Juwelier, eine Apotheke, eine Bank, ein
Café, ein Friseur, eine Anwaltskanzlei, ein Döner-Imbiss, ein Supermarkt und die ‚islamische Gemeinde‘. Die Unterzeichnenden forderten
eine „Anerkennung der stetig wachsenden Probleme mit illegalen Arbeitsmärkten an unserer Kreuzung“ und drückten die Bereitschaft aus,
„jede humane und soziale Lösung zu unterstützen, die dazu beiträgt,
dass Menschen nicht von kriminellen Schleppern und Bauunternehmern
ausgenutzt und missbraucht werden“. Die Schilderung des zu lösenden
Problems fiel brachial aus: das Viertel würde „[V]on stetig wachsenden
Mengen von Arbeitern“ „belagert“, „blockiert“, „vermüllt“, es würde „gespuckt“, „uriniert“, und „belästigt“. „Diese Szenerie“ wurde verantwortlich gemacht für „ernsthafte Probleme mit gesundheitsgefährdenden
Schädlingen“ und „aggressive Szenen“. Um ein „normales Wohnen und
Arbeiten“ möglich zu machen und mit dem Hinweis, „dass auch wir ein
Recht haben auf ein humanes und zivilisiertes Leben und Arbeitsumfeld“, forderten die Autor*innen der Petition „koordinierte, konsequente
und nachhaltige Gegenmaßnahmen sowohl im Bereich der Sozial- wie
auch Polizeiarbeit“, so „dass unsere Kreuzung nicht von einer solchen
Szenerie immer mehr in Beschlag genommen wird“. Denn die „aktuellen
Verhältnisse“ seien „nicht hinnehmbar und dürfen sich nicht verfestigen“ (ebd.). Ein CSU-Bundestagsabgeordneter und ehemalige Münchner Leiter des Kreisverwaltungsreferats sprang den Geschäftsleuten zur
Seite und berief noch in derselben Woche einen Runden Tisch mit Zoll
und Polizei ein, bei dem unter anderem schärfere Kontrollen durch diese Institutionen vereinbart wurden, die im vierten Kapitel thematisiert
werden.
Im direkten Anschluss sprangen die Boulevardblätter Bild und tageszeitung (tz) auf und läuteten damit die fünfte Phase ein. Sie hatten zuvor
noch nicht zum selbstorganisierten Arbeitsmarkt berichtet. Am 26. und
28. August 2013 titelten sie: Aufstand gegen Schwarzarbeiter (Bachner,
2013) und Aufstand gegen den Arbeiter-Strich – Müll, Urin und Ärger!
115
�Verzweifelter Hilferuf der Geschäftsleute (Costanzo, 2013a). Auch SZ und
BR berichteten. Ihr Vokabular unterschied sich nun stark von den bisherigen Berichten zu den Arbeitssuchenden: Ärger mit den Schwarzarbeitern, so die Schlagzeile der SZ (Risel, 2013c) und Ärger um Tagelöhner
titelte der BR („Ärger um Tagelöhner - Petition gegen ‚Arbeiterstrich‘,
2013). Am 31. August 2013 brachte die tz noch ein follow-up: Zoll verschärft seine Kontrollen – Kameras und Polizei gegen ‚Arbeiterstrich‘„
(Costanzo, 2013b) und auch der Fokus nahm in dem Bericht Armutszuwanderung in München – Endstation Arbeiterstrich vom 30.10.13 (Rohrer,
2013) noch direkt Bezug auf die Petition. Die Journalist*innen geben in
diesen Artikeln vor allem den Unterzeichnenden der Petition das Wort
mit Zitaten wie: „Die Schwarzarbeiter betteln, belagern Hinterhöfe, verdrecken Schächte, bieten sogar Frauen zur Prostitution feil!“ (Bachner,
2013). Oder: „Sie übernehmen langsam das Viertel. Und die Behörden
lassen uns alleine“ (Bachner, 2013).
Städtische Akteure positionierten sich in den Medienberichten gegenüber dem brachial-rassistischen Duktus der Petition eher kritisch und
beschwichtigend. Die Sozialreferentin der Stadt München wandte in der
tz ein, dass viele Migrant*innen durch die Tagelöhnerei einen „richtigen
Job“ fänden; außerdem machten die Behörden „die Erfahrung, dass die
Menschen nicht dem Sozialstaat auf der Tasche liegen wollen“ (Siegert,
2013). Auch Zoll und Polizei versuchten gegenüber den Journalist*innen,
die Petition zu relativieren. Sie verwiesen auf ihre Machtlosigkeit gegenüber der rechtmäßigen Präsenz der freizügigen Arbeitssuchenden im
öffentlichen Raum: „Jeder EU-Bürger kann sich bewegen, wie er möchte“ (Costanzo, 2013a): „[d]as Herumstehen reiche nicht, um sie dingfest
zu machen“ (ebd.). Trotzdem übernahmen sie die Problemdefinition der
Petition weitgehend. So impliziert das letztere Zitat, dass es schon wünschenswert wäre, „sie dingfest zu machen“ (ebd.), aber es eben (‚leider‘)
keine rechtliche Handhabe gäbe. Der Zollsprecher sagte, dass Vertreter des Zolls trotz der schwierigen rechtlichen Lage „präsent [seien],
versuchen es einzudämmen“ (Bachner, 2013), denn es handle sich um
Schwarzarbeit und Lohn-Dumping. „Mehr Kontrollen würden das Problem aber nicht lösen. „Die Szene würde nur weiterziehen“ (ebd.). Auch
die Polizei gab an, die Probleme zwar zu sehen, aber nicht viel tun zu
können: „Wir können nur kontrollieren, erteilen Platzverweise“ (ebd.),
so ihr Sprecher in der Bild-Zeitung.
116
�Die Initiative Zivilcourage erhielt im Rahmen des von der Petition ausgelösten Medienhypes nun sehr wenig Aufmerksamkeit – vor allem verglichen damit, dass sie zuvor als zentrale Ansprechpartnerin in Sachen
„Tagelöhnermarkt“ gegolten hatte. In zwei Artikeln wurde ein Mitglied
der Initiative Zivilcourage als Experte für die Situation der Betroffenen
zitiert, während seine Kritik am Rassismus der Petition unerwähnt
blieb: „Ich habe keine Aggression erlebt“ (Costanzo, 2013a) und „sie
wollen arbeiten und finden in München auch eine Arbeit“ (ebd.). In der
AZ bekräftigte er noch einmal: „Hier finden sie Arbeit, auch wenn der
Zugang zum Arbeitsmarkt eingeschränkt ist“ (Siegert, 2013).
Besonders auffällig war aber, dass die als „Schwarzarbeiter“ Markierten in den Artikeln zum „Ärger“ im Bahnhofsviertel gar nicht zu Wort
kamen. Sie wurden auch nicht mehr individuell porträtiert oder auch
nur erwähnt, sondern traten nur noch als gesichtslose Menge in Erscheinung. In der Darstellung der Petition und den von ihr ausgelösten Artikeln war das Problem nicht mehr eines der Arbeitssuchenden,
sondern sie selbst stellten das Problem in Form einer Bedrohung des
„sozialen Friedens“ dar. Die Gruppe der Geschäftsleute erkämpfte sich
mit der Petition eine weithin wahrgenommene Sprechposition, mit der
sie die Figur der ‚Schwarzarbeiter‘ als Problem einführten und zur konkreten Gefahr stilisierten. Im vierten Kapitel werde ich zeigen, wie sie
– trotz beschwichtigender Stimmen von Seiten der Sicherheitsbehörden
– neue repressive Versuche des Regierens aktivierten. Die Stimmen der
Arbeitssuchenden wurden aus den Artikeln zur Petition ausgeschlossen. Die Intervention der Geschäftsleute aktivierte den bundesweiten
Diskurs zur Armutszuwanderung auf lokaler Ebene. Es verschob damit
die bisherige Darstellung des selbstorganisierten Arbeitsmarkts, knüpfte aber auch an die vorhergehende Entdeckung, Erfindung und Skandalisierung der (Probleme der) ‚Tagelöhner‘ an.
Nachdem das mediale Interesse am ‚Arbeiterstrich‘ wieder abgeflaut
war, wandte es sich erst nach fast zweimonatiger Pause im Oktober
2013 wieder den ‚Tagelöhnern‘ zu. In den im Folgenden erschienenen
Artikeln wurde der ‚Tagelöhnermarkt‘ unter dem Themenfeld ‚Armutszuwanderung‘ subsumiert. Sie drehten sich zentral um Obdachlosigkeit
und ‚wildes Campieren‘ und nur sekundär um den ‚Tagelöhnermarkt‘.
In der SZ-Reportage Tagelöhner in München – Ware Mensch vom 30.10.13
(Risel, 2013b) wurde ein obdachloser Arbeitssuchender begleitet und
zitiert. Berichtet wurde über Hristov Jusuf, seinen Unterschlupf und
117
�seiner Suche nach Arbeit „für einen Hungerlohn“ (ebd.). Hristof fand
sich hier in einer Position der Verteidigung, des Schon-Markiert-Seins
wieder, wenn er erklären musste, was er nicht sei: Er sei von der „großen Welle an Ablehnung, die [ihm] … entgegenschlägt, überrascht: ‚Wir
sind doch keine Verbrecher.‘ […] ‚Ich bin nach Deutschland gekommen,
um zu arbeiten, nicht, um gegen Gesetze zu verstoßen‘“ (ebd.). Nahtlos fügten sich kriminalisierend-skandalisierende Unterüberschriften
wie „Jagd nach mutmaßlichen Schwarzarbeitern“ (ebd.) in den Fließtext
ein. Im Artikel Gefühlte Unsicherheit (Fuchs, 2013) in der SZ wurden
zwar Klagen über „[a]ggressive Bettler, herumlungernde Tagelöhner
und mangelnde Sicherheit“ (ebd.) angesprochen – der Polizeipräsident
käme auf seinem Rundgang durch das Bahnhofsviertel aber „zu einem
anderen Urteil“ (ebd.), es gäbe weniger Verbrechen im Viertel als noch
vor zehn Jahren, die Unsicherheit sei eben nur „gefühlt“ (ebd.): „Der Arbeiterstrich und die Bettler seien vor allem ‚soziale Probleme‘, die nicht
von der Polizei zu lösen seien“ (ebd.).
Eine kleine Notiz mit dem Titel Rassismus-Vorwürfe gegen Zoll in der
SZ vom 24. Oktober 2013 (Kastner, 2013) verwies auf einen Versuch von
Arbeiter*innen in Koalition mit der Initiative Zivilcourage, gegen den
Rassismus, der sich im Anschluss an die Petition auch in neuen Formen der Repression von Seiten der Polizei und des Zolls artikulierte,
zu protestieren. Die Erklärung des Zolls zu dem Vorwurf – „Wir wollen
den Leuten nichts Böses“ (ebd.) – nimmt dabei mehr Platz ein als die
Beschreibung des Vorfalls aus der Sicht der Kontrollierten.
Der letzte Artikel in meinem Korpus, Schattendasein aus der SZ vom
25.11.13 (Grundner, 2013), erwähnte ‚Tagelöhner‘ aus Anlass der Räumung eines unerlaubten Zeltlagers am Rande Münchens: „Morgens warten sie im Bahnhofsviertel auf Arbeit, abends verkriechen sie sich am
Stadtrand unter Planen und Kartons: Tagelöhner aus Osteuropa“ (ebd.).
Neben einem Polizisten und einer Sozialarbeiterin kommt der Leiter des
Amtes für Wohnen und Migration als „einer der Ersten, der gesehen
hat, was da auf München zurollt“ (ebd.) zu Wort. Er wird uns in der vorliegenden Arbeit noch öfters begegnen. Weder EU-Migrant*innen noch
die Initiative Zivilcourage spielen eine Rolle. Mit Ende 2013 beende ich
die Materialsammlung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deutung des ‚Tagelöhnermarktes‘ und der ‚Tagelöhner‘ stark umkämpft war. Akteure dieser Auseinandersetzung waren die EU-Migrant*innen in Koalition
118
�mit der Initiative Zivilcourage und mit Gewerkschaftssekretär*innen,
Vertreter*innen der Stadtverwaltung und von Wohlfahrtsorganisationen, Zoll und Polizei sowie lokale Geschäftsleute; außerdem berichteten
Journalist*innen in einer relativ autonomen Weise über die Praktiken
und Aussagen dieser unterschiedlichen Akteure. Zwei Ereignisse haben
den Diskurs besonders nachhaltig beeinflusst: Erstens die öffentliche
Anprangerung der Probleme der Arbeitssuchenden am selbstorganisierten Arbeitsmarkt und zweitens die Petition der Geschäftsleute, die
den ‚Arbeiterstrich‘ als Problem skandalisiert. Insgesamt erschien es
der Koalition aus EU-migrantischen Arbeiter*innen und der Initiative
Zivilcourage mit der Zeit immer schwieriger, die Journalist*innen dazu
zu bewegen, ihre Perspektiven auf die Problemlagen wiederzugeben.
Sie hatten die (relative) Diskurshoheit verloren. Je stärker die Präsenz
der migrantischen Arbeitssuchenden als Problem konstruiert wurde, je
weiter wurde ihnen ihre Sprechposition entzogen – sie wurden desartikuliert (vgl. Hall, 2004), zum Schweigen gebracht. Auf der Ebene des
medialen Diskurses setzten sich ungleiche Machtverhältnisse und Blickregime durch.
Auch wenn es in diesem Kapitel dezidiert um den Mediendiskurs
geht, möchte ich doch kurz auf die Frage eingehen, inwiefern diese medialen Kämpfe um Deutung den selbstorganisierten Arbeitsmarkt überhaupt direkt berührten. Auf der einen Seite tangierten
sie den konkreten Alltag im Bahnhofsviertel nur peripher, die Arbeitssuchenden haben von den deutschsprachigen Zeitungsartikeln
meist nicht einmal etwas mitbekommen. Auf der anderen Seite hatte die Berichterstattung direkten Einfluss auf die grundlegenden
Entscheidungen über den politischen Umgang der Stadt München
mit dem ‚Tagelöhnermarkt‘ und der ‚Armutszuwanderung‘ (siehe
Kapitel 4). Sowohl die Gründung des Infozentrums Migration und
Arbeit, wie auch vermehrte Kontrollen durch Polizei und Zoll können (auch) darauf zurückgeführt werden, wie die Medien die Initiativen lokaler Akteure aufgriffen (siehe Kapitel 3). Insofern verdeutlicht die Analyse der Auseinandersetzungen das Spannungsfeld,
in denen sich die representational politics der Koalition aus EUMigrant*innen und Aktivist*innen der Initiative Zivilcourage (inklusive mir) bewegten: Sie stellten eine wirkmächtige Strategie
dar, um die Verhältnisse und insbesondere die Politik der Stadt zu
beeinflussen, aber die geschaffenen Figuren liefen gleichzeitig in
119
�Gefahr, angeeignet und umgedeutet zu werden. So kann die Figur
des ‚Tagelöhnermarktes‘ im Bahnhofsviertel auch als ein Kind der
Koalition aus EU-migrantischen Arbeiter*innen und Initiative Zivilcourage und gelesen werden, das bald nicht mehr zu kontrollieren
war.59 Doch (relativ) unabhängig von der Berichterstattung setzten die
Arbeiter*innen am selbstorganisierten Arbeitsmarkt ihre hartnäckigen
alltäglichen Praktiken – ihre imperceptible politics – fort und ließen sich
von den Versuchen, den ‚Tagelöhnermarkt‘ als Problem zu definieren
und als solches zu lösen, nicht vertreiben.
Intersektionale Assemblagen des Rassismus
Bis hierhin ging es darum, in welchen Verhältnissen, mit welchen Effekten und von wem der mediale Diskurs zu den ‚Tagelöhnern‘ umkämpft
war. Im Folgenden frage ich, wie genau sich Rassismen in der Berichterstattung artikuliert haben: Welchen Logiken und Stereotypen folgten
sie? Damit beschränke ich mich bewusst auf eine Analyse des Rassismus
auf sprachlicher Ebene (mit einzelnen Bildanalysen), auch wenn dies
sowohl materialistischen Analysen von Kräfteverhältnissen, wie auch
dem material turn, der auch in der Rassismusforschung angekommen
ist (vgl. Papadopoulos & Sharma, 2008), entgegenläuft. Mir erscheint es
aber in Hinsicht auf die Frage nach den Versuchen des Regierens in
besonderer Weise zielführend, zu analysieren, wie sich Rassismen im
medialen Diskurs artikulierten – gerade, weil dieser so eng mit den sozialen Kräfteverhältnissen, Körpern und Subjektivierungen verschränkt
war.60
Dazu greife ich auf das Konzept der Assemblagen des Rassismus zurück,
mit dem Marianne Pieper und Vassilis Tsianos zum Ausdruck bringen,
59
Noch im März 2017 stellten die Grünen im Stadtrat einen Antrag, „diesen sog. Tagelöhner-‚Strich‘ auf[zu]lösen“ (Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion 2017).
60
Nicht zu vernachlässigen wäre in einer weiterführenden Analyse
auch die Vorstrukturierung des Diskurses durch eine weiß, deutsch und mittelständisch (SZ, BR) bzw. auch proletarisch (Boulevardblätter) imaginierte Leserschaft. Gemeinsam mit den imaginierten Adressat*innen richten die
Journalist*innen – meist weiß, deutsch, bürgerlich – den Blick auf die nichtweißen, nicht-deutschen, nicht-zeitungslesenden ‚Anderen‘ und berichten über
sie.
120
�dass verschiedene Rassismen nebeneinander bestehen und sich miteinander verschränken, sich gegeneinander oder wechselseitig verstärken und immer in situ neu verhandelt werden (vgl. Tsianos & Pieper,
2011). Der Mediendiskurs zum „Tagelöhnermarkt“ als lokale, umkämpfte Assemblage des Rassismus gibt Einblick in das „erratische Archipel
verschiedener, einander zum Teil überlagernder Formationen“ (Tsianos,
2015: 60) des Rassismus „in den postkolonialen und postmigrantischen
Gesellschaften Europas“ (ebd.). Und auch wenn, nach Stuart Hall, „ständig Versuche unternommen [werden], in die vielen potentiellen Bedeutungen des Bildes zu intervenieren und einer davon zu einem privilegierten Status zu verhelfen“, so gilt doch trotzdem: „Bedeutung ‚fließt‘,
sie kann nicht endgültig festgeschrieben werden“ (Hall, 2004: 110).
Zugleich konnte die Petition ihre Wirkmacht nicht allein aufgrund des
Einflusses ihrer Sprecher*innen entfalten. Für das Verdrängen der Stimmen der Tagelöhner aus der Berichterstattung und Markieren des Tagelöhnermarkts als hygienisches und kriminelles Problem war auch entscheidend, dass das rassistische Bilderrepertoire sowie die verknüpften
konservativen Logiken und repressiven Praxen schon vorhanden und
sagbar waren und nur abgerufen bzw. rekombiniert werden mussten.
Bevor ich also die Medienberichte auf rassistische Stereotype untersuche, gebe ich einen kurzen Einblick in aktuelle Debatten der Rassismusforschung.
Kolonial bis postliberal – Artikulationen des Rassismus
In der Rassismusforschung hält sich die Vorstellung einer zeitlichen
Entwicklung des Rassismus vom universellen Rassismus des 18. Jahrhunderts, dem die Idee eines „sich in Stufen vollziehenden Fortschritts der
menschlichen Kultur als eines Ganzen“ (Bojadžijev, 2008: 21) zugrunde
liegt, über den superioren Rassismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der die Überlegenheit der europäischen (oder arischen) Völker
gegenüber anderer Völker konstruierte, zum differenziellen, oder auch
kulturalistischen Rassismus des 20. und 21. Jahrhunderts, der „eng verzahnt [ist] mit den antikolonialen Kämpfen und der säkularen Krise
des kapitalistischen Weltsystems Anfang der 1970er Jahre“ (ebd.) und
sich in Europa vor allem anhand der Vorstellung von ‚unvereinbaren
121
�Kulturen‘ und „um die Migrationsprozesse dynamisiert“ (ebd.; vgl. auch
Hall, 2004). Daneben wird auch eine Entwicklung vom biologistischen
zum kulturalistischen Rassismus ausgemacht. Ersterer beruht auf der
Überzeugung, die Menschheit bestehe aus grundlegend verschiedenen
biologischen ‚Rassen‘, die phänotypisch zu erkennen sind und physisch
sowie psychisch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Er wird dem Kolonialismus, der Sklaverei und auch dem Nationalsozialismus diagnostiziert. Stuart Hall erklärt etwa, Rassismus habe sich zur Zeit der Sklaverei vor allem artikuliert in der Figur der
„inhärente[n] ‚Faulheit‘ von Schwarzen, die ‚von Natur aus‘ nur zur
Knechtschaft geboren und fähig, gleichzeitig aber sturer Weise unwillig seien, auf eine Art zu arbeiten, die ihrer Natur angemessen und
profitabel für ihre Herren war.“ (Hall, 2004: 129)
In der Logik des kulturalistischen Rassismus – auch „Neo-Rassismus“
oder „Rassismus ohne Rassen“ (Balibar & Wallerstein, 2014) genannt
– ist Differenz demgegenüber nicht von Blut und Genen, sondern von
der Sozialisierung bzw. ‚Kultur‘ bestimmt. ‚Kulturen‘ werden dabei
gerne mit Religionen, Nationalstaaten oder geographischen Zonen
gleichgesetzt. Einflussreich sind Theorien wie der „Kampf der Kulturen“ (Huntington, 1996) oder kulturessenzialistische Begriffe wie der
des ‚Kulturkreises‘. Heute artikuliert sich dieser Rassismus vor allen in
Problematisierungen von Migration, insbesondere der Migration von
Muslim*innen (vgl. Solomos, 2002; Hall, 2004). Der neue Rassismus
behaupte „[w]eniger Überlegenheit als Unvereinbarkeit der ‚Eigenen‘
mit den ‚Anderen‘“, stellt Manuela Bojadzijev fest. Dem widerspricht,
meiner Einschätzung nach, aber die weit geteilte Überzeugung, der
‚christlich-abendländische Kulturkreis‘ und insbesondere die ‚deutsche Leitkultur‘ seien dem ‚Islam‘ überlegen. An dieser kleinen Unstimmigkeit zeigt sich schon, wie widersprüchlich und pauschalisierend diese Einteilungen sind. So wurden auch schon zu Zeiten der
Sklaverei kulturelle Faktoren ausgemacht, wieso Sklaven nicht frei sein
könnten und in manchen kolonialen Denksystemen konnten die Kolonisierten zu ‚europäischer Größe‘ erzogen werden. Eine Aufteilung
in klar zeitlich abgrenzbare Phasen des Rassismus erscheint mir sehr
vereinfachend, da die jeweiligen rassistischen Konjunkturen nicht auf
eine dieser Logiken zu beschränken waren, zeitlich über diese Phasen
122
�hinauswirken und in jeder Situation spezifisch sind. Um konkrete,
umkämpfte Assemblagen des Rassismus analysieren zu können, ist es
aber dennoch wichtig, die verschiedenen Spielweisen des Rassismus,
die sich in ihnen verschränken, auf ihre Geschichte und Eigenheiten zu
befragen.
Neuerdings machen diverse Autor*innen auf eine erneute Rekonfiguration rassistischer Konjunkturen aufmerksam. Während die
Sozialwissenschaftler*innen Alana Lentin und Gavan Titley vom „racial
neoliberalism“ (Lentin & Titley, 2011: 165) sprechen, prägen u.a. Vassilis Tsianos und Marianne Pieper (2011) den Begriff des postliberalen
Rassismus. Diese neueren Spielarten des Rassismus produzieren „systematisch Ausgrenzung und Diskriminierung […], ohne sich explizit
und vorsätzlich rassistischer Begründungs- und Deutungsmuster zu
bedienen“ (Tsianos, 2015: 60). Es handelt sich um „Neo-Rassismen, die
sich über eine Rhetorik der ‚Emanzipation‘ und Aufklärung definieren“
(Dietze, 2009: 24) und somit „das Erbe sowohl der Krise des ‚differentiellen Rassismus‘ als auch des gegen ihn artikulierten Antirassismus“
(Tsianos, 2015: 61) antreten. Sie artikulieren sich in der Bekräftigung
einer Gesellschaft, die Rassismus überwunden hat und für Diversität
und Chancengleichheit eintritt, diese aber an sogenannten westlichen
Werten bemisst. Post-rassistische Rationalitäten sind in der Regel nicht
mehr gegen Migration, sondern sie geben sich tolerant, weltoffen, rational und emanzipiert – sie differenzieren aber zwischen ‚guten‘ und
‚schlechten‘ Migrant*innen. Im Sinne des neoliberalen Fokus auf das
Individuum wird auch ‚Rasse‘ privatisiert (vgl. Giroux & Goldberg,
2006): Das Individuum scheint frei, sich von der angeblich rückständigen Kultur zu befreien und zu einem guten Migranten bzw. einer guten
Migrantin zu werden. Bei dieser Freiheit handelt es sich aber um einen
Trugschluss, auch weil der Generalverdacht, zurückzufallen, über den
Individuen hängen bleibt. Die ‚Anderen‘ sind von dem Generalverdacht
betroffen, nicht emanzipiert, aufgeklärt, fleißig, produktiv, vernünftig,
rechtschaffen, tolerant, gebildet, fleißig (genug) zu sein, oder in anderen Worten: den ‚westlichen‘ bzw. ‚christlich-abendländischen‘ Werten
nicht zu entsprechen. Post-rassistische Rationalitäten feiern Diversität
und Vielfalt als gesellschaftliches und wirtschaftliches Potenzial, sehen
dieses aber wahlweise von ‚homophoben arabischen Männern‘ (vgl.
Puar, 2007; Tsianos, 2015), ‚kopftuchtragenden muslimischen Frauen‘,
123
�‚sozialschmarotzenden Roma‘, ‚kinderreichen afrikanischen Familien‘
oder eben von ‚unqualifizierten Armutszuwander*innen‘ bedroht.
Neben der zeitlichen Aufteilung der Konjunkturen des Rassismus gibt
es Versuche, regionale Spezifika des Rassismus in Bezug auf (Migration
aus) Osteuropa zu erfassen. Die bulgarische Historikerin Maria Todorova wirft einen Blick auf die „historischen Vermächtnisse“ (Todorova,
2004) zwischen den als ‚Westeuropa‘ und ‚Balkan‘ oder ‚Osteuropa‘ bezeichneten Gebilden. Sie untersucht, wie der Balkan als Europas „dunkle Seite“ (ebd: 235) erfunden wurde, wie „eine essentielle Differenz zwischen Stabilität und Rationalität im westlichen Raum und Instabilität
und Irrationalität im Balkanraum konstruiert“ (Krause, 2008: 168) wird,
wie der Sozialwissenschaftler Johannes Krause feststellt. Anders als der
Orient, der als „inkompatibel“ zum Westen imaginiert wird, habe der
Balkan, so Todorova, als „unvollständiges Selbst“,
„immer das Bild einer Brücke oder einer Übergangszone hervorgerufen: zwischen Ost und West, aber auch zwischen Wachstumsstadien,
was eine Etikettierung als ‚halbentwickelt‘, ‚halbkolonial‘, ‚halbzivilisiert‘, ‚halborientalisch‘ usw. nach sich zog.“ (Todorova, 2004: 234)
Eine wichtige Rolle in der Analyse des Rassismus gegenüber
Migrant*innen aus Osteuropa spielen aktuell Forschungen zu Antiziganismus bzw. Rassismus gegen Roma (vgl. End, 2014; Van Baar, 2012).
Beispielsweise wurde der mediale Diskurs in Deutschland mit Schwerpunkt auf die Jahre 2011-2013 von Markus End (2014) und Alltagsdiskurse um Zuwanderung am Beispiel Duisburg-Hochfeld von Bente Gießelmann (2013) auf Stereotype und Sinnstrukturen des Antiziganismus
untersucht. Antiziganismus drücke sich in den folgenden Stereotypen
aus: Nomadentum, Parasitentum, Sorg- und Disziplinlosigkeit, sexuelle und geschlechtliche Amoralität, Missachtung von Eigentum, Chaos,
Schmutz und fehlendes Interesse an Bildung (vgl. End 2014). Die Armut
der Roma sei selbstverschuldet, da sie sich nicht um die Zukunft sorgten, sondern im Hier und Jetzt lebten und keine Disziplin hätten. Dabei
ist es oft die Verknüpfung der Stereotype, die nach End die antiziganistische Botschaft ausmacht:
124
�„Gerade eine Kombination verschiedener Bilder, die für sich genommen jeweils harmlos erscheinen, prägt die derzeitige Darstellung von
‚Roma‘ in den Medien“ (ebd.: 47).
Auch wenn sich Rassismen im Sinne von diskursiven Ordnungen, historischen Entwicklungslinien und gesellschaftlichen Aus- bzw. Einschlüssen unterscheiden, überschneiden sich verschiedene Rassismen in konkreten Auseinandersetzungen
miteinander. Es wäre zu kurz gedacht, den medialen Diskurs zum „Tagelöhnermarkt“ alleine als antiziganistisch zu bezeichnen – auch wenn er
dies sicherlich auch ist.
Mit Tsianos und Pieper gehe ich davon aus, dass Rassismen sich in spezifischen, temporären und lokalen Assemblagen artikulieren, die überdeterminiert sind und ständig ausgehandelt werden. Analytisch möchte
ich den Fokus also auf die Widersprüche, Uneindeutigkeiten und Überlagerungen in der konkreten rassistischen Assemblage des Mediendiskurses zum sogenannten „Tagelöhnermarkt“ legen. Dazu ist es nötig,
ganz konkret die verschiedenen rassistischen Stereotype und Argumentationen aufzuzeigen, die sich in ihm artikulieren.
Stuart Halls Repräsentationsregimeanalyse als
Werkzeugkasten
Im Folgenden möchte ich mich also darauf konzentrieren, wie Rassismus
in der Berichterstattung zum ‚Tagelöhnermarkt‘ und den ‚Tagelöhnern‘
zum Ausdruck kommt. Welche Konstruktionen von Differenz erhalten
Plausibilität und wie? Wie wird Differenz dargestellt bzw. was wird wie
als different dargestellt? Welche Stereotype, Logiken und Figuren lassen
sich analysieren? Wie werden die Subjekte und sozialen Ordnungen des
selbstorganisierten Arbeitsmarktes im Münchner Hauptbahnhofviertel
in den untersuchten Fragmenten des öffentlichen Diskurses dargestellt?
Ich konzentriere mich bewusst auf eine Analyse der sprachlichen Ebene
(mit einzelnen Bildanalysen)61 und greife auf den Werkzeugkoffer der
61
Nicht zu vernachlässigen wäre in einer weiterführenden Analyse
auch die Vorstrukturierung des Diskurses durch eine weiß, deutsch und mittelständisch (SZ, BR) bzw. auch proletarisch (Boulevardblätter) imaginierte Leserschaft. Gemeinsam mit den imaginierten Adressat*innen richten die
125
�Cultural Studies, genauer gesagt Stuart Halls Repräsentationsregimeanalyse, zurück.
Hall fragt in seinem Essay Das Spektakel des ‚Anderen‘, wieso und wie
Differenz repräsentiert wird und arbeitet einige Analysebegriffe heraus,
die auch für meine Analyse der Berichterstattung zum ‚Tagelöhnermarkt‘ relevant sind. Anhand einer Analyse von Werbeplakaten und
einer historischen Rückschau zeigt er, dass „das Andere“ anhand von
vereinfachten, festgeschriebenen (d.h. angeblich unveränderbaren)
und als natürlich betrachteten Eigenschaften bzw. Merkmalen dargestellt wird. Die Formen der Repräsentation nennt er Stereotype: „Stereotypisierung reduziert Menschen auf einige wenige, einfache Wesenseigenschaften, die als durch die Natur festgeschrieben dargestellt
werden“ (Hall, 2004: 143). Stereotype werden oft erst in der Häufung
über viele Diskursfragmente sichtbar - wird einmal ein Schwarzer
Mann als besonders sexuell attraktiv oder aktiv dargestellt, kann dies
ein Zufall sein, wiederholt sich dies aber immer wieder, schreibt sich
das Stereotyp intertextuell in die öffentliche Wahrnehmung ein, so dass
schon kleine Hinweise genügen, damit es lesbar wird. Die „Anhäufung
und Veränderung von Bedeutung über verschiedene Texte hindurch“
(ebd.:115) bezeichnet Hall als Inter-Textualität. „[D]as gesamte Repertoire an Bildern und visuellen Effekten, durch das ‚Differenz‘ in einem
beliebigen historischen Moment repräsentiert wird“ (ebd.) bezeichnet
er als Repräsentationsregime. Stereotype funktionieren oft durch doppeldeutige Tropen wie etwa die Begriffspaare Helden/Schurken oder
Natur/Kultur. Sie bestehen dann aus binären Bedeutungspaaren:
„Diese Zweideutigkeit ist wichtig, denn sie verdeutlicht, dass Menschen, die auf irgendeine signifikante Weise von der Mehrheit
verschieden – ‚sie‘ und nicht ‚wir‘ – sind, oft binären Formen der
Repräsentation ausgesetzt werden. Sie werden scheinbar durch gegensätzliche, polarisierte, binäre Extreme wie gut/schlecht, zivilisiert/primitiv, hässlich/übermäßig attraktiv, abstoßend-weil-anders/
anziehend-weil-fremd-und-exotisch repräsentiert. Und oft wird von
ihnen gefordert, beides zur gleichen Zeit zu sein!“ (ebd.: 111f.)
Journalist*innen – weiß, deutsch, bürgerlich – den Blick auf die nicht-weißen,
nicht-deutschen, nicht-zeitungslesenden ‚Anderen‘ und berichten über sie.
126
�Dabei zieht eine Differenz die andere an, weswegen Hall von einem
„Spektakel des ‚Anderen‘“ spricht (ebd.: 108) – ganz im Sinne des Begriffes der Assemblagen des Rassismus. Wie wird Differenz in der Berichterstattung zum ‚Tagelöhnermarkt‘ also repräsentiert, welche Stereotypen lassen sich ausmachen?
‚Schwarzarbeiter‘, ‚Ungeziefer‘, ‚Freiwild‘ – Eine
Assemblage des Rassismus
Der erste und grundlegende von sechs rassistischen Stereotypen bzw.
Tropen im medialen Diskurs zum ‚Tagelöhnermarkt’, ist die Aufteilung
in eine ‚In-Group‘ und ‚die Anderen‘: Sie vs. Wir. Diese Gegenüberstellung zeichnet sich vor allem in den Artikeln zur Petition und in
der Petition selbst sehr deutlich ab. „Sie sagen: Das ist unser Revier!
Aber auch wir Anwohner haben ein Recht auf unsere Kreuzung!“ (Risel, 2013c, Hervorhebung durch Autorin) so wird der Verfasser der
Petition in der SZ vom 30.08.13 zitiert. Er fährt fort: „Jetzt geht es um
die Frage: Wer hat hier das Sagen?“ (ebd.). Von wem geht die angebliche Bedrohung aus? Der SZ-Artikel zitiert einen Juwelier, der seine Kund*innen nicht mit einer größeren Summe Geld auf die Straße
treten lassen wolle: „Vor dem Schaufenster mit dem Schmuck in der
Auslage hatte sich eine Gruppe von Männern osteuropäischer Herkunft versammelt. ‚Dunkle Gestalten‘ wie Kinaci sagt, die bedrohlich
wirkten“ (Risel, 2013c). Es wäre zwar nichts passiert, „[d]och mittlerweile käme es häufiger zu solchen unangenehmen Szenen“ (ebd.).
Hier und in ähnlichen Darstellungen werden die Arbeitssuchenden
als „dunkel“ (Risel, 2013c), „geschäftsschädigend“ (Bachner, 2013; Risel, 2013) „aggressiv“ (Siegert, 2013), „bedrohlich“ (Risel, 2013c) und
„sehr befremdlich“ (ebd.) dargestellt. Im Gegenzug erklären die Personen, die die Petition unterzeichnet haben, dass sie ihr „Recht […]
auf ein humanes und zivilisiertes Leben und Arbeitsumfeld“ bzw. auf
ein „normales Wohnen und Arbeiten“ verteidigten und eine „humane
und soziale Lösung“ forderten. Diese Zitate bauen eine klare Binarität auf – das imaginierte, normale ‚Wir‘ muss sich der Bedrohung
durch die ‚Anderen‘ erwehren. Hier wird auf prototypische Art und
Weise deutlich, wie rassistische Stereotypisierung als eine „Praxis der
‚Schließung‘ und des Ausschlusses“ (Hall, 2004: 144), nach Stuart Hall,
127
�„das Normale und Akzeptable vom Anormalen und Unakzeptablen
ab[trennt], um letzteres dann als nicht passend und andersartig auszuschließen und zu verbannen“ (ebd.). Auf der anderen Seite steht „das
‚Zusammenbinden‘ oder ‚Zusammenschweißen‘ zu einer ‚imaginierten
Gemeinschaft‘“ (ebd.).
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass auch das konstruierte ‚Wir‘
im medialen Diskurs zum ‚Tagelöhnermarkt‘ ein vielfältiges ist, das
nicht nur aus weißen Deutschen besteht. Im Zusammenhang mit der
Petition wurde immer wieder betont, dass auch (post-)migrantische
Hotelbesitzer*innen, Vertreter einer Moschee und der Betreiber des
Döner-Imbisses am selbstorganisierten Arbeitsmarkt sich für ‚normale‘, ‚humane‘ und ‚soziale‘ Arbeits- und Wohnverhältnisse aussprächen.
Vom ‚Arbeiterstrich‘ gestört fühlten sich im medialen Diskurs auch
„arabische Touristen“ (Bachner, 2013) und „[Hotel-]Gäste aus China,
Russland oder den USA“ (Risel, 2013c). Schon in dem ersten Artikel
Probebohrungen im Biotop zum Projekt der Kammerspiele wurden Vielfalt, Diversität und Buntheit als Merkmale des prosperierenden Bahnhofsviertels dargestellt (Rühle, 2010). Im Sinne der Image-Kampagne
des Vereins Südliches Bahnhofsviertel liegen genau im „Großstadtflair“
und der „Multikultur“ des Viertels dessen „spezifische Qualitäten und
Potenziale“. (Südliches Bahnhofsviertel e.V., 2016) Die Gemeinschaft
der (post-)migrantischen und nicht-migrantischen Geschäftsleute, der
Tourist*innen und kaufkräftigen Kund*innen, der das Potenzial wirtschaftlicher Prosperität und einer ‚normalen Nachbarschaft‘ zugeschrieben wird, stellt eine „good diversity“ im Sinne von Alana Lentin und
Gavin Titley (2011) dar. Die selbstidentifizierten Angehörigen der ‚good
diversity‘ sehen sich bedroht von den Vertreter*innen der ‚bad diversity‘, die in der „Tagelöhner-Mafia“ (Bachner, 2013), den ‚Schwarzarbeitern‘ und dem ‚Arbeiterstrich‘ ausgemacht wird. Nicht nur das bedrohte
‚Wir‘ wird als ein vielfältiges dargestellt, sondern auch die neu ankommenden Migrant*innen werden aufgeteilt in solche, die zu ‚Uns‘ passen
und solche, die die angebliche Normalität stören.
Ganz zentral waren dem Diskurs Auseinandersetzungen um die Deutung der Arbeitstätigkeit der ‚Tagelöhner‘. Das negative Stereotyp
‚Schwarzarbeiter‘ – auch ‚Opfer von Menschenhandel‘ und/oder
‚Sozialbetrüger*in‘ – wurde der positiven Zuschreibung der ‚nützlichen Arbeiter‘, die zur Allgemeinheit beitragen, gegenüber gestellt.
Diese Trope stellt neben der Unterscheidung zwischen ‚Uns‘ und den
128
�‚Anderen‘ das zweite Merkmal des Diskurses zum ‚Tagelöhnermarkt‘
dar. Sowohl die Sozialreferentin wie auch der Vertreter der Initiative
Zivilcourage intervenierten in die reißerisch-rassistische Berichterstattung zur Petition mit der Aussage, dass die Arbeitssuche am selbstorganisierten Arbeitsmarkt oft durchaus erfolgreich sei. Im Bayerischen
Rundfunk erklärte das Sozialreferat, „dass ein Großteil der Osteuropäer
in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ist – natürlich gebe es aber auch Schattenseiten“ („Ärger um Tagelöhner – Petition gegen ‚Arbeiterstrich‘“, 2013). Die Sozialreferentin betonte zudem,
dass die Behörden „die Erfahrung [machten], dass die Menschen nicht
dem Sozialstaat auf der Tasche liegen wollen“ (ebd.). Hier werden nicht
alle ‚Tagelöhner‘ bzw. ‚Osteuropäer‘ in einen Topf geworfen, sondern
im Sinne von Leistungsideologie zwischen den Nützlichen und den Unnützen unterschieden. In diesen leistungsideologischen Spielweisen des
postliberalen Rassismus verschränken sich rassistische und chauvinistisch-klassistische Figuren. Es sind allen voraus die illiberal-weil-unproduktiven Anderen bzw. die nicht-deutschen, nicht-weißen Leistungsverweigerer, die als Gefahr für die liberale, vielfältige Gesellschaft gelten.
In Prozessen der Überdeterminierung verstärken sich die unterschiedlichen Zuweisungen noch. Die Frage, ob es sich hier nicht viel eher um
Klassismus oder Chauvinismus statt um Rassismus handelt, erübrigt
sich, denn beide sind nicht voneinander zu trennen sondern überformen
sich gegenseitig.
Drittens bedient sich rassistische Stereotypisierung auch in den untersuchten Artikeln ganz brachial dem Hygienediskurs (vgl. Sarasin, 2001)
und ruft damit besonders deutlich auch antiziganistische Vorurteile auf.
Einen Tiefpunkt stellt zum einen das von der Petition eingeführte Bild
der „gesundheitsgefährdenden Schädlinge“, die mit dem ‚Tagelöhnermarkt‘ aufgetaucht seien, dar und zum anderen der Untertitel des tzArtikels vom 28. August 2013: „Müll, Urin und Ärger“ (Costanzo, 2013a).
Schmutz tritt aber auch schon vor der Petition als Thema auf, nämlich
durch die Betonung seiner Abwesenheit. Intertextuell funktioniert die
Stereotypisierung hier schon nach dem selben Muster wie in der Petition, denn nur zuvor als ‚schmutzverdächtig‘ markierte Personen müssen als sauber erklärt werden. Während die Tagelöhner in Lohn und
Leid „frühmorgens […] trotz nächtlicher Strapazen in nahezu knitterfreier Kleidung, mit Gel in den Haaren und geputzten Schuhen an der
Kreuzung stehen“ (Bacher, 2010), trägt „Hussein“ in der preisgekrönten
129
�Reportage Scheißegal, ich mache alles vom 07. Oktober 2010 ein „weißes
Leinenhemd, das grau melierte Haar ist frisch geschnitten“ (Reinsberg,
2012) und sagt: „Wir müssen auf den Straßen Europas gut aussehen“
(ebd.). Im selben Artikel finden sich auch erste direkte Schmutzallegorien: „Eine Kehrmaschine spritzt die Bürgersteige sauber und die Männer
nass, die Bulgaren springen zur Seite. Der Boden, auf dem sie stehen, ist
jetzt sauberer als sie selbst.“ (ebd.)
Auch in der Ausgabe des BISS vom Oktober 2011 spülte eine Müllabfuhr
„den Schmutz der Nacht […] in die Gullys“ (Hoffinger, 2011), während
„zwei dutzend Männer […] an der Kreuzung [stehen], und verbeulte
Jogginghosen und langärmelige Shirts mit Flecken unter den Armen“
(ebd.) tragen. Nicht nur hier zeichnen sich die Artikel zur Petition durch
ihre Deutlichkeit aus, während die Artikel, die nicht direkt mit der Petition in Zusammenhang stehen, die rassistischen Stereotype tendenziell
nicht so direkt ausspielen, sondern mit indirekten Metaphern oder Umkehrungen ummanteln.
In ihrer Analyse von Alltagsdiskursen um Zuwanderung in DuisburgHochfeld, die einige Parallelen zu den Münchner Verhältnissen aufweisen, spricht Bente Gießelmann von einer „Ethnisierung des Schmutzes“:
„Hier geht es nicht nur um eine konkrete Müll-Problematik, sondern
um die Verhandlung von Ordnung und Sauberkeit auf einer symbolischen Ebene, die über das Müll-Narrativ funktioniert. Auf einer abstrakteren Ebene wird das Eigene, gekennzeichnet durch disziplinierte
Sauberkeit und Ordnung, durch das als deviant markierte Verhalten
der (neuen oder länger anwesenden) ‚Fremden‘ bedroht. Insofern findet hier eine ‚Ethnisierung von Müll‘ statt. Inwiefern in einer symbolischen Ordnung Heimat und Sauberkeit gegenüber Zuwanderung
und Dreck verknüpft werden und ‚Müll‘ latent auch die (Anwesenheit
der) Zugewanderten bezeichnet, liegt nahe und sollte durch weitere
diskursanalytische Untersuchungen gezeigt werden.“ (Gießelmann,
2013: 33f.)
Nicht nur die Straßen, sondern auch die Körper Arbeitssuchender werden zum Austragungsort des Hygienediskurses (vgl. z.B. Sarasin, 2001).
Sie werden mit verunreinigenden Aktivitäten in Verbindung gebracht
und so im übertragenen Sinne selbst als Verunreinigung dargestellt.
Stuart Hall stellt fest, dass sich viele Stereotype auf Körper – z.B. auf
130
�Sexualität, Hautfarbe oder physische Stärke – beziehen: Der „Körper
wurde zum diskursiven Ort, über den ein Großteil dieses ‚rassisierten
Wissens‘ produziert und in Umlauf gebracht wurde“ (Hall, 2004: 128). In
der Petition kommt es so beispielsweise metaphorisch zu einer Gleichsetzung zwischen den Körpern der ‚Schwarzarbeiter‘ und den Körpern
der Schädlinge. Außerdem wird das Verhalten der Tagelöhner*innen im
medialen Diskurs als beschmutzend dargestellt: „Der Anblick der Männer, die im Pulk auf dem Bürgersteig stehen oder rauchend in Hauseingängen sitzen, sei für diese [Hotelgäste aus China, Russland oder
den USA]‚ sehr befremdlich‘“ (Risel, 2013c), so wird eine Hotelbetreiberin in der SZ zitiert. Einige Zeilen später spricht der Geschäftsführer
der TheaGe davon, wie die Männer „spuckend vor unserer Tür“ (ebd.)
stehen. Zudem werden die Wartenden durchgehend als rauchend beschrieben. Die Bedeutung des Rauchens – im öffentlichen Diskurs stark
umkämpft, zwischen nonchalanter Coolness und gesundheitsgefährdender Schwäche – gewinnt hier eindeutig einen abwertenden Touch in
Resonanz mit biopolitischen Kampagnen zur Gesundheitsschädlichkeit
und Selbstsorge. Auch die Rede von Tattoos, die in fast allen Artikeln
auftaucht, reduziert die Subjekte auf ihre Körper und setzt diese in Bezug zu mangelnder Selbstpflege und Hygiene. In dem Artikel Scheißegal,
ich mache alles weiß der Analphabet über die Tattoos an seinem Hals
nur, dass sie „irgendwas Versautes“ (Reinsberg, 2012) bedeuten. In ähnlicher Weise funktionieren ökonomische Metaphern, die Menschen auf
ihre Körperkraft reduzieren: „Alles, was Ilja anbieten kann, ist die Kraft
seines Körpers. Seine Arme zum Heben, seinen Rücken zum Schleppen,
seine Hände zum Spülen“ (ebd.). Die Reduzierung auf Körper und Analogien zu Schmutz sind nicht nur für rassistische und insbesondere antiziganistische, sondern gleichzeitig auch für klassistische Abwertung typisch. Mangelnde Körperhygiene, Drogenkonsum oder Faulheit werden
auch weiß-deutschen Obdachlosen oder Arbeitslosen vorgeworfen (vgl
Lehnert 2009). Hier wird wieder deutlich, wie verschiedene Formen der
Abwertung und Ausgrenzung in unterschiedlichen Verhältnissen wirkmächtig werden – bzw. wie die Verhältnisse auch zusammenhängen.
Eine vierte Spielart des Rassismus besteht auch in den untersuchten
Berichten darin, dass die Arbeitssuchenden entkonkretisiert (vgl. Gießelmann, 2013) und entmenschlicht werden. Dies zeigt sich nicht nur
dadurch, dass ihre Namen im medialen Diskurs oft nicht genannt werden (während die Namen der ‚Expert*innen‘ immer angegeben werden),
131
�sondern vor allem dann, wenn nicht über einzelne Personen, sondern
über gesichtslose Kollektive gesprochen wird. In den Zeitungsartikeln
zur Petition wird mit Begriffen wie „Zuständen“ (Costanzo, 2013a), „unangenehme Szenen“ (Risel, 2013c) oder eben „Arbeiterstrich“ (Bachner,
2013; Costanzo, 2013a; Siegert, 2013) auf die Präsenz der Arbeitssuchenden verwiesen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei Fotografien eingehen, mit denen die Süddeutsche Zeitung fast alle ihrer Artikel
zum „Tagelöhnermarkt“ illustriert hat. Damit folge ich dem Beispiel von
Stuart Halls Repräsentationsanalyse, der in seiner Analyse von fotografischen Repräsentationen Schwarzer Athlet*innen feststellt: „Zwei
Diskurse – der Diskurs der geschriebenen Sprache und der Diskurs der
Fotografie – werden benötigt, um die Bedeutung zu produzieren und
festzuschreiben“ (Hall, 2004: 111). Der Fotograf Robert Haas hatte die
Recherchen zu der Reportage Lohn und Leid (Bacher, 2010) begleitet.
Auch weil die Initiative Zivilcourage und ver.di die Recherchen unterstützt und Kontakte vermittelt hatten, hatte er keine Probleme mit dem
Zugang zu den Arbeitssuchenden. So konnten ungestellte und dicht
wirkende Fotos aus deren Alltag entstehen.
Das den Artikel Lohn und Leid (Bacher, 2010) illustrierende großformatige Foto ist ausgeglichen komponiert. Im rechten Fünftel ist ein junger
Mann in Trainingsjacke und Jeans seitlich von Kopf bis unterhalb der
Hüfte zu sehen. Er hat einen freundlichen Gesichtsausdruck und blickt
schräg rechts an dem/der Betrachter*in vorbei. Der Rest des Bildes stellt
die spiegelnde Fensterfront des Gebäudes dar, vor der er steht. Das sehr
klare, aber von vier Streben fragmentierte Spiegelbild zeigt zum einen
den jungen Mann – spiegelverkehrt – und zum anderen fünf weitere
Personen, die mit ihm in einer Gruppe zu stehen scheinen. Noch von
einem weiteren Mann ist das Gesicht zu sehen. Bei einer der Personen handelt es sich wohl um eine Frau, was an ihrer Statur und einem
Pferdeschwanz erkennbar scheint. Das Bild porträtiert gleichzeitig eine
Einzelperson und positioniert diese in einer Gruppe. Durch den Spiegeleffekt macht es einen phantomhaften und transparenten Eindruck, als
seien die gespiegelten Personen gar nicht präsent. Die Verbildlichung
verbindet sich gut mit den Metaphern der ‚Unsichtbarkeit‘ und des ‚Lebens im Schatten‘, wie sie zwar nicht in diesem Artikel, aber in anderen
vorkommen.
Drei Jahre später illustriert ein weiteres Foto des selben Fotografen,
das wahrscheinlich in der selben Situation entstanden ist, den Artikel
132
�Endstation „Arbeiterstrich“ (Öchsner, 2013). Diesmal handelt es sich um
zwei Männer in Trainingsjacken, die bis unterhalb der Schultern – also
näher – abgebildet sind, die rechte Hälfte des Bildes einnehmen und
auf der linken noch einmal spiegelverkehrt zu sehen sind. Hier sind sie
aber von hinten abgelichtet, nur ihre Hinterköpfe und ein knapp angeschnittenes Profil sind zu sehen. Sie blicken von den Betrachter*innen
weg, scheinen sich von ihnen und aus dem Bild heraus zu entfernen. Im
Hintergrund, in einigen Metern Entfernung sind fünf weitere Personen
verschwommen zu erkennen. Eine Frau ist auf dem Bild nicht zu sehen.
Wurde in dem für Lohn und Leid (Bacher, 2010) gewählten Bild eine
Person porträtiert und den Betrachtenden näher gebracht, gibt es hier
keine Identifikationsfigur mehr, sondern eine anonyme Gruppe, die sich
bei großer Nähe gleichzeitig auch abwendet.62
Die Bildsprache in den Artikel der Boulevardpresse zur Petition zeigt
die Entmenschlichung noch deutlicher. Auf zwei Fotos, die den tz-Artikel Aufstand gegen den Arbeiter-Strich (Costanzo, 2013a) illustrieren,
geht es gar nicht mehr um die Darstellung von einzelnen Personen; die
Gestalten auf den Bildern wirken vielmehr nur als Beweismaterial für
die ‚Szenerie‘, die direkt neben den Bildern durch die Unterüberschrift
„Müll, Urin und Ärger!“ charakterisiert wird. Die Gesichter der jeweils
vier bzw. sechs auf dem Gehsteig stehenden und sitzenden Männern
sind verpixelt. Die wie Schnappschüsse wirkenden Fotos sind aus einiger Entfernung, wohl aus einem Auto und von der anderen Straßenseite
62
Wie bereits beschrieben, handelt der durch dieses Bild illustrierte Artikel in Reaktion auf das Papier des Städtetages von der bundesweiten
Belastung der Kommunen und der humanitären Katastrophe, als deren Ursache die „Arbeitsmigranten aus Osteuropa“ ausgemacht wird; München ist im
Fließtext nicht erwähnt, sondern ist nur durch das Foto und seinen Untertitel
inhaltlich und intertextuell mit dem Artikel verknüpft. So wird das Foto der
Münchner EU-Migrant*innen auf einmal zum Symbol für den (bundesweiten)
‚Arbeiterstrich‘ als Endstation der ‚Armutszuwanderung‘. Der ‚Arbeiterstrich‘
wird dadurch intertextuell mit der hegemonialen, paternalistischen Annahme
verbunden, dass die EU-Migrant*innen ‚keine Perspektive‘ in München bzw.
Deutschland hätten, dass ihr Migrationsprojekt aussichtslos sei. Auf diese Annahme werde ich in Kapitel 4 bei der Analyse der städtischen Obdachlosenpolitik wieder zurückkommen. Das selbe Symbolfoto wurde dann auch gewählt,
um die Artikel Ärger mit den Schwarzarbeitern (Risel, 2013c), Ware Mensch (Risel, 2013b) und Schattendasein (Grundner, 2013) zu illustrieren.
133
�aufgenommen. Es entsteht der Eindruck, dass der Fotograf die Fotos
unbemerkt von den fotografierten Personen aufgenommen hat.
Die fünfte Spielweise des Rassismus, die ich im analysierten Diskurs
erkenne, besteht darin, dass Gender und ‚Rasse‘ verknüpft bzw. die Arbeitssuchenden maskulinisiert werden. Das oben erwähnte Foto, das den
Artikel Lohn und Leid (Bacher, 2010) illustriert, ist der einzige Moment
in meiner Materialsammlung, in dem arbeitssuchende Frauen am „Tagelöhnermarkt“ dargestellt oder erwähnt werden. Es scheint mir daher
kein Zufall zu sein, dass auf dem Illustrationsfoto des Artikels Endstation „Arbeiterstrich“, das ja die selbe Situation darstellt im Einklang mit
dem hegemonialen Narrativ von den „Tagelöhnern“ keine Frau mehr zu
sehen ist. Es avancierte in den folgenden Artikeln quasi zum Symbolbild für den „Tagelöhnermarkt“. Auch im Diskurs zu den „Tagelöhnern“
(und nicht den „Tagelöhner*innen“) verschränken sich rassistische Verhältnisse mit Paternalismus, Heteronormativität und Sexismus. Balibar
stellt fest, dass „es letzten Endes absurd [ist], wenn man versucht, Rasse
und Rassismus von ihrem Klassen-, Geschlechts- und Religionskontext
zu trennen“ (Balibar 2008: 24). Die Darstellung des ‚Tagelöhnermarktes‘
ist auf verschiedene Weise vergeschlechtlicht. Vor allem zeichnet sich
der Diskurs durch die Maskierung der Präsenz von arbeitssuchenden
Frauen am selbstorganisierten Arbeitsmarkt aus. Nur in dem Artikel mit
dem Titel Lohn und Leid ist überhaupt von „Frauen, die an der Kreuzung
auf Arbeit warten“ (ebd.) die Rede und hier kommt auch das einzige Mal
eine Frau selbst zu Wort – allerdings mit einem Zitat, das rassistische
Hygiene- und Viktimisierungsfantasien bedient: „Es bleibt uns nichts
anderes übrig, als die Theresienwiese als Klo zu benutzen“ (ebd.). Wenn
Frauen in den anderen Artikeln Erwähnung finden, dann als Teil der Familie im Heimatland, für deren Ernährung die männlichen „Tagelöhner“
schuften. Während arbeitssuchende oder arbeitende ‚Tagelöhnerinnen‘
nicht weiter vorkommen, wird die Opferfigur feminisiert. So ist zum
Beispiel immer wieder von Frauen die Rede, die sich nicht mehr trauen
alleine zur Arbeit zu gehen. Im Bild-Artikel zur Petition werden Frauen
als Opfer dargestellt: ‚Schwarzarbeiter“ „bieten Frauen zu Prostitution
feil“ und „pöbeln unsere Kassiererinnen an“ (Bachner, 2013). So unterstreicht die vergeschlechtlichte Darstellung das Bedrohungszenario,
134
�indem die Arbeitssuchenden maskulinisiert, ihre angeblichen Opfer
feminisiert und die arbeitssuchenden Frauen unsichtbar gemacht werden.63
Beim sechsten rassistischen Merkmal des untersuchten Diskurses handelt es sich um die gleichzeitig viktimisierende und kriminalisierende Trope, mit der die Arbeitssuchenden wahlweise als Täter oder als
Opfer dargestellt werden. Die ‚Tagelöhner‘ wurden durchgehend als
Opfer von Ausbeutung und organisierter Kriminalität konstruiert und
gerade in ihrer Eigenschaft als Arbeiter*innen als passiv und abhängig
dargestellt. Schon in einem der ersten Artikel wird die Viktimisierung
besonders schonungslos deutlich: die Arbeiter seien „Freiwild für betrügerische Subunternehmer, die billige Arbeitskräfte ausnutzen“ (Bacher,
2010). Die Reportage Scheißegal, ich mache alles (Reinsberg, 2012) zielt
in die gleiche Richtung:
„Arbeiterstrich – so heißt eine Straßenecke mitten in München, an der
Billig-Tagelöhner aus Südosteuropa auf einen Job für ein paar Euro
warten. Sie sind moderne Arbeitssklaven, frei verfügbar, zu riskanten
Tätigkeiten bereit. Und werden oft um ihr Geld betrogen.“ (ebd.)
Wenn im Zusammenhang mit der Petition betont wird, die ‚Schwarzarbeiter‘ seien „arme Menschen“ (Bachner, 2013; Costanzo, 2013a; Risel, 2013c), „arme Hunde“ (Siegert, 2013) beziehungsweise „die Ärmsten
der Armen“ (Costanzo, 2013a), dient das Adjektiv ‚arm‘ nicht nur als
ökonomischer Marker, sondern bezeichnet ihrer Passivität und Bemitleidenswertigkeit: „Die armen Menschen!“ (Siegert, 2013). Und auch die
ihnen zugeschriebenen Tätigkeiten verstärken den passiven Eindruck:
Sie „warten“ (Costanzo, 2013a; Hampel, 2012), „stehen herum“ (ebd.),
„hoffen“ (Bachner, 2013), „lungern herum“ (Bachner, 2013), „schlurfen“
(Reinsberg, 2012), „trudeln ein“ (ebd.), „murmeln“ (ebd.) und „friste[n]
ein Leben“ (Tibudd, 2010). Neben Passivität stellt Unwissenheit eine
weiteres Merkmal des Stereotyps ‚Opfer‘ dar. Die Arbeitssuchenden
63
Meiner Beobachtung nach warten Frauen zwar tatsächlich seltener als
Männer über längere Zeit an der Kreuzung auf Arbeit. Nadja (eine der Frauen,
von deren Arbeitskampf und Migrationsprojekt das erste Kapitel handelt), berichtete aber sehr wohl, dass sie hier schon Arbeit gefunden hätten. Wenn ich
mich durch das Viertel bewege, treffe ich nicht nur Männer, sondern eben auch
Frauen. Sie bewegen sich im Viertel und gehen auch Arbeiten in den Geschäften und Hotels nach.
135
�hätten nicht gewusst, worauf sie sich einließen, bevor sie nach München
kamen. Sie „[a]rbeiten oft illegal, ohne es zu wissen“ (Bachner, 2013), sie
könnten weder Lesen und Schreiben (Reinsberg, 2012), noch die deutsche Sprache sprechen (Hampel, 2012).
Als narrative Strategie fällt die argumentative Verknüpfung von Opferdarstellungen mit der Ankündigung oder auch Aufkündigung eines
Ultimatums ins Auge: „‚Die tun niemandem etwas, das sind ganz arme
Hunde‘“, so wurde ein Hotelchef in der AZ zitiert, „Aber es geht so einfach nicht mehr“ (Siegert, 2013). Die SZ zitiert den Geschäftsführer der
Theatergemeinde in indirekter Rede: „Und obwohl er die Menschen, die
an der Kreuzung stehen, respektiere und ihre Lage bedaure, sei für ihn
ein Punkt erreicht, wo etwas getan werden müsse“ (Risel, 2013c). Die
tz wies die entsprechende Positionierung pauschal den „Anwohnern“
zu: „Die Tagelöhner sind die Ärmsten der Armen. Das sagen auch die
Anwohner. Doch jetzt haben sie genug von den Zuständen“ (Costanzo,
2013a). Die viktimisierenden Vorschübe neutralisieren die auf sie folgende Aussage. Viktimisierung immunisiert so Forderungen nach Repression und maskiert Rassismus. Die Sprechenden bescheinigen sich
einen vernünftigen, objektiven und zivilisierten Umgang mit der Situation, was das Urteil und den Aufruf zum Tätigwerden aber nicht nur legitimiert, sondern auch unterstreicht. Die kurzen Vorsätze im humanitaristischen Opfersprech machen diese Aussagen anschlussfähig an den
öffentlichen Diskurs. So betont gerade die renommierte Tageszeitung
SZ das Mitleid und Verständnis der Geschäftsleute für die Arbeitssuchenden.
Wo Opfer sind, sind die Täter nicht weit: „Criminalisation is the
flipside of victimisation“, so stellt Vicky Squire (2014) fest. Verschiedene Forschungen zu Migrationsregimen zeigen, dass die janusköpfige Figur der Viktimisierung/Kriminalisierung wichtiger Teil des allgemeinen
Einwanderungsdiskurses und insbesondere der Teildiskurse zu Flucht,
„illegaler Einwanderung“ und „Menschenhandel“ ist (vgl. Andrijašević,
2007; Bahl, Ginal & Hess, 2010; Karakayalı, 2008).64 Diese Trope stellt ein
64
Oft hat die Figur der Viktimisierung/Kriminalisierung die Funktion,
verschiedene Akteure unter dem gemeinsamen und kaum abzulehnenden Ziel
des Opferschutzes an einen Tisch zu bringen, wobei am Ende die Bekämpfung
von Migration als logisches und hegemoniales Fazit steht (vgl. Andrijašević,
2007; Bahl & Ginal, 2009). Nur so sei gegen die kriminell organisierten Schlepper und Menschenhändler vorzugehen und der Ausnutzung armer Menschen
vorzubeugen.
136
�typisches Muster antimigrantischer Rassismen und repressiver Versuche des Regierens dar. Der Kriminalisierungs-/Viktimisierungs-Nexus
unterstützt das Silencing der Akteure, denn die Figur der Opfer ist passiv und spricht nicht. Vor allem in den ersten Artikeln zum ‚Tagelöhnermarkt‘ ist diese Doppel-Figur fast ausschließlich in Bezug auf Arbeit und Ausbeutungsstrukturen zu finden: Arbeiter werden als Opfer
dargestellt und die Arbeitgeber als „betrügerische Subunternehmer“
(Bacher, 2010) und „Hintermänner“ (Risel, 2013c) kriminalisiert. Die Bezeichnung ‚Subunternehmer‘ – eine übliche und ganz legale Funktion
in heutigen Marktabläufen – scheint mir dabei oft als das ökonomische
Synonym für ‚Schlepper‘ und ‚Schleuser‘ eingesetzt zu werden.
In den meisten, vor allem den früheren Artikeln, wird die Migration
und Präsenz der ‚Tagelöhner‘ zwar als schweres Schicksal oder uninformierte Entscheidung, aber – im Gegensatz zu den Arbeitsbedingungen – nicht als kriminell dargestellt.65 Die SZ berichtet am 24.08.10
noch davon, dass Hristo Vankov sich die Benzinkosten der Fahrt mit
dem Minibus von Pazarjik nach München mit den anderen geteilt habe
(vgl. Bacher, 2010). Diese Darstellung ändert sich mit dem Erstarken des
bundesweiten Diskurses zur Armutszuwanderung. Auf einmal treten
für die Diskursformationen zu ‚Menschenhandel‘ und ‚illegaler Migration‘ typische Muster in den Diskurs zum Münchner ‚Arbeiterstrich‘
ein. Zum Beispiel stellt der SZ-Artikel Endstation „Arbeitsstrich“ die
folgende paradoxe Behauptung in Bezug auf die Freizügigkeit der EUMigrant*innen auf:
„Niemand kann deren Bürgern [Bürgern der neuen Beitrittsstaaten,
Anmerkung der Autorin] deshalb verwehren, in der Hoffnung auf Arbeit nach Deutschland einzureisen. Und dies tun immer mehr, oft für
viel Geld von kriminellen Schlepper-Banden gelotst.“ (Öchsner, 2013)
Die Petition der Geschäftsleute kriminalisiert sowohl Arbeitgeber*innen
als auch Reisehelfer*innen. Die Unterzeichnenden drücken ihr Anliegen aus, „dass Menschen nicht von kriminellen Schleppern und
65
Dies erscheint absurd angesichts der Tatsache, dass so gut wie täglich
private Minibusse und Reisebusse zwischen Bulgarien und München pendeln
– ohne größere Herausforderungen wie zum Beispiel illegale Grenzübertritte.
Eine Strecke kostet etwa 80 Euro pro Person bei weniger als 24 Stunden Fahrzeit.
137
�Bauunternehmern ausgenutzt und missbraucht werden“. Der CSULandtagsabgeordnete Georg Eisenreich macht dies in der tz noch einmal deutlicher: „Es geht nicht nur um die armen Leute, die da stehen,
sondern um die Hintermänner, die sie ausbeuten und Riesenprofite machen“ (Costanzo, 2013b). Auch ein CSU-Bundestagsabgeordneter und
ehemaliger Münchner Kreisverwaltunsgreferent ist der Meinung: „Die
armen Menschen, die dort stehen, sind nicht die Ursache des Problems“
(Risel, 2013c). Das sei ein klarer Fall von organisierter Kriminalität: „Wir
müssen unsere Bürger schützen“ (ebd.). So auch der Verfasser der Petition in der Bild dazu: „Das ist eine gut eingespielte Mafia, man müsste die
Hintermänner trocken legen. Diese armen Menschen werden hier her
geschleust“ (Bachner, 2013). Hier wird deutlich, wie die Viktimisierung
mit Kriminalisierung und der Forderung nach mehr Repression Hand
in Hand geht. Aber auch die ‚Schwarzarbeiter‘ werden nicht nur als
Opfer, sondern selbst als Bedrohung imaginiert. „Jetzt steigt die Aggressivität“, so der Geschäftsführer der TheaGe, „[d]ie Männer okkupieren
den öffentlichen Raum“ (Costanzo, 2013a). Durch kriminelles Verhalten
verbreiteten sie unter den Kund*innen Angst und schädigten so das Geschäft.
Zusammengefasst: Der selbstorganisierte Arbeitsmarkt wird in den
oben analysierten Weisen ganz brachial rassifiziert, indem die ‚Tagelöhner‘ viktimisiert, kriminalisiert, maskulinisiert, entmenschlicht,
entindividualisiert, auf ihre Körper reduziert, mit Schmutz, Ungeziefer, Wildheit, Unwissen und Aggressivität in Verbindung gebracht
und der Sauberkeit, Normalität und Zivilisiertheit der good diversityGemeinschaft und ihres öffentlichen Raumes gegenübergestellt werden. Auch die Stimmen, die gegen die gröbsten rassistischen Stereotype Einspruch erheben, sind nicht automatisch antirassistisch – etwa
wenn sie zwischen den nützlichen und nutzlosen Migrant*innen unterscheiden.
In der analysierten Assemblage des Rassismus wird zudem deutlich,
wie sich Rassismen in konkreten Auseinandersetzungen um die Repräsentation des ‚Tagelöhnermarktes‘ immer wieder neu zusammensetzen und mit Sexismus, Chauvinismus und Klassismus verschränken.
Die analysierten Kämpfe um Deutung zeichnen sich durch ihre Flexibilität aus: Je nach Situation können verschiedene rassistische Versatzstücke von Akteuren unterschiedlich bedient werden.
138
�In der Zusammenschau mit den anderen Kapiteln und dem Kampf
um die Hoheit auf der Straße, der hier nur als Kontext diente, wird
schließlich deutlich, dass die Grenzen zwischen ‚Uns‘ und den ‚Anderen‘ mit materiellen Ein- und Ausschlüssen und ungleichen Machtverhältnissen einhergehen und somit hier auch immer Grenzen zwischen
Innen und Außen und zwischen Oben und Unten sind.
Die Behörden lassen uns alleine! Produktive Moralpaniken
Abschließend und als Überleitung zum nächsten Kapitel, möchte ich
noch einmal genauer betrachten, wie die Petition so wirkmächtig werden konnte. Das vierte Kapitel wird nämlich zeigen, dass sich mit der
Petition nicht nur die Deutung der Figur ‚Tagelöhnermarkt/Arbeiterstrich‘ verschiebt, sondern dass sie auch verschärfte Sicherheitspraktiken durch Zoll und Polizei auslöste. Insofern greife ich in diesen abschließenden Überlegungen den ersten Teil dieses Kapitels nochmal auf,
in dem es um die Kämpfe um die Hoheit auf der Straße und nicht ‚nur‘
um die Deutung im medialen Diskurs ging.
Meine These ist, dass die Petition eine Moralpanik66 auslöste, die den
Diskurs affektiv auflud. Die Geschäftsleute stellen sich als moralisch integer dar, indem sie Vielfalt positiv bekräftigen und ihre Toleranz sowie
ihr Mitgefühl mit den ‚Schwarzarbeitern‘ betonen. „Wir sind hier im
Bahnhofsviertel – das war immer wild und bunt und solle es auch bleiben“, so der Geschäftsführer der TheaGe in der SZ, “[a]ber wir haben
auch ein Recht auf ein normales Wohn- und Arbeitsumfeld“ (Siegert,
2013). Und die Bild-Zeitung zitierte ihn folgendermaßen: „Diese armen
Menschen werden hier her geschleust. Für uns sind sie aber ein Problem“ (Bachner, 2013). Während die Unterzeichner*innen sich in der Petition und den begleitenden Artikeln immer wieder gegen Rassismusvor66
Der Begriff der Moralpanik (vgl. Cohen, 1972; Mak, 2005; Tsianos &
Pieper, 2011: 124) ermöglicht es, die Analyse nicht auf den Gegenstand eines
Diskurses, sondern auf die Wissenspraktiken zu richten, die den ‚sozialen Frieden‘ von einer übertrieben dargestellten Gefahr bedroht sehen und in emotional aufgeladener Weise eine Reaktion von Seiten des Staates oder anderer
Akteure einfordern (zur soziologischen Debatte um das Konzept der „moral
panic“ siehe David et al., 2011; Garland, 2008).
139
�würfe immunisierten, bestanden sie aber gleichzeitig auch darauf, dass
der pro-migrantische Staat nicht genug durchgreife, zu tolerant sei, die
Interessen der redlichen Bürger*innen nicht ernst genug nehme, und die
‚Schwarzarbeiter‘ in die Übermacht kämen: „Sie übernehmen langsam
das Viertel“, so der Autor der Petition, „[u]nd die Behörden lassen uns
alleine“ (Bachner, 2013).
Dieses paradoxe Narrativ folgt der Multikulturalismuskritik im Sinne
des ‚racial neoliberalism‘, den Alana Lentin folgendermaßen charakterisiert:
„The portrayal of a permissive multiculturalism as responsible for the
toleration of illiberal minorities unable or unwilling to integrate into
their ‚host‘ societies [...] is discursively accompanied by a proclamation
of anti-racist credentials that seeks to create distance between what is
presented as a rational liberal critique of the excesses of multiculturalism and the crude intolerance of the far right.“ (Lentin, 2011)
Tsianos und Pieper (2011) beschreiben, wie Moralpaniken entstehen,
wenn Gefahr für den ‚sozialen Frieden‘, für die positive Vielfalt und
den Konsum ausgerufen wird und die „Schwelle der Toleranz“ erreicht
sei (vgl. ebd.: 124). Liberale Eliten sehen ihre Lebensräume und Werte
in Gefahr und fordern Maßnahmen. Als Beispiel nennen Tsianos und
Pieper den „Ghettodiskurs“, mit der „zentrale[n] Metaphorik des explosiven Raums […], in dem sich ein ‚Sprengstoff‘ ansammelt, der sich irgendwann entlädt“ (ebd.: 125). Auch wenn der Ghettodiskurs im Kampf
um die Deutung des ‚Tagelöhnermarktes‘ nicht direkt bedient wird, ist
er intertextuell impliziert, etwa wenn lokale Geschäftsleute den ‚sozialen Frieden‘ in Gefahr sehen und warnen: „Sie sagen: das ist unser Revier! Aber auch wir Anwohner haben ein Recht auf unsere Kreuzung!“
(Siegert, 2013). Die Warnung vor sozialen Spaltungen wird mit der Annahme der Unvereinbarkeit von Werten verknüpft und führt zu affektiven Paniken.
„Es ist also nicht erstaunlich, worin die Effektivität solcher ‚moralischer Paniken‘ besteht: in der affektbeladenen Intensität der Selbstaktivierung von Eliten zur Durchsetzung eines ‚zivilisatorischen
Auftrags‘ zur Disziplinierung devianter Subjektivitäten.“ (Tsianos &
Pieper, 2011: 124)
140
�Die Gefahrenquellen müssen entweder entfernt, am besten aber zivilisiert werden. Aus Perspektive der Petition muss der Staat seine Schwäche
überwinden, um den sozialen Frieden im öffentlichen Raum zu schützen
und die „Tagelöhner-Mafia“ (Bachner, 2013) in ihre Schranken zu weisen – mit Hilfe von sicherheitsrechtlichen, wie auch sozialen Maßnahmen. So drang der Verfasser der Petition bei Kommunalpolitiker*innen
auch darauf, dass ein Aufenthaltsraum für die ‚Tagelöhner‘ eingerichtet
werde, damit diese nicht mehr auf der Straße stehen müssten. Insofern
hat die Petition und die von ihr ausgelöste Moralpanik paradoxerweise dazu beigetragen, dass das von Arbeiter*innen und der Initiative Zivilcourage schon seit Jahren geforderte Workers’ Center schlussendlich
doch eingerichtet wurde, wenn auch unter anderen Vorzeichen – denen
der Befriedung, des Aufräumens und Unsichtbar-Machens – und ohne
Teilhabemöglichkeiten für die Nutzer*innen. Das Budget des Infozentrums Migration und Arbeit wurde aufgestockt, so dass es in größere
Räumlichkeiten mit Aufenthaltsraum umziehen konnte. Der Vorschlag
zu dieser Erweiterung folgte in der betreffenden Stadtratsvorlage genau
auf den Punkt, der auf die Petition hinwies (Stelle für Interkulturelle
Arbeit, 2014).67
In urbanen Moralpaniken und den sie begleitenden Medienhypes, in
„Felder[n] rassistischer Assemblagen in der postliberalen Stadt“ (Tsianos & Pieper, 2011: 125), wird nicht nur Sinn, sondern es werden vor
allem auch Affekte, Praxen und Sozialtechniken produziert. Sie haben
also ganz konkrete Auswirkungen. Die Einrichtung eines Aufenthaltsraumes war nicht der einzige kommunalpolitische Effekt der Petition
der Geschäftsleute. Im nächsten Kapitel werde ich diskutieren, wie die
umkämpften Problemdefinitionen auch zu repressiven Regierenspraktiken geführt haben.
67
Der Stadtrat knüpfte die umstrittene Verlängerung der Laufzeit des
Infozentrums im Jahr 2015 an die städtische Finanzierung eines privaten Sicherheitsdienstes, der von der Theatergemeinde eingestellt worden war, um am
‚Arbeiterstrich‘ für Sicherheit zu sorgen (vgl. Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft, 2015; Referat für Arbeit und Wirtschaft, 2015).
141
�142
�Markieren, Vertreiben und Aufklären –
Sicherheitspraktiken am selbstorganisierten
Arbeitsmarkt
Im folgenden Kapitel geht es um sicherheitspolitische Versuche, den ‚Tagelöhnermarkt‘ zu regieren. Es ist das letzte Kapitel, in dem es schwerpunktmäßig um die Figur des ‚Tagelöhnermarkts‘ und die Auseinandersetzungen am selbstorganisierten Arbeitsmarkt geht und das erste, in
dem Versuche des Regierens explizit im Fokus stehen. Die Erfahrungen der EU-migrantischen Arbeiter*innen im Münchner Bahnhofsviertel sind stark von Begegnungen mit der Polizei und dem Zoll geprägt.
Gleichzeitig ist das Thema ‚Armutszuwanderung‘ im Allgemeinen und
das Thema „grauer Arbeitsmarkt im Bahnhofsviertel“ (Landeshauptstadt
München, 2014) im Speziellen den obersten Sicherheitshüter*innen der
Stadt München zum Problem geworden. Im Jahr 2013 ist die „Armutszuwanderung aus Südosteuropa“ sogar zum Schwerpunkt des Münchner Sicherheitsberichtes avanciert (ebd.). In diesem Kapitel frage ich am
Beispiel des selbstorganisierten Arbeitsmarktes, welche Rolle Sicherheits- und Ordnungspolitiken in den Versuchen des Regierens der EUinternen Migration in München gespielt haben.
Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind
die Sicherheitsbehörden und allen voran die Polizei zuständig. Was unter ‚Sicherheit‘ verstanden wird, ist nicht festgelegt, sondern unterliegt
jeweils örtlich und historisch spezifischen Aushandlungsprozessen.
Ganz allgemein wird Sicherheit als Abwesenheit von Gefahren, Bedrohungen und Risiken definiert (vgl. Schwell, 2014: 277). Dieser Zustand
ist schwer zu erreichen, deswegen gilt es als Aufgabe gesellschaftlicher
Organisation, Risiken und Gefahren zu minimieren und dabei – so der
Liberalismus – Freiheiten so wenig wie möglich einzuschränken. Hier
liegt aber der springende Punkt: Im Namen der Sicherheit können auch
in modernen Gesellschaften, die sich als liberal verstehen, Freiheiten
eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen durchzusetzen (und
mit Hilfe der gesetzlichen Regelungen einzuschätzen, wann sie legitim
sind), ist Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Was genau diese Aufgabe
beinhaltet, hängt davon ab, was als Bedrohung der Sicherheit wahrgenommen wird – und diese Frage wird sehr unterschiedlich beantwortet.
143
�Unter dem Begriff der securitization, der Versicherheitlichung, werden
Prozesse betrachtet, in denen „aus gesellschaftlich diskutierten Themen
Sicherheitsthemen werden“ (Schwell, 2014: 276).68 Bestes Beispiel hierfür ist vielleicht die Versicherheitlichung der Migrations- und Datenschutzpolitik im Zuge des war against terror nach 9/11, der Datenschutz
einschränkte und Migrationskontrollen verschärfte. In Bezug auf Sicherheit stellt sich auch immer die Frage: Wessen Sicherheit? Wer muss
vor wem oder was geschützt werden und auf welche Art und Weise?
All diese Fragen stellen sich auch, wenn der selbstorganisierte Arbeitsmarkt und die sogenannte ‚Armutszuwanderung‘ zum sicherheitspolitischen Thema und zum Objekt von Polizeimaßnahmen werden. In diesem Kapitel nähere ich mich mit dem Methodenset der ethnografischen
Regimeanalyse, mit Konflikt als Methode und aus einer Perspektive der
Kämpfe also den Fragen an, wie sich sicherheitspolitische Akteure in
München in Bezug auf den selbstorganisierten Arbeitsmarkt verhalten,
Teil welcher Aushandlungen ihre Praktiken und Rationalitäten sind und
welche Effekte sie haben. Es geht also um Versuche des Regierens im
Feld der Sicherheit. In den Worten der Anthropology of Policy von Shore
68
Die Anthropology of Security ist erst am entstehen (vgl. Adam & Vonderau, 2014; Maguire, Frois & Zurawski, 2014). Es gebe noch keinen kulturanthropologischen theoretischen Ansatz zum Thema ‚Sicherheit‘, so schrieb die
Kulturanthropologin Alexandra Schwell im Jahr 2014, auch wenn es in vielen
fachspezifischen Arbeiten eine Rolle spiele (vgl. Schwell, 2014). Insbesondere
die Rolle, die Praktiken der Polizei und anderer sicherheitspolitischer Akteure
im Regieren der modernen, spätkapitalistischen Gesellschaften spielen, ist bis
jetzt unterbeleuchtet geblieben, auch wenn es in den Border Studies und auch in
der Stadtforschung Ausnahmen gibt. Anthropolog*innen untersuchen so schon
länger die Versicherheitlichung, Humanitarisierung und Technologisierung
der Grenzen (vgl. Hess & Kasparek, 2010; Hess & Tsianos, 2004; Kasparek, 2016;
Walters, 2002, 2011) und auch zur Sicherheits- bzw. Ordnungspolitik in urbanen Räumen gibt es einige Forschungen, wie etwa Didier Fassins (2012) Untersuchung von Polizeieinsätzen in den Pariser Banlieus, Loïc Wacquants (2011,
2012) Studien des Regierens urbaner Armut in USA oder auch Lee Hielschers
(2013) Bachelorarbeit zur Kiezpolitik gegenüber Romni*ja in Berlin. Die mit
der Disziplin der International Relations verbundenen kritischen Security Studies dagegen blieben oft sehr abstrakt und in den Gefilden der internationalen
Politik verhaftet, wie das C.A.S.E. Collective (2006) und der Kulturanthropologe
William Walters kritisch herausarbeiten. Sie könnten, wie auch Didier Bigo
(o.J.) feststellt, durchaus von anthropologischen Herangehensweisen profitieren.
144
�und Wright (2011) formuliert: Welche „webs of meaning“ (ebd.: 1), „sets
of relation“ (ebd.) und „social and semantic spaces“ werden in Bezug
auf die „Sicherheit“ am selbstorganisierten Arbeitsmarkt geschaffen und
umkämpft, wie und von wem? Ein herausstechendes Ereignis stellte die
im Folgenden beschriebene Zollrazzia dar.
Grüne Bänder: Zollkontrolle als Effekt der Moralpanik
Am Morgen des 21.10.2013 fand an der Kreuzung Goethe-/Landwehrstraße eine gemeinsame Maßnahme der Finanzkontrolle Schwarzarbeit
(FKS) und der Polizeiinspektion 14 statt. Etwa 20 der Tagelöhnerei verdächtigte Personen wurden in einen Hinterhof gebracht. Es handelte
sich um diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung aufgehalten hatten und auf Grundlage ihres äußeren Erscheinungsbilds
und Verhaltens der Gruppe der potenziellen ‚Schwarzarbeiter‘ zugeordnet wurden. Die Beamten vermerkten ihre Namen und weitere Informationen auf Listen. Sie hätten kein Recht, zu arbeiten, wurde erklärt,
bei ‚Schwarzarbeit‘ drohe ihnen Strafen. Sie sollten Papiere unterschreiben, die einige nicht verstanden. Dann wurden den Kontrollierten neongrüne Silikonarmbänder umgelegt und sie wurden freigelassen. So
berichteten die etwa zehn Personen, die am nächsten Tag schon vor
der Tür des temporären Workers’ Centers warteten, als ein Mitglied der
Initiative Zivilcourage und ich von unseren Fahrrädern stiegen, um den
Raum für diesen Tag zu öffnen. Sie zeigten aufgebracht ihre mit den
Armbändern markierten Handgelenke, berichteten erzürnt von der
Razzia und forderten uns auf, bei der Zollpolizei anzurufen und eine
Erklärung zu verlangen. Vor allem sollten wir fragen, ob sie die Armbänder wieder abnehmen dürften, oder weiter tragen müssten. Vollkommen verblüfft schaute ich auf ihre Handgelenke mit den Bändern,
die mir sonst als Eintrittskarten zu Musikfestivals bekannt waren, hier
aber soziale Stigmatisierung versinnbildlichten und körperlich erfahrbar machten. Mit Jackenärmeln war das neongrüne Zeichen notdürftig
zu verdecken, blitzte aber doch immer wieder auf. Wir versprachen, den
Zoll anzurufen und rieten nach kurzem Zögern dazu, die Armbänder
sofort abzulegen. Wenn das Probleme gäbe, dann würden wir uns gemeinsam dagegen wehren. Die Geste des Abreißens kam einer Geste der
145
�Befreiung gleich. Über 24 Stunden hatten sie die Armbänder getragen.
Einige von der Markierung Eingeschüchterte hätten München schon
verlassen, erzählten sie. In unseren Räumen angekommen, untersuchten
wir die Bänder genau, denn die Vermutung herrschte, dass sich in ihnen
elektronische Chips verbergen könnten, die den physischen Aufenthalt
nachvollziehbar machten, wie bei einer elektronischen Fußfessel. Auch
als wir keine solchen Chips fanden, war der Verdacht noch nicht aus
der Welt geschafft. Der zuständige Zollbeamte war telefonisch nicht zu
erreichen.69
Wir diskutierten das Geschehene und beschlossen, in einer Pressemitteilung die Razzia und Markierung zu skandalisieren und eine Entschuldigung des Zolls zu fordern. Die Pressemitteilung formulierte einen
Rassismusvorwurf im Menschenrechts-Duktus:
„Mit dem Kennzeichnen von Personen durch grüne Bändchen verfolgt
die Behörde eine rassistische Praxis, die die Persönlichkeitsrechte und
die Menschenwürde verletzt. Die Initiative Zivilcourage zeigt sich zutiefst bestürzt über das behördliche Vorgehen, das auf rassistischen
Stereotypen (z.B. des ‚osteuropäischen Schwarzarbeiters‘) fußt.“ (Initiative Zivilcourage, 2013)
Die Erklärung stieß auf einigen Widerhall in der kommunalen und
auch bayerischen Politik. Die Verantwortlichen des Zolls wurden zu
einer Sitzung des Münchner Ausländerbeirats und dem ‚Austausch
Bahnhofsviertel‘ (einem regelmäßigen Treffen von städtischen und
sozialen Akteuren, die mit dem ‚Tagelöhnermarkt‘ zu tun hatten) eingeladen und die Grünen im Bayerischen Landtag stellten eine Anfrage. Auf deren Beantwortung durch das Bayerische Innenministerium
werde ich in Kürze zurückkommen. Ich möchte hier aber weniger auf
den Protest und seine Effekte70 im parlamentarischen, institutionalisierten politischen Raum sowie auf der Straße eingehen, sondern viel
eher einige Schritte zurück gehen, um das Ereignis der Kontrolle und
69
Für einen kritischen Kommentar zu den grünen Armbändern in Zusammenhang mit der sozioökonomischen Situation und Entrechtung der EUmigrantischen Arbeiter*innen (siehe Apostolova, 2013).
70
Der Zoll musste sich rechtfertigen und es ist – unseres Wissens nach
– zu keinen weiteren derartigen Kontrollen mehr gekommen. Außerdem wurde
auf diskursiver Ebene einer Kriminalisierung entgegen gewirkt.
146
�den Prozess, der zur Kontrolle und ihren Effekten führte, verstehen zu
können.
Grüne Bänder als Zwang und Markierung
Die Beamt*innen konnten als Vertreter*innen des Staates definieren,
wer verdächtigt ist und wer nicht. Einmal als verdächtig ausgemacht
und somit von den unverdächtigen Passant*innen unterschieden, mussten die Kontrollierten den Anweisungen der Beamt*innen Folge leisten:
vor Ort bleiben, Auskunft geben und ihre Arme reichen, um sich die
Bänder umlegen zu lassen. Das ungefragte Umlegen der Bändchen setzte ebenso wie die gezwungene Kontrolle selbst ungleiche Machtverhältnisse und Blickregime in die Tat um. Natürlich hätten die Kontrollierten
auch Widerstand leisten können – etwa wegrennen, stehenbleiben oder
sich körperlich wehren. Die Polizist*innen hätten dann aber körperliche
Gewalt ausüben und sie gegebenenfalls strafrechtlich verfolgen dürfen.
Die Wirkung der Bänder ging über den Moment der Kontrolle hinaus:
Einige der Markierten nahmen die Bänder aus Furcht vor Konsequenzen
über 24 Stunden lang nicht ab. Sie fühlten sich gedemütigt und vor den
anderen Menschen im Viertel abgesondert und als Verbrecher markiert.
Sie befürchteten weitere Repression und die Verfolgung durch Chips am
Handgelenk. Es gab keinen Chip, der die Markierten verfolgbar gemacht
hätte, und doch fühlten sie sich verfolgt; er entfaltete seine einschüchternde Wirkung. Rassismus und Ausgrenzung wurden mit dem grünen
Band körperlich erfahrbar und öffentlich sichtbar. Für die Markierten
der Grünen-Band-Maßnahme, mit denen ich sprach, spielte es, meinte
ich zu verstehen, gar keine zentrale Rolle, als was genau sie markiert
worden waren – ob als ‚Schwarzarbeiter‘, ‚Kriminelle‘ oder als ‚Bulgaren‘. Die Ausübung von Zwang, die körperliche Erfahrbarkeit des Bandes und die öffentliche Sichtbarkeit der Markierung prägte sich ihnen
ein. Gerade die gewisse Offenheit, Ambivalenz und Beweglichkeit des
rassistischen Symbols ‚grünes Band‘ machte dieses so wirkmächtig und
körperlich erfahrbar. Indem die Razzia rassistische soziale und symbolische (Raum-)Ordnungen auf drastische Weise (re)produzierte, blieb
sie als ‚Ereignis‘ in den Aushandlungen um den (und am) selbstorganisierten Arbeitsmarkt in die kollektive Erinnerung eingebrannt: Noch
zwei Jahre später erzählten EU-migrantische Arbeiter*innen empört
von ‚Chips‘ in den Armbändern, mit denen sie markiert und verfolgt
147
�worden wären. Konkret kam es weder zu Verhaftungen noch zu Weiterverfolgungen der Kontrollierten, denen keine Straftaten nachgewiesen
werden konnten. Am nächsten Tag trafen sich die Arbeitssuchenden
wieder am selben Ort.
Aufklären, Vertreiben oder Eindämmen?
Wie kam es aber zu der Zollkontrolle und der Markierung mit den grünen Bändern? Welche Problemwahrnehmungen und Motive standen
hinter der Kontrollaktion? In den von der Pressemitteilung der Initiative Zivilcourage losgetretenen Auseinandersetzungen um die Zollrazzia
haben sich verschiedene Narrative abgezeichnet, die erklärten, wie es
zu der Maßnahme gekommen und was ihr Ziel gewesen sei. Das Bayerische Innenministerium stellte die Kontrolle in seiner Antwort auf die
Anfrage von Grünen Landtagsabgeordneten folgendermaßen dar (wobei es sich direkt mit der Darstellung in der Pressemitteilung der Initiative Zivilcourage, wie Personen in einen Hinterhof gedrängt worden
wären, auseinandersetzt):
„Die Kontrolleinheit Prävention (KEP) des Hauptzollamts (HZA) München hat am 21. Oktober 2013 gemeinsam mit der Polizeiinspektion
14 des Polizeipräsidiums München 20 bulgarische sowie einen griechischen Staatsangehörigen kontrolliert. Die Kontrollen fanden im Vorhof
einer von den ausländischen Staatsangehörigen genutzten Moschee
statt; die Personen wurden nicht in einen Hinterhof am Hauptbahnhof gedrängt.“ (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und
Verkehr, 2013)
Des weiteren berichtete das bayerische Innenministerium in dem vom
Bayerischen Innenminister unterzeichneten Schreiben von einem Runden Tisch, bei dem gemeinsame Kontrollaktionen des Zolls und der Polizei vereinbart wurden:
„Im August dieses Jahres wurde auf Initiative des MdB Dr. Uhl in München ein Runder Tisch in dieser Angelegenheit einberufen. [...] Dabei
wurden unter anderem gemeinsame Kontrollaktionen des Zolls und
der Polizei vereinbart.“ (ebd.)
148
�Dieser Runde Tisch hatte stattgefunden, nachdem zwei Tage zuvor die
Petition von lokalen Geschäftsleuten „koordinierte, konsequente und
nachhaltige Gegenmaßnahmen sowohl im Bereich der Sozial- wie auch
Polizeiarbeit“ gefordert hatte, so „dass unsere Kreuzung nicht von einer
solchen Szenerie immer mehr in Beschlag genommen wird“ (Petition der
Anwohner und Arbeitnehmer an der Kreuzung Goethestraße / Landwehrstraße). Gastgeber war der oben genannte CSU-Hardliner, Mitglied
des Bundestages und ehemaliger Referent des Kreisverwaltunsgreferates in München sowie der Geschäftsführer der Theatergemeinde (in
deren Räumen das Treffen stattfand). Das Innenministerium erklärte,
dass „neben Vertretern der Bundesfinanzdirektion, des Hauptzollamtes
München, der Landeshauptstadt München (Kreisverwaltungsreferat
und Sozialreferat) auch Vertreter der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 14“ (Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 2013) teilgenommen hatten. Betroffene, Sozialarbeiter*innen sowie
Journalist*innen wurden dagegen ausgeschlossen, wie Mitglieder der
Initiative Zivilcourage, die vor Ort gewesen waren, berichteten. Nach
dem Treffen stellte der Gastgeber in der SZ vom 30. August 2013 klar,
welche Aufgaben Zoll und Polizei seiner Meinung nach hätten: „Durch
schärfere Kontrollen sollen die bulgarischen Tagelöhner von der Kreuzung vertrieben werden” (Risel, 2013). Direkt im Anschluss an Petition,
Medienhype und Rundem Tisch titelte die tz: Zoll verschärft seine Kontrollen (Costanzo, 2013b).
Im dem Schreiben des Innenministeriums wird das Problem dann auch
ganz im Sinne der Verfasser der Petition beschrieben:
„Nach Mitteilung des Polizeipräsidiums München hat sich im Laufe
der letzten Jahre an der Ecke Landwehrstraße und Goethestraße ein
Treffpunkt für arbeitssuchende ausländische Personen gebildet. [...]
Von Passanten und Geschäftskunden wird diese ‚Ansammlung‘ auf
dem Gehweg, aber auch vor Haus- und Geschäftseingängen und die
damit verbundenen Begleiterscheinungen (z. B. Müllablagerungen),
zunehmend als störend empfunden. Es kam in der Vergangenheit immer wieder zu Beschwerden von Anliegern, die die Nutzung des Gehweges in der dargelegten Art und Weise beanstandeten.“ (Bayerisches
Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 2013)
149
�Es lässt sich festhalten, dass die Razzia eine direkte Konsequenz der Petition und der mit ihr verbundenen Moralpanik darstellte, dass die Problemdefinition der zuständigen Behörde der in der Petition festgehaltenen
Perspektive empathisch folgte und dass die Maßnahme die ‚Tagelöhner‘
vertreiben sollte. Die diskursive Intervention der Geschäftsleute hat
also – auch mit Hilfe konservativer Politiker – zu Polizeimaßnahmen
geführt, die soziale und symbolische Ordnungsvorstellungen, wie sie
in der Petition artikuliert worden waren, konkret umsetzten. In der SZ
vom 30. Oktober 2013 berichtete ein Zollbeamter, dass aufgrund der
Zollkontrollen der letzten Wochen von anfangs ca. 150 nur noch rund 30
bulgarische Arbeiter*innen im Bahnhofsviertel übrig seien. Gleichzeitig bezweifelten Vertreter der Polizei und des Zolls aber auch, dass die
Arbeitssuchenden erfolgreich vertrieben werden könnten und sprachen
stattdessen lieber von ‚Eindämmung‘: „Wir sind präsent, versuchen es
einzudämmen“ (Bachner, 2013), so ein weiterer Zollbeamter am 28. August 2013 in der Bild, „mehr Kontrollen würden das Problem [aber] nicht
lösen: die Szene würde nur weiterziehen“ (ebd.). Die Handlungsfähigkeit der Ordnungsbehörden würde durch die rechtliche Regelung der
Freizügigkeit eingeschränkt. „[D]as Herumstehen reiche nicht, um sie
dingfest zu machen. […] Jeder EU-Bürger kann sich bewegen, wie er
möchte“ (Costanzo, 2013a). Zudem war auch umkämpft, ob der ‚Tagelöhnermarkt‘ überhaupt ein Sicherheitsproblem darstelle. „Das ist ein
soziales Problem“, antwortete der Münchner Polizeipräsident auf Beschwerden von ‚Geschäftsleuten‘ über den ‚Arbeiterstrich‘ und ‚aggressive Bettler‘ während eines Rundgangs durch das Bahnhofsviertel: „Das
kann die Polizei nicht lösen“ („Andrä erklärt seine Ziele“, 2013; vgl. auch
Fuchs, 2013). Er wolle sich stattdessen um die „zunehmende Einbruchskriminalität sowie die Manipulationen an Geldautomaten kümmern“
(„Andrä erklärt seine Ziele“, 2013).
Neben der Polizei war auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit als Unterabteilung des Zolls, die den Kampf gegen undokumentierte Arbeit
zur Aufgabe hat, an der Kontrolle beteiligt. Nach dem bayerischen Innenministerium sei der Zoll hier tätig geworden, weil
„[a]ufgrund der bisherigen polizeilichen Feststellungen und den gewonnenen Erkenntnissen aus früheren Kontrollen im Bereich (Goethestraße/Landwehrstraße) [...] bekannt [war], dass sich an diesem Ort
regelmäßig Personen treffen, die für eine Beschäftigung angeworben
150
�werden, ohne im Besitz der dafür notwendigen Erlaubnis zu sein.“
(Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, 2013)
Die strategischen Ziele der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unterlägen
aber eigentlich eher einem fiskalischen Kosten-Nutzen-Kalkül als der
Verfolgung von Kriminalität zum Zwecke der Sicherheit, so hatte mir
jedenfalls ein leitender Beamter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im
November 2010 in einem Interview erklärt. Das Hauptinteresse des
Zolls läge in seiner Funktion als „Einnahmequelle des Bundes“, also
in der Sicherstellung von Steuereinnahmen. Diese Aufgabe erfülle er
sowohl durch die Prävention der Hinterziehung von Sozialabgaben als
durch die direkte Verfolgung von Verstößen. „Wir sind natürlich auch
als Staat gefordert, grundsätzlich mal vorrangig die Verfahren durchzuführen, wo der Schaden am größten ist, denn die kosten auch Geld,“ so
erklärte er. Die ‚Tagelöhner*innen‘ interessierten den Zoll kaum, denn
„[w]enn der jetzt einmal in der Woche irgendwo jobt, dann ist natürlich der Schaden am Sozialsystem auch nicht so groß“. Schließlich lasse
sich „[d]as große Geschäft […] nur organisiert machen. Weil wenn sie
ein Hundert-Meter-Hochhaus bauen, dann hilft es nichts, wenn sie sich
da und da mal einen holen“. Obwohl sie wüssten „dass es diese Lokale
und Locations gibt, wo man so Tagelöhner bekommt […], rund um den
Bahnhof gibt es ein paar so Szenen“, hätte der Zoll wenig Erfahrung
mit ‚Tagelöhner*innen‘, so erklärte der Zöllner knapp drei Jahre vor der
Razzia. Vorrangiges Ziel der Kontrolle und Markierung mit den Grünen Bändern sei es – nach Aussage von Vertretern des Zolls – aber
weder gewesen, Steuern einzutreiben, noch Kriminalität zu bekämpfen;
die Maßnahme sollte die Ausgebeuteten vielmehr schützen und ihnen
helfen. Als wir den Verantwortlichen der Zollkontrolle schließlich telefonisch erreichten, erklärte dieser, die Aktion hätte dem Schutz der Arbeitssuchenden vor Ausbeutung gedient. Er lud uns zu einem Gespräch
mit seiner Behörde ein, denn letztendlich wollten wir doch dasselbe,
nämlich gegen betrügerische Arbeitsverhältnisse71 vorgehen. Der Zoll
wolle „den Arbeitern nichts Böses“ (Kastner, 2013), sondern verhindern,
71
Wir beschlossen die Einladung des Zolls zu einem Gespräch abzulehnen und forderten stattdessen eine Entschuldigung, da wir keine gemeinsame Gesprächsgrundlage sähen. Siehe unsere Darstellung des Gesprächs und
Stellungnahme (Initiative Zivilcourage & Arbeitssuchende bzw. Arbeitnehmer/
innen im Bahnhofsviertel, 2013).
151
�dass „sie von ihrem geringen Lohn auch noch Bußgeld zahlen müssten“
(ebd.), so wird er in der SZ zitiert. Auch dem Bayerischen Innenminister
zufolge war der Schutz der Kontrollierten das Ziel der Kontrolle:
„Den Betroffenen konnten keine rechtlichen Verstöße nachgewiesen
werden. Ziel der Personenüberprüfung war allerdings auch nicht, den
Anwesenden rechtliche Verstöße nachzuweisen, sondern diese im Rahmen einer präventiven Maßnahme durch die KEP über die rechtliche
Situation aufzuklären und diese vor eventueller Ausbeutung durch
mögliche Arbeitgeber zu schützen.“ (Bayerisches Staatsministerium
des Innern, für Bau und Verkehr, 2013)
Auf die Frage nach der Markierung mit den grünen Bändern erklärte
der leitende Zollvertreter, dass die Armbänder eine übliche Maßnahme
bei Kontrollen größerer Gruppen etwa auf großen Baustellen oder auch
bei ‚Wiesnwirten‘72 seien. Sie sollten lediglich kenntlich machen, wer
bereits kontrolliert worden sei, um eine wiederholte Kontrolle der Betroffenen zu verhindern. Nach der Maßnahme hätten die Markierten die
Bänder selbstverständlich sofort wieder ablegen dürfen, wie auch das
Innenministerium erklärte:
„Diese Maßnahme wird bei Prüfungsmaßnahmen der FKS bundesweit
praktiziert. Hierdurch soll insbesondere verhindert werden, dass Personen mehrfach befragt werden. Die Armbänder können abgelegt werden, sobald die Prüfungsmaßnahme abgeschlossen ist und der Kontrollraum verlassen wird.“ (ebd.)
Unter dieser Perspektive diente die Razzia dem Schutz der Arbeitssuchenden und die Bänder garantierten dem reibungslosen Ablauf der
aufklärenden Maßnahme.
Bis hierhin hat sich also eine verwirrende Bandbreite an Motiven hinter der Razzia gezeigt. Die Frage drängt sich direkt auf: Was steckte
wirklich hinter der Zollrazzia und den grünen Bändern – rassistische
Markierung, Vertreibung oder Aufklärung? An dieser Stelle ist dies natürlich eine rhetorische Frage, erscheint es aus einer Regimeperspektive
doch wenig überraschend, dass sich durch keine der oben genannten Intentionen restlos erklären lässt, wie es zu der rassistischen Markierung
72
152
Wies’nwirte ist der bayerische Begriff für Oktoberfest-Gastronomen.
�durch die grünen Bänder gekommen war. Der Wirkung der Bänder tut
dies keinen Abbruch. Sie ist aber nur durch eine Analyse der komplexen
und widersprüchlichen Zusammenhänge im aktuellen Regime der EUinternen Migration, der turbulenten Aushandlungen und komplexen
Machtverhältnisse und nicht durch funktionalistische Erklärungsversuche nachzuvollziehen. „Rassismus existiert in seinen Effekten und durch
seine Effekte“ (Bojadžijev, 2008: 277) – wie auch Manuela Bojadžijev
zeigt, muss Rassismuskritik über eine Kritik der Intention hinaus gehen, um rassistische Formationen und Dynamiken begreifen zu können.
Sehen wir von der Suche nach der ‚wirklichen‘ Intention ab, wird die
Frage, wie es möglich war, dass das Münchner Regime der EU-internen
Migration sich in Form der Grünen Bänder so artikuliert hat, dass der
Effekt – die Erfahrung der Markierung und Einschüchterung – wie die
Faust auf das Auge zu den Assemblagen des Rassismus passte, die sich
in der Moralpanik rund um die Petition artikuliert hatten, noch virulenter. Bojadžijev nimmt Bezug auf Louis Althusser (1968) und macht den
Begriff der Überdeterminierung – der darauf aufmerksam macht, dass
Effekte sich oft nicht auf eine eindeutige Ursache, sondern auf verschiedene, oft nicht nachvollziehbare Faktoren zurückführen lassen – für
die Beschäftigung mit Rassismus nutzbar. Sie möchte so „den Verlauf
der Geschichte weder objektiv, gelenkt durch ökonomische Prozesse,
noch subjektiv als intentionale Tat eines Individuums oder Kollektivs
[…] konzipieren“ (Bojadžijev, 2008: 272). Eine solche Herangehensweise macht sichtbar, wie die grünen Bänder in die alltäglichen Auseinandersetzungen mit Polizeikontrollen und in die Machtverhältnisse zwischen Geschäftsleuten und dem selbstorganisierten Arbeitsmarkt an
der Kreuzung eingebunden waren. Der Akt des Markierens als ‚SchonKontrolliert‘ war in der Lage, rassistische Repräsentationsregime, soziale Ordnungen und Subjektivierungen zu aktivieren. Die ‚Aufklärungsmaßnahme‘ des Zolls setzte die bestehenden Stereotypisierungen und
Ordnungen aber nicht nur durch, sondern wurde selbst produktiv. Sie
macht darauf aufmerksam, dass die Frage nach den Effekten mit der
Frage nach der Produktivität zu verbinden ist. Auch wenn Sicherheitsapparate (und Macht nach Foucault allgemein) den Eindruck erwecken,
ihr Aufgabe sei eine rein negative – nämlich die notwendige Einschränkung bzw. Repression der Freiheit der Einzelnen zum Schutze der gesellschaftlichen Sicherheit und (rassifizierten) Ordnung – geht ihre Rolle
weit darüber hinaus. Die grünen Bänder machen geradezu parabelhaft
153
�darauf aufmerksam, wie Sicherheitspraktiken soziale Ordnungen und
Machtverhältnisse (re)produzieren, den Subjekten ihren Platz zuweisen,
sowohl in Bezug auf die urbanen Raumordnungen wie auch die Prozesse der Subjektivierung – und dabei nur als Teil von komplexen, kontingenten Aushandlungsräumen bzw. Regimen zu verstehen sind.
Um diese Thesen tiefergehend diskutieren zu können, möchte ich im folgenden die Perspektive ausweiten und nicht nur das Ausnahmeereignis
der Zollrazzia, sondern auch die alltäglichen Polizeipraktiken am selbstorganisierten Arbeitsmarkt mit in das Bild einbeziehen. Dabei gehe ich
sowohl auf die Erfahrungen der Arbeitssuchenden, wie auf die Perspektiven von Streifenpolizisten und der höheren Ränge in den Münchner
Ordnungs- und Sicherheitsbehörden ein.
Alltägliche Begegnungen mit Sicherheitspraktiken
am selbstorganisierten Arbeitsmarkt
Die Akteure des selbstorganisierten Arbeitsmarktes wurden im
Bahnhofsviertel alltäglich kontrolliert, beobachtet, durchsucht und
festgenommen. Ihnen wurden Hausverbote und Platzverweise ausgesprochen. Schon vor seiner öffentlichen Thematisierung (also vor
2010) war der selbstorganisierte Arbeitsmarkt längst Objekt von
Polizeimaßnahmen. Die örtliche Polizei behielt den Treffpunkt im
Auge. Dies konnte ich bereits bei meiner ersten Begegnung mit Arbeitssuchenden während des Infostandes erfahren, wie ich in der
Einleitung schon erwähnt habe. Während der wenigen Stunden wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt. Ich stand gerade mit
drei Männern in ein Gespräch vertieft, da fragte ein Polizist in Zivil:
„Die Ausweise, bitte!“ Mich meinte er damit nicht, wohl aber meine
Gesprächspartner. Erst als ich protestierend frage, wieso er meine
Begleiter denn kontrolliere, und mich nicht, verlangte er auch meinen Ausweis. Ich sagte etwas von Hautfarbe, und wieso gerade diese.
Er verstrickte mich in eine mühselige Diskussion, die ich versuchte
zu beenden, als ich bemerkte, dass er die Ausweise der Leute in der
Hand hielt und das Gespräch sie also aufhielt. Schließlich sagte er
noch: „Frau Riedner, vielleicht haben wir gar nicht so unterschiedliche Ziele wie sie denken“.
154
�Ich war selbst nie Zeugin, aber mehrmals wurde mir erzählt, dass die
Polizeikontrollen mit Leibesvisiten einhergingen, während derer die
Kontrollierten sich auf offener Straße und bei jedem Wetter bis auf die
Unterwäsche ausziehen mussten. Wenn ich in den letzten Jahren Kontrollen beobachtete, ging ich oft hin und fragte die Kontrollierten auf
Türkisch, ob es Probleme gäbe. Sie schüttelten meist den Kopf. Wenn die
Polizist*innen sich entfernt hatten, ließen sie manchmal einige Schimpfworte fallen. Ein junger Mann erzählte mir nach einer Kontrolle, dass er
bei Kontrollen immer vorgebe, kein Deutsch zu sprechen, damit er sich
nicht auf eine Befragung einlassen müsse. Für viele Arbeitssuchende
stellen die Personenkontrollen ein Ärgernis dar, welches sie über sich
ergehen lassen müssen, das ihre Strategien aber nicht weiter beeinflusst.
Trotzdem waren die Polizeikontrollen regelmäßig Gegenstand von Beschwerden, Wut und auch Scham. Sie fühlten sich öffentlich beschämt,
so erklärten Betroffene der Kontrollen bei verschiedenen Gelegenheiten, denn Beobachter*innen der Kontrollen und Durchsuchungen würden denken, sie seien Kriminelle. Dabei hielten sie sich doch nur auf
dem Gehweg auf, um auf Arbeit zu warten.
Die regelmäßigen Kontrollen schränken die Arbeiter*innen nicht nur in
ihrer Freiheit ein, sondern sie sind an der Produktion rassifizierter und
sozial ungleicher urbaner Raumaufteilungen, normativer Ordnungen
und Subjektivierungen beteiligt, wie auch in Bezug auf die Zollkontrolle
deutlich geworden ist. In seiner einflussreichen ethnografischen Studie
Enforcing Order: An Ethnography of Urban Policing setzt sich Didier Fassin (2013) mit den Effekten von Polizeikontrollen von Jugendlichen in
Pariser banlieus auseinander. Er erklärt die regelmäßigen Befragungen,
Kontrollen und Durchsuchungen durch die Polizei als subjektivierende Anrufung (auf Englisch „interpellation“) der Kontrollierten im Sinne
von Louis Althusser (1977):
„[I]n the figurative, and therefore political, sense, interpellation (ideological hailing) is the action through which they discover that they are
at the mercy of police discretion – since they understand that it is not
enough to be innocent in order not to be deemed guilty – and above all
through which they become aware that what is happening to them is
155
�related not to what they have done, but to what they represent. They
learn who they are to the gaze of others.“ (Fassin, 2013: 7)
Die alltäglichen „stops and frisks“73 tragen so dazu bei, die soziale Ordnung durchzusetzen, und zwar nicht nur äußerlich in Bezug auf urbanen Raum oder das Verhalten zwischen unterschiedlich positionierten
Akteuren, sondern eben auch in Bezug auf die Subjektivierung der Kontrollierten und auch innerhalb ihrer Körper:
„[S]tops and frisks represent a pure power relationship that functions
as a recall to order – not to public order, which is not under threat by
youngsters quietly conversing on a bench or joyfully playing soccer,
but to a social order, which is one of inequality (between the police and
the youth) and injustice (with regard to the law and simply to dignity)
that has to be impressed in the body.“ (ebd.: 92)
Die regelmäßigen Kontrollen, so Fassin, produzieren die Aufteilung zwischen Bürger*innen, deren Sicherheit gewährleistet werden muss und
den verdächtigen Subjekten, die unter Kontrolle zu halten sind, und positionieren sie auf ungleiche Weise im Verhältnis zum Staat. Während
die einen sich schnell über ungerechte Behandlung beschwerten, hätten
die anderen gelernt, dass sie die Maßnahmen über sich ergehen lassen
müssten, wenn sie möglichst ungeschoren davonkommen mochten.
„Not only through their frequency but also by the way they take place,
stops and frisks establish a distinction between citizens and subjects.
Citizens are rarely checked, and when they are it is generally in a polite
manner, but they think they have the right to complain if they believe
it has been done wrong-ly. Subjects are often checked, and when they
are it is often in a supercilious way, but they know they only have the
right to remain silent. Thus it becomes clear how this practice, which
many minimize as harmless, defines the relationship of some categories of the population to the state, and, more broadly, to politics.“ (ebd.)
Im Bahnhofsviertel wurde die Polizei nicht nur auf der Straße, sondern
auch in privaten Räumen wie Cafés und Restaurants tätig und machte
73
Das Englische ‚to frisk‘ ist etwa gleichbedeutend mit dem Deutschen
‚filzen‘.
156
�den Unterschied zwischen den Hausbesitzer*innen, Geschäftsleuten,
Kund*innen und den ‚Anderen‘ deutlich. Mehrmals erfuhr ich von
Hausverboten, die polizeilich durchgesetzt wurden. Einmal war ich dabei: Eines Morgens im Januar 2011 gingen ein Freund und ich, bevor wir
das temporäre Workers’ Center öffnen wollten, zu einem Backshop im
Bahnhofsviertel, um noch schnell Frühstück einzukaufen. Während er
hineinging, wartete ich vor dem Schaufenster und winkte Omar74 und
einem weiteren Bekannten durch die Glasscheibe zu. Bei einigen Personen, die draußen um einen Stehtisch standen, überlegte ich, ob sie
auch Arbeitssuchende am selbstorganisierten Arbeitsmarkt waren und
ob ich sie kannte und grüßen sollte. Auf einmal entdeckte ich zwei Polizisten, die am Eingang standen und mit der Angestellten redeten. Ich
hörte, wie die Angestellte zu den Beamten gesagt hatte: „Ah, da sind Sie
ja, das ging schnell! Hier, die Gruppe, die Bulgaren, sie stehen da seit
Stunden herum und haben nur einen Kaffee getrunken.“ Dann fragten
die Polizisten die Männer an den Stehtischen nach ihren Ausweisen. Ich
erschrak sehr, da Omar drinnen saß und keine Möglichkeit hatte, den
Raum ungesehen zu verlassen. Im Unterschied zu den anderen Arbeitssuchenden war er aserbaidschanischer Bürger, also kein Unionsbürger
und hatte auch keine gültigen Aufenthaltspapiere für Deutschland. Die
im Straßenbild sichtbare und gleichzeitig anonyme Gruppe von EUArbeitsmigrant*innen diente ihm, der auch Türkisch sprach, als sozialer
Anlaufpunkt, zur Arbeitssuche und als Versteck. Er tauchte im Frühjahr
2011 in der Gruppe quasi unter. Durch das Fenster beobachtete ich, wie
er die Polizisten sah, seinen Begleiter anstieß und auf sie deutete. Sonst
blieb er von außen betrachtet ruhig. Gleich darauf betraten die Beamten das Café und verlangten ihre Ausweise. Die anderen Gäste in dem
Stehcafé ließen sie in Ruhe, so wie uns auch. Omar zeigte ihnen etwas,
das im Notizbuch seines Begleiters stand. Dann ging er mit einem Polizisten zum Auto, um ihm weitere Informationen zu geben, stellte sich
wieder zu den anderen und wartete. Ein weiterer Polizeibus mit einigen
Beamt*innen fuhr vor. Ein Beamter blieb bei der Gruppe am Stehtisch
stehen. Ich fragte, was er hier mache. Er müsse gewährleisten, dass die
Kontrollierten anwesend blieben, während die Personalien überprüft
würden. Die Angestellte des Cafés habe sie gerufen, um ihr Hausrecht
durchzusetzen. Sie fühle sich gestört von der Gruppe und spreche ein
74
Ich kenne den Nachnamen der Person, die ich hier Omar nenne, nicht,
deswegen benenne ich sie nur mit Vornamen.
157
�Hausverbot aus für die fünf gerade kontrollierten Menschen. Sie müsse
nach Paragraph xx keinen Grund nennen. Mein Begleiter fing an, etwas von Rassismus zu sagen, aber ich flüsterte: „Uns geht es gerade um
Omar und sonst um gar nichts“. Währenddessen bog Hristo Vankov um
die Ecke, sah die Polizei und kehrte auf dem Absatz um. Ein junger türkischsprachiger Mann mischte sich ein, sagte, er könne übersetzen. Er
fragte auch nach den Gründen für das Hausverbot und zeigte sein Unverständnis und Empfinden von Ungerechtigkeit. Ich hatte immer noch
Herzklopfen wegen Omar. Dann gab ein Polizist alle Ausweise zurück.
Wenn sie hier noch einmal herkämen heute, würden sie verhaftet werden. Als die Beamten außer Hörweite waren, sagten die Männer: Wir
haben nur Kaffee getrunken, sonst nichts. Mein Begleiter sagte: „Das
ist Rassismus!“ Sie stimmten zu. Ich war erleichtert, dass Omar - wie
auch immer - unbeschadet durch die Personenkontrolle gekommen war.
Doch als wir gerade gehen wollten, ging Omar zum Polizeiauto, beugte
sich zum Fahrerfenster hinunter und sprach mit den Beamten. Diese
stiegen wieder aus. Ich ging näher hin, um zu hören, was los war. Sie
fragten, was ich wolle, ich solle gehen. Ich sagte, das sei ein Freund, ich
wolle wissen, ob ich was tun könne. Er zwinkerte mir zu und deutete,
ich solle gehen, mit einer Geste die ich als „ist schon in Ordnung“ interpretierte. Dann stieg er in den Polizeiwagen ein und sie fuhren davon. Der Begleiter von Omar erzählte, dass Omars aserbaidschanischer
Freund letzte Woche schon von der Polizei erwischt worden wäre. Er
habe angerufen von der Unterkunft aus, ihm ginge es gut - mit Essen
und eigenem Bett. Am Morgen, so erzählte der Begleiter, habe Omar
ihn um seine Adresse gefragt, er wolle Asyl beantragen. Mein Begleiter
ging in das Café, um sein dort gekauftes Gebäck aus Protest zurückzugeben. Er kam dort mit einer türkisch-sprechenden Angestellten ins
Gespräch. Die „Bulgaren“ hätten sie mehrfach beleidigt, auch ihre Kollegin. Deswegen hätten sie die Polizei gerufen. Zurück im Workers’ Center bestätigten einige der Betroffenen, dass es einen Streit zwischen den
Angestellten und einem von ihnen gegeben habe. Man könne aber nicht
einer ganzen Gruppe wegen dem Verhalten von Einzelnen ein Hausverbot aussprechen. Wir beschlossen, einen Brief an AMIGRA, die Münchner Antidiskriminierungsstelle, zu schreiben. Die meisten Anwesenden
wollten unterschreiben, nicht nur die eben Kontrollierten. Wir gingen
nochmal zum Café, um von dem Brief zu berichten. Diesmal trafen wir
den Chef dort. Dieser beklagte sich, das Geschäft sei eingebrochen, „die
158
�Bulgaren“ konsumierten nicht genug, ständen aber ständig vor seinem
Café. Auf einmal seien sie alle gekommen. Er habe sich erkundigt: das
Café, das sie vorher besucht hätten, habe für „Bulgaren“ auf einmal einen Euro mehr pro Kaffee verlangt als für andere Kund*innen. Nach
einem längeren Gespräch akzeptierte er, dass das Hausverbot gegenüber der Personen, die seine Mitarbeiterin nicht beleidigt hätten, sozusagen als Gruppenhaftung, nicht in Ordnung gewesen sei. Er sagte, dass
sie wieder kommen könnten, wenn sie auch konsumierten. Einige Tage
später saß ich mit einigen EU-Migrant*innen wieder im Café. Es kam zu
einem Streit zwischen zwei Personen in unserer kleinen Gruppe. Eine
Angestellte kam zu uns rüber, machte eine wischende Handbewegung
und sagte: „Raus! Alle raus!“ Bevor sie wieder die Polizei rufen konnte,
gingen wir.
Diese Auseinandersetzung ist ein weiteres Beispiel nicht nur für rassistische Gruppenzuschreibungen, sondern auch dafür, wie die Polizei im
Interesse der Besitzenden und Geschäftsleute tätig wird und so eine auf
Konsum und den Schutz von Eigentum ausgerichtete und nach Besitz
hierarchisierte Gesellschaftsordnung durchsetzt. Zudem wurde deutlich, wie Personenkontrollen dazu dienen, diejenigen, die sich legal hier
aufhalten können von denen, die keine Papiere haben, oder gegen die ein
Haftbefehl vorliegt, zu trennen, bzw. Gesellschaft zu stratifizieren. Dass
Omar durch die Kontrolle kam, zeigt, dass Personen trotzdem Schliche
finden und den ordnungspolitischen Praktiken nicht hilflos ausgeliefert
sind. Dass er dann doch Asyl beantragte, macht auf die Komplexität der
differenzierten Inklusion bzw. Exklusion aufmerksam. Omar nutzte den
Asylantrag strategisch für die kurzfristige Besserung seiner Lebensbedingungen, während dieser Schritt den Unionsbürger*innen nicht zur
Verfügung stand.
Eine weitere Intervention der Polizei in den Alltag am selbstorganisierten Arbeitsmarkt bestand ganz einfach darin, Präsenz zu zeigen. In regelmäßigen Abständen fahren Polizeiautos langsam an der Kreuzung
vorbei, während die Beamt*innen prüfend ihren Blick über die Menschen auf dem Gehsteig schweifen ließen. Manchmal wurde diese Praxis auch mit einer wischenden Handbewegung aus dem Autofenster
heraus verbunden. Für die Arbeitssuchenden war nicht abzusehen, ob
die Polizei dieses Mal hält, oder nicht. Vorsichtshalber gingen einige,
während andere stehen blieben. Diese Praxis trug dazu bei, dass sich die
Arbeiter*innen beobachtet und markiert fühlten.
159
�Die Präsenz und Kontrollen der Polizei produzierten auch deswegen
Unsicherheit und Angst, weil die Gefahr, verhaftet zu werden, ständig
über den Köpfen der Arbeitssuchenden schwebte. Die meisten hatten
als Unionsbürger*innen zwar kein Problem mit dem Aufenthaltsrecht,
aber trotzdem kam es immer wieder zu unerwarteten Verhaftungen.
Hristo Vankov wurde im Sommer 2010 während einer der Kontrollen
auf der Goethestraße unversehens verhaftet und direkt ins Gefängnis
gebracht. In den Monaten zuvor war er drei Mal beim Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel ohne gültiges Ticket erwischt worden. Die
schriftliche Aufforderung, das „erhöhte Beförderungsentgelt“ zu begleichen, konnte ihm nicht per Post zugesendet werden, da er keine Meldeadresse hatte, weil er obdachlos war. So ging das Verfahren seinen
Weg – von den Münchner Verkehrsbetrieben zum EBE-Inkasso-Unternehmen zur Staatsanwaltschaft. Inzwischen beliefen sich die Schulden
auf etwa 700 Euro, bei einem „Gesamtschaden von Euro 7,50“, wie der
Haftbefehl informierte, den die Staatsanwaltschaft erlassen hatte, da sie
seiner nicht habhaft werden konnten. Der Haftbefehl wurde einige Wochen öffentlich ausgehängt – im Gericht oder im Rathaus - und als niemand reagierte, wurde er rechtskräftig. Hristo Vankov hatte zwischen
dem Zeitpunkt der U-Bahnkontrolle und dem der Verhaftung keinerlei
Information über das Verfahren erhalten.
In den meisten mir bekannten Fällen waren unbeglichene Strafgelder die Gründe für Gefängnisaufenthalte. Meist, weil die Betroffenen
bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ohne gültiges Ticket
erwischt worden waren. Stellte dies für Personen, die eine Wohnanschrift hatten, eine Ausnahme dar, bedeutete die prekarisierte Situation
der Obdachlosigkeit, dass kleine Ordnungswidrigkeiten leicht auf eine
Haftstrafe hinauslaufen konnten. So stieg der Druck, Schulden direkt zu
begleichen oder eben auszureisen.75
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiedenen polizeilichen
Maßnahmen, denen die Akteure des selbstorganisierten Arbeitsmarktes
begegneten, sie zwar nicht - oder nur vorübergehend - vertrieben, aber
durchaus als Einschränkung, erhebliche Stressfaktoren, Beschämung
75
Im Zusammenhang mit der „unerlaubten Nutzung des Gehweges“, für
die Bettler*innen oft Bußgeldbescheide bekommen, bestätigte das Kreisverwaltungsreferat sogar, dass sie gerade aus dem Grund konsequent Bußgelder
verhängten, um Bettler*innen aus München zu vertreiben, denn die Personen
würden lieber Deutschland verlassen als ins Gefängnis zu wandern.
160
�und Ärgernis empfunden wurden. Auch hier gilt es, in Anschluss an
Foucault (1983) mit der Repressionshypothese zu brechen und die Produktivitäten der Sicherheitspolitik zu betrachten. Die Praktiken der Polizei wirkten auf die Subjektivitäten und Körper der (EU-)migrantischen
Arbeiter*innen sowie in den urbanen Räumen und sozialen Ordnungen,
deren Teil sie sind. Sie stellten eine sehr produktive Maschine dar, die
das Objekt ‚Tagelöhnermarkt‘ und ‚Armutsmigration‘ (mit)produziert
und eine ordnungs- und sicherheitspolitische Perspektive auf „die Problematik“ etabliert.
Perspektiven aus den Sicherheitsbehörden
Im folgenden Abschnitt geht es um Perspektiven, Problemdefinitionen
und Praktiken innerhalb des Sicherheitsapparates. Ich beschreibe eine
Filmszene, in der ein Polizeibeamter seine Aufgaben am selbstorganisierten Arbeitsmarkt beschreibt, einen Bußgeldbescheid aufgrund von
„unerlaubter Sondernutzung“ und „Belästigung der Allgemeinheit“ und
den Münchner Sicherheitsbericht aus dem Jahr 2013.
„Wenn der normale Fußgänger auf der Straße
ausweichen muss...“ – Das Problem aus Sicht einer
Polizeistreife
Eine Szene des Dokumentarfilms Öffnungszeiten (Riegler, Remter, Reiprich, Sommerauer & Tetik, 2011), den Studierende des Ethnologischen
Instituts der LMU München in Zusammenarbeit mit der Initiative Zivilcourage und EU-migrantischen Arbeiter*innen in den Jahren 2010 und
2011 gedreht haben, zeigt, wie ein Vertreter der Polizei die Situation an
der Kreuzung Goethe/Landwehrstraße und die Aufgabe der Polizei in
dieser versteht und wie er sie den interessierten Studierenden sowie potenziellen Zuschauer*innen darstellen möchte. Die subjektiven Logiken
eines Polizeibeamten lassen sich natürlich nicht verallgemeinern, geben
aber doch einen Einblick in die Diskurse der Polizei. Die Szene findet
in einem fahrenden Mannschaftswagen der Polizei statt, der langsam
durch die Straßen des Bahnhofsviertels fährt. Die Person mit der Kamera sitzt am Beifahrersitz und filmt den uniformierten Interviewpartner
161
�am Steuer. Immer wieder schwenkt die Kamera zur Rückbank, auf der
zwei weitere Filmemacher*innen sitzen sowie ein weiterer Polizist. Sie
fahren zur Kreuzung Goethe-/Landwehrstraße und überqueren sie im
Schritttempo, während der Fahrer des Wagens erklärt, was durch die
Autofenster zu sehen ist. Im Folgenden gebe ich seine Erklärung erst in
wörtlicher Rede wieder und analysiere sie dann auf ihre Problemdefinition hin:
„Man sieht es jetzt zum Beispiel schon. Hier stehen schon wieder einige
an der Lichtzeichenanlage oder auch hier rechts an der Bank. Massiv, sehen sie! Diese Leute, die also hier jetzt damit leben müssen, die
sind nicht sehr erfreut, weil sie einfach die Problematik nicht erfassen,
dass dieses Stehen auf dem Gehweg selber ja noch keine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellt. Und das muss man immer wieder den
Leuten erklären. Dass von dem her, jeder sich hinstellen kann. Nur
wenn er dann die öffentliche Sicherheit und Ordnung - so sagt man
ja - beeinträchtigt, mit seiner Art oder wenn sie mehrere sind, dann
schreiten wir also ein. Wenn also dann der normale Fußgänger auf der
Straße ausweichen muss, weil hier Menschen in Trauben stehen oder
hier bei den Geschäften da sich die Leute durchzwängen müssen, wenn
es nicht so abläuft, wie es sein soll, dann werden wir tätig natürlich.
[Schnitt] Also es hat sich jetzt gegenüber vorhin, wo wir vorbei gefahren sind, wieder bisschen gelichtet. Sie haben also gesehen, dass die
Polizei wieder unterwegs ist. Und jetzt verteilen sie sich natürlich in die
Landwehrstraße, in die Paul-Heyse oder hier runter oder auch in die
Goethestraße vor. Aber das ist hier jetzt bisschen so ein neuralgischer
Punkt, wo sie so massiv immer sind.“ (Riegler et al.: 2011)76
Wen oder was genau nimmt der Beamte hier als Problem war, als Objekt des polizeilichen Ordnungsauftrags? Zuerst einmal ist festzustellen,
dass er versucht, sich in die Lage, die Perspektive und Emotionen der
„Leute, die also hier jetzt damit leben müssen, zu versetzen, während die
Arbeitssuchenden als ‚Problem‘ und somit Objekt erscheinen. Als Leidtragende, in dessen Interesse er tätig werde, sobald ihre Anliegen fundiert seien, weil es tatsächlich „nicht so abläuft, wie es sein soll“, sieht er
„die Leute, die hier damit leben“ und „sich durchzwängen“ müssen oder
76
habe.
162
Er spricht bayerischen Dialekt, den ich ins Hochdeutsche übertragen
�den „normale[n] Fußgänger“, der „auf der Straße ausweichen muss“. Er
sieht es als Aufgabe der Polizei, gegen Abweichungen von der Norm
„tätig zu werden“. Um das ‚normale‘ Bewegen im öffentlichen Raum zu
gewährleisten, wird die Präsenz von bestimmten Menschen im öffentlichen Raum für problematisch erklärt. Es geht ihm dabei weniger um
einzelne Personen und auch nicht um einen Verdacht auf Straftaten,
also um die Bekämpfung von Kriminalität, sondern vielmehr darum, für
Ordnung und ‚Normalität‘ im städtischen Raum zu sorgen. Seine Erklärung folgt rassistischen Stereotypen und Mustern: Die Beschreibung
„des Problems“ bleibt sehr unkonkret: „Menschen in Trauben“, „dieses
Stehen“ und „neuralgischer Punkt“ sind die einzigen substantivischen
Benennungen. Sonst spricht er von „sie“ oder „es“. Beschreibend kommt
zweimal das Adjektiv „massiv“ hinzu, das im Gegensatz zu „gelichtet“
steht. Auch die Beschreibung des Verhaltens, das zum Einschreiten berechtigt, bleibt recht vage: Wenn jemand „mit seiner Art“ die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtige oder wenn „sie Mehrere
sind“. Hier kommt die Entkonkretisierung und damit einhergehende
Entmenschlichung und Verdinglichung zum Ausdruck, wie sie auch für
rassistische Darstellungen typisch sind und ich sie im Zusammenhang
mit der Medienanalyse im dritten Kapitel thematisiert habe. Ein wiederkehrendes Muster ist auch die Umkehr der Betroffenheit. In Gefahr
und Opfer der Situation sind die „normalen“ Bürger, nicht die Personen,
die sich in prekärer Situation auf dem Gehsteig aufhalten. Zudem fällt
die binäre Gegenüberstellung von „wir/normal“ und „sie/anormal“ auf.
Dabei lässt er die Merkmale, die ihn zu dieser Problemdefinition mitbewegen, unerwähnt, sie schwingen aber im Subtext mit und werden
auch durch Handlungen und Blicke deutlich. Wo genau diese Linie zwischen ‚normal‘ und ‚anormal‘ bzw. zwischen dem, wie es sein soll, und
dem, wie es nicht sein soll, zwischen den Bedrohten und der Bedrohung,
läuft, zeigt das folgende Zitat, in dem er den Unterschied zwischen den
legitimen und illegitimen Personenkreisen (auf dem Gehsteig) noch einmal genauer erklärt und dabei auf die vermuteten Gründe für die Migration und das konfliktive Aufeinandertreffen von Welten, das die Polizei
zu regeln habe, eingeht:
„Die erhoffen sich natürlich jetzt hier, dass, wenn sie nach Deutschland kommen, dass es ihnen besser geht als zu Hause. Es sind ja nicht
alle Bulgaren hier. Sondern auch wieder nur ein ‚bestimmter Teil‘, sag
163
�ich einmal. Andere leben zuhause, sind zufrieden, haben halt Arbeit,
wahrscheinlich. Das ist, denke ich, einfach mal die unterste Schicht,
die auch nichts hat oder hier schnell Geld verdienen will, weiß man ja
nicht. Das sind ja nicht nur die Bulgaren, das sind ja andere Länder
auch, die hier rein drängen und hier versuchen, Fuß zu fassen, schnell
Geld zu verdienen. Aber..., es ist halt irgendwo unbefriedigend auch
für die Leute, die hier leben, oder hier aufwachsen, wenn man dann
sieht, wie sich das entwickelt. Und die Wirtschaftslage ist ja nicht so
rosig, jeder versucht einen Job zu kriegen. Und dann kommen die auch
noch und nehmen die Arbeit weg oder stehlen. Da treffen dann solche
Welten aufeinander und die muss man sich dann halt anhören. Ja,
dafür sind wir ja auch da!“ (ebd.)
Neben der Aufteilung in Deutschland und andere Länder, die im Sinne des methodologischen Nationalismus Gruppen nicht nur Nationen
zuordnet, sondern diese auch miteinander gleichsetzt, teilt der Beamte
in gute und schlechte Bulgaren auf: Die Guten leben zuhause, sind zufrieden, haben Arbeit - die Schlechten haben nichts, wollen schnell Geld
verdienen, drängen rein, versuchen Fuß zu fassen, nehmen die Arbeit
weg und stehlen. Er bezeichnet die Letzteren auch als „bestimmte[n]
Teil“ und fügt mit „sag ich mal“ eine offene, frei interpretierbare Anspielung an, die meiner Interpretation nach in antiziganistischer Weise
auf die Minderheit der Roma abzielt. Auffällig ist auch, wie die Klassenzuschreibung – „die unterste Schicht, die auch nichts hat“ – direkt
übergeht in Kriminalisierung und Rassifizierung. Mit der „unterste[n]
Schicht“ der Bulgar*innen meint er mit großer Sicherheit die Gruppe
der Roma. Zudem unterscheidet er zwischen „den Leuten, die hier leben
oder hier aufwachsen“ - wohl auch die „normalen Fußgänger“ - und den
anderen. Zwischen den so definierten Gruppen zieht er ein Bedrohungsszenario auf, das zum einen dem „clash of civilizations“-Narrativ (vgl.
Huntington, 1996) folgt, zum anderen dem (antiziganistischen) Bild der
Invasion von gefährlichen Parasiten, die „auch noch“ „hier rein drängen“ und die sowieso knappe Arbeit den Inländern wegnehmen und
stehlen (vgl. End, 2014). Wenn er dann erklärt, er müsse sich „die Welten“ (im Plural) anhören, dann scheint klar, welcher Interessensgruppe
sein Ohr und seine Loyalität in erster Linie gehören.
Führt diese Analyse nun zu dem Bild einer rassistischen Polizei, die im
Auftrag von Staat und Geschäftsleuten im Sinne des Klassenkampfs
164
�von oben handelt? Sicherlich ist die Situation nicht so eindimensional.
Auch auf Anregung von Jenny Künkel (2016), die das Polizieren von
Sexarbeit im Frankfurter Bahnhofsviertel erforscht hat, möchte ich das
Bild noch ein wenig weiter verkomplizieren. Nach Künkel geht es der
Polizei beim Polizieren oft darum, ihren Arbeitsaufwand zu minimieren und (deswegen) Frieden zu stiften. Gerade Personen mit „power to
complain“ (ebd.) würden dann von den Beamt*innen als die eigentlichen
Ruhestörer*innen betrachtet, die befriedet werden müssen. Für diese
Analyse spricht beispielsweise, dass der Beamte von der „Problematik“
spricht, dass „die Leute, die damit leben müssen“, nicht verstehen, dass
dem Polizieren gesetzliche Grenzen gesetzt sind und dass er ihnen die
Gesetzeslage erklären muss. Implizit nimmt er also das Recht, auf dem
Gehweg zu stehen, in Schutz, problematisiert Beschwerden, die auf keiner legalen Grundlage basieren und sieht so auch die Konflikte selbst
als Problem. Im Zusammenhang mit fortgeschrittenen Gentrifizierungsprozessen interpretiert Jenny Künkel diese Praktiken auch als „Containment“ (ebd.) und Versuch, zu verhindern, dass die problematisierten
Gruppen sich an Orte verlagern, an denen Personen mit noch größerer
„power to complain“ (ebd.) aktiv werden könnten.
Die Darstellung des Streifenbeamten soll hier zudem nicht als generelle Denkweise der Polizei verallgemeinert werden, sondern als
Schlaglicht dienen, das sich allerdings mit weiteren Aussagen von
Polizeibeamt*innen im Film deckt.77 Im Folgenden möchte ich ein weiteres Schlaglicht auf einen Bußgeldbescheid werfen.
„Passanten wandten sich angewidert ab“ – Problembeschreibung eines Bußgeldbescheids
Einige Male sind Arbeiter*innen mit Bußgeldbescheiden in das Workers’ Center gekommen und haben mich gebeten, diese zu übersetzen,
77
Einige Filmszenen weiter vertreiben Polizist*innen obdachlose EUMigrant*innen, die im Wartesaal des Zentralen Omnibusbahnhofes nachts
schlafen. Eine Polizistin erklärt dabei ihre Vorstellung von ordnungsgemäßem
Verhalten in öffentlichen Gebäuden folgendermaßen: „Es ist einfach so. In jedem öffentlichen Gebäude hat man sich in München und auch in anderen Städten nicht aufzuhalten. Ob das ein Bahnhof ist, eine S-Bahn, eine U-Bahn oder
sonst etwas. Man hat sich daheim aufzuhalten. Man kann draußen ein Bier
trinken und dann geht man heim. Fertig, aus.“ (Riegler et al.: 2011)
165
�Einspruch zu erheben oder eine Ratenzahlung zu beantragen. Einen
Bescheid möchte ich genauer auf seine Problembeschreibung hin analysieren: Im Jahr 2013 kam eine Person in das Workers’ Center, die einen Bescheid (78,50 Euro) aufgrund von „unerlaubter Sondernutzung
[ ], als auch wegen Belästigung der Allgemeinheit“ erhalten hatte. Sie
bat mich, ihr den Brief zu übersetzen und fragte, ob wir Einspruch einlegen könnten - schließlich habe sie nichts getan, außer mit ein paar
Freunden zusammen zu stehen und ein Bier zu trinken. Wenn ein Einspruch nicht mehr möglich sei, wolle sie eine Ratenzahlung beantragen. Das Schreiben gab an, dass die Person sich gemeinsam mit anderen Männern für mindestens 15 Minuten (18.25-18:40 Uhr) in der Nähe
des Bahnhofs aufgehalten hatte. Den folgenden Abschnitt des von zwei
Polizeibeamt*innen unterschriebenen Bescheides möchte ich hier wiedergeben:
„Die Betroffenen saßen auf einer Holzpalette, welche an der Baustellen am Bahnhofsplatz abgestellt worden war beziehungsweise standen
am Bauzaun lehnend daneben und konsumierten Alkohol in Form von
Bier der Marken „Augustiner“, Tegernseer“ [sic] und „Edler-Sud“. Obwohl sich in unmittelbarer Nähe Mülleimer befanden, warfen alle ihre
Zigarettenkippen achtlos auf den Boden. Die konnten die Beamten beobachten. Weiterer Unrat (Kronkorken, Pappbecher, Papierfetzen, leere Flaschen) lag um ihren Standort herum. Passanten und Reisende
wandten sich auf Grund der ungepflegten Erscheinung der Betroffenen
und auch wegen deren Verhalten angewidert und ab [sic] oder machten
einen Bogen um die Gruppe. Die ganze Situation wurde noch mit lautstarken Diskussionen aus der Gruppe heraus verstärkt.“78
Außerdem „hegten die Betroffenen keine Reiseabsichten“ (als Beweis
gaben die Beamt*innen sogar die Anzahl der Trambahnen an, die in der
Überwachungszeit an- und abgefahren waren), sondern „[s]ie treffen
sich lediglich am Bahnhof, um die in umliegenden Geschäften erworbenen Alkoholischen Getränke zu konsumieren [sic].“ Konkret brachten die
Beamt*innen nichts weiter vor, als dass die „Betroffenen“ Zigarettenkippen weggeworfen, Bier getrunken, sich unterhalten und dabei fünfzehn
Minuten auf der Straße aufgehalten hätten. Die Repräsentation und
78
Aus Gründen der Anonymität gebe ich hier keine weiteren Informationen zu dem Schreiben preis.
166
�Deutung dieser Tätigkeiten erinnert an die rassistischen Repräsentationsmuster der Medienartikel, die ich im dritten Kapitel analysiert habe:
Müll, unzivilisiertes Verhalten, unkontrollierter Konsum von Zigaretten
und Alkohol und die Verdrängung der ‚normalen‘ Passant*innen. Dies
reichte, um sie im Namen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einer Personenkontrolle und einem Bußgeld zu unterziehen und von der
‚Allgemeinheit‘ symbolisch auszuschließen:
„Sie [haben] durch Ihre Verhaltensweise eine grob ungehörige Handlung vorgenommen, die geeignet war, die Allgemeinheit zu belästigen
und die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu beeinträchtigen.“
Sind solche Stereotypisierungen und Problematisierungen, wie sie hier
oder in den Aussagen des Streifenpolizisten im vorangegangenen Abschnitt zu Ausdruck kommen, nur individuelle Fehler, die sich auf der
unteren Ebene des Sicherheitsapparats lokalisieren lassen? In welchem
Verhältnis stehen die höheren Ebenen der Sicherheits- und Ordnungsbehörden zu diesen lokalen (Wissens-)Praktiken? Im Folgenden zeige
ich, dass die Aussagen und Praktiken der Polizeibeamten keine individuellen rassistischen Ausrutscher waren. Zwar artikulierten sich die
Rassismen in den oberen Rängen der Sicherheits- und Ordnungsbehörden differenzierter, aber sie hatten doch eine ähnliche Stoßrichtung, wie
im Sicherheitsbericht der Stadt München aus dem Jahr 2013 ersichtlich
wird.
„München wird bunter und lebendiger, aber auch
lauter“ – Armutszuwanderung als Schwerpunkt
städtischer Sicherheitspolitik
„München wird bunter und lebendiger, aber auch lauter. Der öffentliche Raum wird verstärkt genutzt von Personen mit unterschiedlichen
Weltanschauungen, von Personen aus unterschiedlichen Kulturen. Das
macht München attraktiver und dynamischer, führt aber auch immer
wieder zu Nutzungskonflikten.“ (Landeshauptstadt München, 2014: 5)
Im Sinne des postliberalen Rassismus sahen der Münchner Oberbürgermeister und der Kreisverwaltungsreferent in der Einleitung des
167
�Münchner Sicherheitsberichts 2013 die kulturelle Diversität der Stadt
nicht nur als Problem, sondern auch als Bereicherung. Gleichzeitig
machten sie das Problem der „Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum“
aus und führten es auf kulturelle Unterschiede zurück – es sei die „verstärkte“ Nutzung des öffentlichen Raumes durch Personen unterschiedlicher „Weltanschauungen“, die zu Konflikten führe. So problematisierten sie doch wieder die Migration von Menschen ‚anderer Kulturen‘
nach München und bedienten sich dabei einer Reihe rassistischer Diskursfiguren: des „Kampfes der Kulturen“ (Huntington, 1996), der ‚Migrationswellen‘ und eben der Aufteilung zwischen guter und schlechter
Diversität (vgl. Lentin & Titley, 2011). Andere Erklärungsansätze für
Konflikte im öffentlichen Raum wie soziale Ungleichheiten, oder Kriminalität, erwähnen sie nicht. Welche Konflikte im öffentlichen Raum
spricht der Sicherheitsbericht hier aber konkret an? Bei den ersten zwei
Themenschwerpunkten des Berichts handelt es sich um den Hungerstreik von Geflüchteten am Rindermarkt und um „Armutszuwanderung
aus Südosteuropa und Vermeidung von Wohnungslosigkeit“ (Landeshauptstadt München, 2014: 12). Zum einen wurden der Stadt also politische Aktionen von Geflüchteten zum sicherheitspolitischen Problem,
zum anderen (und in beiden Fällen) soziale Benachteiligung und migrantische Armut.
Den zweiten Themenschwerpunkt schlüsselt der Bericht wiederum in
verschiedene Problembereiche auf: Neben der „Unterbringung von Arbeitssuchenden und Obdachlosen“ und insbesondere der Einrichtung
zum Kälteschutz79, geht es um Sichtbarkeit im öffentlichen Raum: „Des
Weiteren wird die Armutszuwanderung im Stadtgebiet, aber auch in
den Bereichen Aufenthalt im öffentlichen Raum, wildes Campieren und
Betteln deutlich sichtbar“. Zwischen Absätzen zu „Wildem Campieren“,
„Betteln“ und „Prostitution“ findet sich dann auch einer zum „grauen
Arbeitsmarkt“:
„Neben den Bettlern im gesamten Stadtgebiet halten sich insbesondere
im Bereich des südlichen Bahnhofsviertels tagsüber auch zunehmend
Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Südosteuropa in Gruppen auf.
Diese Personen ohne berufliche Qualifikation warten auf der Straße
auf Tagelöhnerjobs, welche in diesem Bereich direkt an der Straße ver79
Die Obdachlosenpolitik der Stadt München inklusive des Kälteschutzprogramms ist Thema des fünften Kapitels dieser Arbeit.
168
�mittelt werden. Neben diesen prekären Arbeitsverhältnissen im Bereich
des ‚grauen Arbeitsmarktes’ versuchen andere durch die Anmeldung
als Selbständige auf dem Münchner Arbeitsmarkt Geld zu verdienen.
Zum Großteil gehen diese Personen allerdings keiner selbständigen
Tätigkeit nach, da ihnen eine tatsächliche Betriebsstätte fehlt. Darüber
hinaus sind viele über das deutsche Renten- und Krankensystem nicht
informiert, das heißt, sie erfüllen ihre Versicherungspflichten nicht und
haben somit auch keine Absicherung im Krankheitsfall und keine Altersvorsorge.“ (Landeshauptstadt München, 2014: 14)
Wieso der „graue Arbeitsmarkt“ sicherheits- und ordnungspolitische
Probleme aufwirft und wieso eine Beschreibung der sozialen und beruflichen Lage der Arbeitssuchenden, die als Zuwander*innen aus Südosteuropa bezeichnet werden im Sicherheitsbericht erwähnenswert
scheint, wird nicht deutlich.
Die verschiedenen mit Armutszuwanderung assoziierten Problemfelder
rufen in den Augen der Verfasser*innen nach Interventionen und Gegenmaßnahmen:
„Im Jahr 2014 werden voraussichtlich neue Konzepte und Vorgehensweisen zum Umgang mit Brennpunkten und Konflikten im öffentlichen Raum erstellt und sukzessiv angewendet (zum Beispiel ‚Wildes
Campieren‘).“ (ebd.: 15)
Für mehr Informationen verweisen die Autor*innen auf die im Beschluss
Runder Tisch Armutszuwanderung formulierte „gesamtstädtische Linie“,
die vorgibt, in welche Richtung sich die kommunale Politik gegenüber
dem, was als „Armutszuwanderung aus Südosteuropa“ problematisiert
wird, bewegen soll. Diese Linie, die auch im fünften Kapitel diskutiert
wird, beginnt mit der Bekräftigung der Münchner Willkommenskultur
- „Grundsätzlich ist jeder Mensch willkommen, der nach München ziehen und sich hier einbringen möchte“ (Stelle für Interkulturelle Arbeit,
2014: 40) fordert aber auch zu einem konsequenten ordnungspolitischen
Vorgehen gegenüber der „bad diversity“ (vgl. Lentin & Titley, 2011) auf:
„Im Bereich der Eingriffsverwaltung wird gegen ordnungs- oder rechtswidriges Verhalten konsequent vorgegangen. Insgesamt geht es auch
169
�darum, dass unnötige Anreizeffekte vermieden werden müssen.“ (Stelle für Interkulturelle Arbeit, 2014: 14)
Die Formulierung der „Vermeidung unnötiger Anreizeffekte“ interpretiere ich als Euphemismus für Abschreckung. Die Polizei und andere
Ordnungshüter sind beauftragt, alle Möglichkeiten ausnutzen, um die
sogenannten Armutszuwander*innen abzuschrecken. Diese Leitlinie
erklärt somit auch, wieso die ‚Armutszuwanderung‘ zu einem Schwerpunkt des Sicherheitsberichts wurde.
Auch das im Zusammenhang mit der Zollrazzia erwähnte Schreiben des
Bayerischen Innenministeriums bestätigte das konsequente Vorgehen
in Bezug auf den selbstorganisierten Arbeitsmarkt:
„Die Polizeiinspektion 14 reagiert auf diese Entwicklung mit regelmäßigen Kontrollen und Platzverweisungen. Ordnungswidrigkeiten,
die sich zumeist im niederschwelligen Bereich bewegen (z.B. Ordnungswidrigkeiten nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz
(BayStrWG), wurden konsequent zur Anzeige gebracht. Zudem wurden die gewonnenen Erkenntnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit
des Zolls (FKS) mitgeteilt.“ (Bayerisches Staatsministerium des Innern,
für Bau und Verkehr, 2013)
Die Polizeimaßnahmen vor Ort – inklusive der Razzia, bei der
die Kontrollierten mit grünen Bändern markiert wurden – waren
also, zumindest ab dem Jahr 2013, keine Eigeninitiativen einzelner
Streifenpolizist*innen, sondern von den Vorgesetzten unterstütztes sicherheitspolitisches Durchgreifen. Auch die rassistischen Problemdefinitionen der Beamt*innen fanden ihre Entsprechung in den postliberal
rassistischen Logiken ihrer Vorgesetzten. ‚Armutszuwanderung‘ wurde
in München versicherheitlicht, also als Problem begriffen, das es mit
den Mitteln der Sicherheits- und Ordnungspolitik zu lösen galt – oder
mit dem zumindest ein Umgang gefunden werden musste.
Wider die Repressionshypothese
Die beschriebenen Polizeimaßnahmen stellten „Grenzsituationen“
(Lebuhn, 2013) dar, denn sie implementierten die Grenzen der Staatsbürgerschaft, wie sich am deutlichsten in der prekären Situation
170
�zeigte, die die Polizeikontrolle für den illegalisierten Omar bedeutete.
Sie schränkten aber nicht nur die Freiheit des illegalisierten Migranten ein (bzw. eröffnete sich für ihn in der Begegnung mit der Polizei
ja paradoxerweise sogar die Handlungsmöglichkeit des Asylantrags),
sondern auch die der in aller Regel freizügigen80 EU-Migrant*innen. Die
Polizeibeamt*innen führten am „Tagelöhnermarkt“ regelmäßig Personenkontrollen und auch Verhaftungen und Hausverbote durch. Diese
ordnungspolitischen Maßnahmen beruhten oft auf rassistischen Problemwahrnehmungen. Gleichzeitig nahmen die Beamt*innen nicht nur
die Tagelöhner*innen als Problem war, sondern auch die für Unruhe sorgenden Beschwerdeführer*innen. „Aus der Perspektive der Polizei, für
die Polizieren Arbeit ist, [sind] oft diejenigen das Problem, die Probleme sehen (und nicht verstehen, dass die Probleme nicht verboten sind)“
(Künkel, 2016). Wenn der Polizeipräsident bei seinem Spaziergang durch
das Viertel erklärt, es handele sich um soziale Probleme und der Polizist auf Streife davon spricht, dass er den klagenden Anwohner*innen
eben erklären müsse, dass das Herumstehen nicht verboten sei und sich
damit zufrieden zeigt, wenn „es sich lichtet“ und „sie sehen“, „dass die
Polizei wieder unterwegs ist“, dann kann dies auch als Versuch der Eindämmung und Befriedung des Konfliktfeldes verstanden werden, statt
als Vertreibungs- oder Säuberungsaktion.
Ob sie aber vertreiben, eindämmen oder befrieden sollen, die Sicherheitspraktiken greifen in die Aushandlungen des urbanen Raumes ein,
indem sie soziale Ordnungen sowohl sicht- und fühlbar machen wie
auch schaffen. Die Praktiken der sogenannten Ordnungshüter*innen am
selbstorganisierten Arbeitsmarkt können damit genauso wenig wie die
Fortress Europe auf Repression reduziert werden.81 Im Anschluss an Foucault lässt sich die Repressionshypothese (vgl. Foucault, 1983; Lemke,
1997) widerlegen. Die Sicherheitspraktiken (re)produzieren, zumindest
für den Moment, die Gewalt des Staates und weisen ihren Subjekten
Rollen zu (vgl. Fassin, 2013). Die ungleichen Interaktionen wirken auf
Körper und Subjektivierung der betroffenen Akteure, markieren sie zu80
Auch EU-Bürger*innen kann die Ausländerbehörde unter gewissen
Umständen die Freizügigkeit aberkennen. Während meiner Arbeit im Workers‘
Center der Initiative Zivilcourage ist es in einem Fall vorgekommen, dass eine
Person tatsächlich nach Bulgarien abgeschoben wurde.
81
Zur Kritik an dem Begriff der ‚Festung Europa‘ vgl. Hess & Tsianos,
2004 und Tsianos & Karakayalı, 2008.
171
�dem sichtbar und stellen so ein ungleiches Verhältnis zwischen suspekten und nicht-suspekten Personen(-gruppen) im Bahnhofsviertel her.
Die Trennungslinie verläuft dabei nicht nur zwischen Inländer*innen
und Ausländer*innen oder zwischen Schwarz und weiß, sondern insbesondere zwischen den Geschäftsleuten sowie ihren Kund*innen auf der
einen Seite und den anderen, die „herumstehen“, rassistischen Vorstellungen öffentlicher Ordnung widersprechen und krimineller Handlungen verdächtigt werden, auf der anderen Seite. Diese Analyse deckt sich
mit Loïc Wacquants Überlegungen zu einer historischen Anthropologie
des Neoliberalismus, in der er herausstellt, dass Sicherheitsbehörden im
neoliberalen Staat eben nicht nur restriktiv vorgingen:
„Instead of viewing the police, the court, and the prison as technical
appendages for fighting crime, we must recognise that they constitute
core political capacities through which the Leviathan governs physical
space, cuts up social space, dramatises symbolic divisions and stages
sovereignty.“ (Wacquant, 2012: 76)
Die Markierung mit den grünen Bändchen war eine kondensierte Artikulation des subjektivierenden Regimes, die die Markierten auf eine rassifizierte, unterworfene, suspekte und unerwünschte Position in der Gesellschaftsordnung verwies. Gerade das Beispiel der grünen Bändchen
zeigt aber auch, dass diese Verhältnisse nicht ausweglos sind, sondern
ausgehandelt und dass Widerstand möglich ist, zum einen in Form von
representational politics – wie an dem Protest gegen die grünen Bändchen (und auch am Widerspruch gegen das Hausverbot des Back-Cafés)
deutlich wurde, vor allem aber in Form von imperceptible politics: Die
Markierten, Kontrollierten, Verhafteten, Verscheuchten und Beobachteten trafen sich weiter auf den Straßen des Bahnhofsviertels, sie ließen
sich nicht vertreiben und entzogen ihre hartnäckigen, kollektiven Praktiken den Versuchen des Regierens.
172
�173
�Obdachlosenpolitik und Grenzziehungen städtischer Bürgerschaft
Umkämpfte Stadtbürgerschaft
„Wir sind unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, Münchner Bürger unterzubringen“, so antwortete der Leiter des Münchner Amts für
Wohnen und Migration in einem Interview im Juni 2011 auf die Frage,
ob sein Amt auch EU-Migrant*innen, die in München unfreiwillig obdachlos sind, in die kommunalen Notunterkünfte aufnehme. „Bloß, das
sind keine Münchner Bürger“. Er fuhr fort:
„Es sei denn, sie sind länger als ein halbes Jahr hier, und sie haben
eine Möglichkeit, auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn
sie das nicht sind, gilt die EU-Freizügigkeitsregelung für sie nicht. Und
dann sind sie draußen aus dem Geschäft.“
Kommunale Bürgerschaft sei ausschlaggebend für die Verpflichtung
der Stadt unterzubringen. Die Grenzen der Münchner Bürgerschaft
zog er entlang der Grenzen der EU-Freizügigkeit. Die Regelungen der
EU-Freizügigkeit legte er aber sehr frei aus – denn nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU sind nicht nur Personen mit mehr als sechs Monaten
Aufenthalt und ausreichend Verdienst aufenthaltsberechtigt, sondern
Unionsbürger*innen genießen aufgrund ihrer Unionsbürgerschaft die
Freizügigkeit, die ihnen nur unter hohen Hürden aberkannt werden
kann. Nebenbei bezeichnet er die Stadtbürgerschaft auch als „Geschäft“
und impliziert somit einen ökonomischen Charakter.
In den folgenden Analysen der Aushandlungen Münchner Obdachlosenpolitik wird sich zeigen, dass diese Grenzziehungen des Rechts auf
Unterbringung und somit – in des Amtsleiters Worten – der Münchner Bürgerschaft, höchst flexibel und umkämpft waren. Die Kommunalpolitik hat in diesen Aushandlungen ihre Problemdefinitionen und
Lösungsstrategien immer wieder verändert.
Mit der Einführung der EU-Freizügigkeit sind die staatlichen Technologien des Regierens der Migration wie Grenzkontrollen und
174
�Visumspolitiken gegenüber Unionsbürger*innen (fast) obsolet geworden.82 Seitdem haben die Kommunen als migrationspolitische Akteure
in EU-Europa an Bedeutung gewonnen. Auch wenn der Amtsleiter sich
hier, auf den ersten Blick, an die von der BRD und der EU gezogenen
Grenzen der Unionsbürgerschaft zu halten scheint, musste die Stadt
sich von Staats- und Unionsbürgerschaft emanzipieren und selbst migrationspolitisch kreativ werden. Diese Beobachtung deckt sich mit der
weit verbreiteten Diagnose, dass sich mit der Globalisierung die Skalen
des Regierens verschieben: „Es verändern sich die Kompetenzen und
Machtverhältnisse zwischen nationalen Regierungen, supranationalen
Institutionen und der lokalen Ebene“ (Hess & Lebuhn, 2014: 16; vgl.
auch Faist & Häußermann, 1996). Seit einigen Jahren ist eine lebhafte
wissenschaftliche Debatte um die Frage entbrannt, was diese Verschiebungen für die lokale, kommunale Ebene bedeuten. Ein Beispiel ist die
These der „global cities“ von Saskia Sassen (1996), die davon ausgeht,
dass sich ein globales System aus wirtschaftlich zentralen Städten herausbildet, welche sich stärker aufeinander beziehen als auf ihre territoriale Umgebung und sich so auch von dem Staat, in dessen Territorium
sie liegen, tendenziell entkoppeln. Auch die Münchner Stadtverwaltung
betonte in ihrem Integrationskonzept 2008, dass München als Standort
eine zunehmende internationale Bedeutung zukäme (Landeshauptstadt
München, 2008): 7). Dies sei Teil „eine[r] globale[n] Entwicklung und
eine[s] Trend[s], der weltweit alle großen Städte erfasst hat: Sie werden
zunehmend internationaler und interkultureller“ (ebd.: 6).
Unter dem Schlagwort urban citizenship wird der Stadtbürgerschaft
in der wissenschaftlichen Debatte und auch in den sozialen Bewegungen83 das Potenzial zugesprochen, den exkludierenden Charakter von
Staatsbürgerschaft zu überkommen, weil in der Stadt Aufenthalt bzw.
Wohnsitz (ius domicilii) über die Zugehörigkeit zur Bürgerschaft bestimme und nicht, wie dies bei Staatsbürgerschaft der Fall ist, der ‚falsche‘ Geburtsort (ius solii) oder die ‚falsche‘ Nationalität der Eltern (ius
sangui) Einwohner*innen von bürgerschaftlichen Rechten ausschließen
könnten. In seinem grundlegenden Papier Reinventing urban citizenship
spricht sich der Politologe Rainer Bauböck dafür aus, die Autonomie
82
Das sechste und siebte Kapitel zeigen, wie sich die staatliche Migrationspolitik gegenüber Unionsbürger*innen auf die Sozialpolitik verlagert hat.
83
Ein Beispiel hierfür ist die Solidarity Cities Bewegung, siehe https://
solidarity-city.eu/de/.
175
�der Städte vis-à-vis der Staaten zu stärken mit dem Ziel, dass die politische Bürgerschaft einer Stadt auch mit der sozialen Bevölkerung
übereinstimme: „Urban citizenship is in this respect a truly public good
from whose enjoyment no resident is excluded“ (Bauböck, 2003). Davon
verspricht er sich nichts weniger als eine kosmopolitische Demokratie:
„An urban citizenship that is emancipated from imperatives of national
sovereignty and homogeneity may become a homebase for cosmopolitan democracy“ (ebd.: 157). Andere Arbeiten zu Transformationen von
Bürgerschaft auf der Ebene der Stadt gehen über eine proklamative politische Theorie hinaus und schauen genauer hin, welche Aushandlungen
auf der Ebene der Stadt stattfinden. Der Sozialgeograph und Migrationsforscher Mathias Rodatz hat so etwa am Beispiel der Frankfurter
Integrationspolitik gezeigt,
„dass die Verlagerung des Integrationsparadigmas auf die Ebene der
Stadt die Ordnungslogik des Nationalstaats infrage stellt, weil sich
Stadtpolitik heute im Allgemeinen an neoliberalen Rationalitäten orientiert.“ (Rodatz, 2014: 37)
Auch wenn er Kritiken an der Neoliberalisierung des Staates, die hervorheben, dass Rechte nicht mehr universell seien, sondern an Selbstverantwortung und ökonomische Verwertbarkeit geknüpft würden (vgl.
ebd.: 43), durchaus ernst nimmt, geht es auch ihm darum, welche Potenziale Stadtbürgerschaft verspreche für Versuche, mit den „alten, nationalen Mustern zwischen rassistischem Ausschluss und kulturalistischen
Integrationsparadigma“ (ebd.: 51f) zu brechen. Kämpfe um Stadtbürgerschaft sind ihm zufolge Kämpfe um „substanzielle Teilhabe“ (ebd.),
für die sich im Zuge der neoliberalen Transformationen der Stadtpolitik
durchaus Fenster öffneten. Die Stadtpolitik würde sich von „Defizitorientierung“ (ebd.: 36), vom „Nichteinwanderungsland“ (ebd.: 40) und
der „Leitkultur“ (ebd.) abwenden und gleichzeitig der „Potenzialorientierung“ (ebd.: 43) und „Vielfalt“ (ebd.: 44) zuwenden. Der Politologe
Henrik Lebuhn hingegen lenkt die Aufmerksamkeit auf „Grenzsituationen“ (Lebuhn, 2012), die in den Städten entstünden (vgl. Hess & Lebuhn,
2014; Lebuhn, 2013). Europäische Grenz- und Migrationsregime operierten nicht nur an den Außengrenzen, sondern eben auch im Inneren der
Nationalstaaten und produzierten eine Bandbreite an unterschiedlichen
Aufenthaltsstatus, die mit unterschiedlichen sozialen und politischen
176
�Rechten einhergingen. Hier wird auch von der Stratifizierung des Migrationsregimes gesprochen (vgl. Hess & Lebuhn, 2014; Mezzadra & Neilson, 2014). Jede Situation, in der Migrant*innen mit dem lokalen Staat
in Berührung kommen, werde dann zur Grenzsituation. Auch städtische
Einrichtungen wie Sozialämter, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel
würden immer tiefer in die Kontrolle von staatlichen Aufenthaltspolitiken verstrickt und setzten so nationale Muster von Zugehörigkeit um
(vgl. auch Faist & Häußermann, 1996). „Under these conditions, urban
citizenship becomes connected to Schengen regulations and national
immigration law rather then emancipating the urban realm from them“,
so Lebuhn (2013: 13). Auch hier wird der Ursprung der städtischen
Grenzpolitiken aber nicht der Stadt, sondern dem Nationalstaat und der
EU zugerechnet. Die These der Proponent*innen von urban citizenship
ist, dass die staatlichen und EU-europäischen Grenzziehungen den ‚eigentlichen‘, inklusiven Charakter städtischer Bürgerschaft überlagern.
Es lässt sich also festhalten, dass urban citizenship bisher vor allem auf
ihre Inklusionsaspekte und Potenziale hin untersucht wurde, welche der
Staatsbürgerschaft und auch der EU-europäischen Migrationspolitik gegenübergestellt wurden. Der lokalen Ebene wurde dabei das Potenzial
zugesprochen, den Staatsrassismus sowie die von Exklusion geprägte
Staats- bzw. Unionsbürgerschaft zu überkommen und Stadtbürgerschaft
wurde als naheliegender Bezugspunkt für Kämpfe um Bürgerschaft
markiert.
Schon im einleitenden Zitat wurde deutlich, dass manche Menschen in
München nicht als Münchner Bürger*innen anerkannt und von grundlegenden sozialen Rechten ausgeschlossen werden. Diese Grenzziehung
folgt zwar auf den ersten Blick den internen Stratifizierungen der Unionsbürgerschaft (einer weiteren Form von citizenship, die als postnational gepriesen wird), auf den zweiten Blick produziert die Stadt München aber ihre eigenen Grenzen auch in Prozessen, die von der BRD
und der EU relativ unabhängig sind. In diesem Kapitel werde ich anhand der Aushandlungen der Münchner Obdachlosenpolitik gegenüber
Unionsbürger*innen zwischen 2007 und 2015 untersuchen, wie die Stadt
München ihre Grenzen zieht und inwiefern sie sich dabei von deutschen und EU-europäischen Bürgerschaftsarchitekturen emanzipiert.
Ich spüre dabei den Rationalitäten, Antagonismen und Kontingenzen
dieses städtischen Grenzregimes nach. Dieses Kapitel stellt das empirische Herzstück des Buches dar. Mein Forschungsinteresse gilt auch
177
�hier wieder den Grenzen, der Konstruktion und Produktion des Außen
und ich positioniere mich mit den Kämpfen, die diese Grenzziehungen angreifen und über sie hinaus gehen. Ich gehe von Kämpfen aus,
die etwa im Amt für Wohnen und Migration (drei Stockwerke unter
dem Büro des anfangs zitierten Amtsleiters) stattfanden, als obdachlose Menschen hier eine Unterkunft beantragten. Dazu greife ich diverse
Veranstaltungen und stadtpolitische Runde Tische auf, in denen die öffentliche Problemwahrnehmung und die Obdachlosenpolitik der Stadt
München ausgehandelt wurden und an denen auch ich seit 2010 aktiv
teilnahm. Diese konfliktiven Situationen verwebe ich mit der Analyse
von städtischen Policy-Dokumenten, die die Entwicklungen der Problemdefinition und der Erklärungs- sowie Lösungsversuche in der Stadtverwaltung deutlich machen. Doch zuerst stelle ich kurz die relevanten Akteure und Paradigmen, die den Politikstrang der Unterbringung
obdachloser EU-Migrant*innen beeinflusst haben, vor: das Programm
Wohnen statt Unterbringen (Wohnungs- und Flüchtlingsamt, 2002) und
das Münchner Integrationskonzept (Landeshauptstadt München, 2008).
Dann zeichne ich nach, wie die Problematisierung sich veränderte bzw.
verschiedene Perspektiven miteinander stritten: von der Abwesenheit
einer Problematisierung über das Problem der sozialen Exklusion hilfebedürftiger Zuwander*innen bis hin zur Definition der wohnunglosen
‚Armutszuwander*innen‘ als Problem und Bedrohung für die Münchner
Bürger*innenschaft. Daraufhin geht es darum, wie die Stadt München
versucht, diese neu entdeckten Probleme zu lösen bzw. zu ‚managen‘.
Wer wurde untergebracht und wer nicht? Wie sind die verschiedenen
Unterbringungspolitiken und ihre Grenzziehungen entstanden? Welche Rationalitäten, Akteure, Kräfteverhältnisse haben eine Rolle in den
Aushandlungsprozessen gespielt? Wie wurden hier die Grenzen der
Münchner Bevölkerung gezogen, wie wurde urban citizenship neu ausgehandelt? Inwiefern können die entstehenden Aus- und Einschlüsse
durch nationalstaatliche (oder EU-europäische) Bezugspunkte erklärt
werden?
Es folgt ein erster Einblick in die alltäglichen Kämpfe obdachloser
Migrant*innen mit Bürokratie und Amtsrassismus. Für mich war es die
erste von vielen Begegnungen mit den Programmen der Münchner Obdachlosenhilfe. Von ihr ausgehend bin ich verschiedenen Trajektorien
gefolgt, um mehr über die Obdachlosenpolitik der Stadt München zu
erfahren.
178
�Konflikt um Wohnraum I – Ein ‚Härtefall’
München, Mai 2010. Sebahattin Yankov, Hristo Vankov und ich trafen
uns um halb neun Uhr vor dem Amt für Wohnen und Migration, einem
modernen fünfstöckigen Gebäude im Zentrum Münchens. Sebahattin
Yankov und sein Onkel Hristo Vankov hatten gerade drei Tage bei einem Entsorgungsunternehmer gearbeitet, als Sebahattin Yankov bei
einem Arbeitsunfall mit dem Gabelstapler seinen rechten Zeigefinger
verlor. Daraufhin fuhr ihr Arbeitgeber sie zwar zum Krankenhaus, leugnete aber, dass sie bei ihm gearbeitet hätten und erklärte, sie nie wieder
sehen zu wollen. Er hatte sie nicht angemeldet und nicht bezahlt. Es
bestand kein schriftlicher Arbeitsvertrag. Ohne Arbeit und ohne Geld
konnten die beiden ihre Schlafplätze in einem privaten Wohnheim
nicht mehr bezahlen. Sie wurden obdachlos und verbrachten die Nächte
wechselnd unter der Brücke, bei Bekannten oder in einem Spielsalon,
in dem ein Bekannter arbeitete. Hilfe suchend wandten sie sich an den
Zoll bzw. dessen Unterabteilung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die
sie zum Arbeitsgericht schickte, wo sie Klage wegen Lohnbetrug gegen
ihren ehemaligen Arbeitgeber erhoben. Kurze Zeit später trafen wir sie
während des Infostandes Anfang 2010. Bei der Abteilung der Zentralen
Wohnungslosenhilfe (ZEW) im Amt für Wohnen und Migration wollten
wir nun eine Unterkunft für sie beantragen. Wir betraten das Gebäude
und zogen eine Wartenummer in der Empfangsstelle, der sogenannten
Infothek, im Erdgeschoss. Der Sachbearbeiter in der Infothek, zu dem
wir nach etwa 40 Minuten vorgelassen wurden, nahm ihre Personalien
auf und stellte uns einen rosa Laufzettel aus, mit dem wir zu der zuständigen Sachbearbeiterin im ersten Stock gelangten. Im ersten Stock
folgten wir durch die labyrinthartigen Gänge den Schildern zu dem uns
zugewiesenen Wartebereich C1. Auf dem Weg wurden wir mehrmals
von Mitarbeiter*innen in Security-Uniform um den rosa Laufzettel gebeten. Ihr Auftreten ließ offen, ob sie Kund*innen den Weg wiesen oder
Verdächtige auf ihre Legitimation hin kontrollierten. Im Wartebereich
angekommen, zogen wir die zweite Nummer – Nummer 149 – und setzten uns zwischen die anderen Wartenden. Der Wartebereich bestand
aus einer Erweiterung des Ganges mit im Boden verschraubten Sitzreihen, die im Halbkreis um das Aufrufsystem und eine Gangkreuzung
angeordnet waren. Das elektronische Aufrufsystem, eine Tafel, die die
aufgerufenen Wartenummern anzeigte, verbreitete Unverständnis unter
179
�den Wartenden. Etwa alle fünf bis zwanzig Minuten ertönte eine elektrische Glocke und eine Zahl änderte sich. Eine Person stand auf und
verschwand hinter einer der Türen. Dies geschah jedoch nicht in der
erwarteten Reihenfolge, sondern unberechenbar, da mehrere Zahlenreihen parallel und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten fortliefen.
203
324
405
148
148
143
123
203
521
144
140
141
Immer wieder öffnete sich eine der Türen in den einzusehenden Gängen
und eine Mitarbeiterin ging eiligen Schrittes entweder zum Kopierraum
oder dem Zimmer ihres Vorgesetzten. Wir warteten etwa eine Stunde,
bis unsere Nummer aufgerufen wurde.
Die Sachbearbeiterin hatte die Wände ihres Büros mit Plakaten von Kätzchen und dem Dalai Lama geschmückt. Sie saß hinter einem Schreibtisch und wir setzten uns davor. Ich erklärte die Situation der beiden,
während diese mir immer wieder Dokumente reichten, um die ich sie
bat: Ausweis, Anmeldung, Krankenhauspapiere, etc. Die Sachbearbeiterin erklärte erst ganz pauschal, ihre Hände wären leider gebunden,
sie könnte EU-Bürger*innen nicht unterbringen. Das einzige Angebot,
das sie machen könnte, wäre ein Ticket an die tschechische Grenze. Das
System könnte das nicht tragen, sie wüsste nicht, wie das alles weitergehen sollte. Aber wo sollten die beiden denn schlafen, während sie auf
das Gerichtsverfahren gegen ihren Arbeitgeber warteten, wandte ich
ein. Sie könnte leider nicht helfen, wiederholte sie. Dann ergänzte sie
nach kurzer Überlegung, es gäbe das Männerwohnheim in der Pilgersheimer Straße, da könnte jeder für fünf Euro die Nacht unterkommen.
Sie könnte nur unterbringen, wenn ein Bescheid des Jobcenters, dass es
die Kosten trüge, vorläge. Wir könnten es beim Jobcenter versuchen,
auch wenn sie keine Chance sähe. Durch weitere Gänge fanden wir den
Weg zur Sachbearbeiterin des Jobcenters. Sie hatte ein verschlossenes
Gesicht und war unfreundlich. Es gäbe keine Möglichkeit für die beiden
Männer, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II zu erhalten.
Sie hätte eine Liste mit Voraussetzungen, diese verlangte unter anderem ein Jahr sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
in Deutschland. Wir gaben nicht auf und ich fragte immer wieder, wo
sie denn schlafen sollten in ihrer Situation und zeigte auf Sebahattin
180
�Yankovs eingebundene Hand. Ich argumentierte, dass es doch im Interesse des Staates wäre, den betrügerischen Arbeitgeber zu verfolgen und
versicherte, dass sie dem Staat nicht auf der Tasche liegen wollten, aber
Sebahattin Yankov mit seiner verletzten Hand nicht arbeiten könnte.
Dann zog ich unseren Joker und legte ihr einen Ausschnitt aus einer
Erklärung des Sozialreferats an den Stadtrat aus dem Jahr 2009 vor:
„Sollten Haushalte von sich aus auf das Amt für Wohnen und Migration zukommen mit der Bitte um Unterbringung, so werden die Haushalte befristet im Notunterbringungssystem untergebracht und dies
der Ausländerbehörde mitgeteilt.“ (Sozialreferat, 2009: 7)
Langsam wurde sie ein wenig freundlicher. Wir könnten es bei dem
Zuständigen für Leistungen nach dem SGB XII versuchen. Ich fragte,
ob sie uns die Zimmernummer und den Namen nennen könnte. Wir
sollten bitte vor der Tür warten. Nach einigen Minuten kam sie heraus
und sagte, sie hätte noch eine Idee und müsste mit ihrer Vorgesetzten
reden, wir sollten noch einmal warten. Während wir warteten, rief ich
in dem Wohnheim in der Pilgersheimer Straße an: „Nein, wir nehmen
keine Osteuropäer auf” – die Abweisung war klar. Nach erneuter Nachfrage erklärte die Person am Telefon, es bräuchte eine Bestätigung der
Kostenübernahme, für ‚Osteuropäer‘ würde das manchmal für höchstens zwei bis drei Tage aus einem Sondertopf bezahlt. Interessant, es
gibt einen ‚Sondertopf‘, dachte ich. Dann kam die Sachbearbeiterin von
ihrem Chef zurück und sagte, sie hätte die Idee gehabt, wegen dem Arbeitsverhältnis und dem Fall vor dem Arbeitsgericht könnte man etwas
machen, aber es ginge doch nicht. Obwohl nahe der Verzweiflung, gaben
wir nicht auf: „Wo sollen sie denn hin?“ Zum ersten Mal erwähnte auch
sie den ‚Sondertopf‘ und wir könnten ja noch mit ihrem Chef reden,
er säße ein Stockwerk höher. Im zweiten Stock erwartete uns wieder
Sicherheitspersonal. Diesmal wollten sie uns nicht durchlassen. Ich forderte sie auf, ihren Chef zu fragen, denn es sei nicht ihre Entscheidung,
wer bei ihm vorsprechen dürfe. Kurze Zeit später teilte der Sicherheitsdienst uns mit, der Chef sei noch beschäftigt, wir sollten warten. Ich war
froh um die Pause und erklärte Hristo Vankov und Sebahattin Yankov
radebrechend, dass es eventuell eine kleine Chance gäbe, dass dies ein
181
�Haus der Irren wäre und fragte, ob sie den Film Asterix erobert Rom84
(Goscinny, Uderzo & Watrin, 1976) kennen würden. Sie kannten ihn
nicht. Schließlich wurden wir zum Vorgesetzten gerufen, der ein sympathischer Mann Anfang dreißig war, sehr höflich, mit einem direkten
Blick und unterschwelliger Autorität. Das Gespräch mit ihm war angenehmer, ich fühlte mich auf gleichem sozialen Terrain. Nachdem ich die
Situation dargelegt hatte, sagte er, es täte ihm leid, sie könnten nichts
tun. Ich fragte ihn, was er denn von der Situation in München hielte
und erklärte, ich schriebe meine Doktorarbeit zu dem Thema und hätte
auch einmal ein Praktikum in diesem Gebäude absolviert bei der Stelle
für interkulturelle Arbeit im vierten Stock. Es wäre interessant, auch
einmal die unteren Stockwerke kennenzulernen. Dann zeigte ich ihm
das Schreiben des Sozialreferats und sprach ihn auf den ‚Sondertopf‘ an.
Er erklärte, er hätte selber schon zu der Zuwanderung nach München
aus den EU-Beitrittsstaaten geschrieben. Schließlich sagte er, wir sollten
zu dem Chef einer anderen Abteilung gehen, der könnte uns bestimmt
helfen. Überraschend hatte sich ein neuer Weg geöffnet.
Den nächsten Chef schätzte ich auf Ende fünfzig. Er sprach mit bayrischem Dialekt. Verwundert und misstrauisch griff er zum Telefonhörer:
„Warum hast du die zu mir geschickt? Was, die waren nicht bei dir? Ja,
da ist was faul.“ Ich schluckte meinen Zorn, blieb freundlich und zeigte ihm alle mitgebrachten Papiere: das Arbeitsgerichtversäumnisurteil,
den Krankenhausdurchgangsbescheid etc. Ich ließ das Wort ‚Zivilcourage‘ fallen, sagte, das wäre doch im Interesse des Staates und es widerstrebte ihnen sehr, Hilfe vom Staat anzufordern, aber jetzt hätten sie
keine andere Möglichkeit. Er griff wieder zum Hörer und sagte: „Wie
kann es sein, dass du nichts für die machen konntest?“ Er hatte sich auf
unsere Seite geschlagen. Das würde alles über den ‚Sondertopf‘ laufen,
intern, erklärte er zuvorkommend. Dann rief er die Vorgesetzte der ersten Sachbearbeiterin an und sagte anschließend zu uns, es wäre alles
geregelt, wir sollten zu der ersten Sachbearbeiterin gehen. Ich zeigte
Hristo Vankov und Sebahattin Yankov den erhobenen Daumen. Zurück
im ersten Büro sagte die Sachbearbeiterin, sie hätte mit ihrer Chefin
84
In dem Komik müssen Asterix und Obelix ein Papier aus einem labyrintischen Amt besorgen. Bevor sie selbst den Verstand verlieren, haben sie die
Idee, den Spieß umzudrehen und bringen durch gezielte Fehlinformationen den
ganzen Ablauf durcheinander, woraufhin die Mitarbeiter*innen des Amtes den
Verstand verlieren.
182
�gesprochen. Sie könnte uns ein Ticket an die tschechische Grenze geben.
Ich brach fast zusammen: Nein, das wäre anders besprochen, sie sollte
noch einmal nachfragen. Sie verließ das Büro und wir warteten eine
lange Weile. Als sie zurückkam, sagte sie, Sebahattin Yankov und Hristo
Vankov würden für zwei Wochen untergebracht. Aber jetzt müssten wir
uns beeilen, es wäre schon fast zwölf Uhr und wir müssten für heute
noch eine Unterkunft finden. Mit welchen Rationalitäten, Regelungen,
Politiken, Akteuren und Praktiken sind wir an diesem Vormittag im Amt
für Wohnen und Migration in Aushandlungen getreten?
Street-level Bureaucracy
Zuerst einmal sind wir an diesem Vormittag auf Sachbearbeiter*innen
gestoßen, die durchaus Handlungsmacht haben, wie sie die geltenden
Regelungen auslegen und wie sie mit den Antragsstellenden umgehen.
Ich möchte hier kurz auf die Handlungsmacht auf unterster Ebene eingehen, auch wenn sie nicht im Mittelpunkt dieses Kapitels steht. Die
Sachbearbeiter*innen lehnten den Antrag auf Unterbringung erst einmal
pauschal ab, auch wenn dies nicht nur im Widerspruch zu öffentlichen
Äußerungen ihrer Vorgesetzten, sondern auch zu den Gesetzen und teilweise zu internen Anweisungen stand. In ihrer Pilotstudie zu städtischen
Reaktionen auf Familien mit beschränktem Zugang zu sozialen Leistungen in Berlin und Madrid sind die britischen Sozialforscher*innen Jonathan Price und Sarah Spencer (Price & Spencer, 2014) auf ähnliche
Praktiken gestoßen, die sie „excessive gatekeeping“ (ebd.: 27) nennen.
Im Anschluss an die Forschungsdebatte zu „street-level bureaucracy“
(Evans & Harris, 2004; Lipsky, 2010) bezeichnen sie gatekeeping als einen
Prozess, der den Zugang zu Unterstützung und Leistungen beschränke
und als Versäumnis, Leistungen zu erbringen, wenn eigentlich ein Recht
auf diese bestehe (Price & Spencer, 2014: 27). Paradoxerweise könnten
mehr Regeln zu einem größeren Auslegungsspielraum führen. Sie erklären gatekeeping mit persönlichen und mit institutionellen Faktoren:
„the impact of street-level bureaucrats’ personal values, and the complexity of legal and policy frameworks causing a lack of understanding, with insufficient training to support staff in their day-to-day
work with migrants [... and] decisions about service provision [that]
are not driven by need but by budgetary considerations.“ (ebd.: 28)
183
�Die Praktiken der Sachbearbeiter*innen bzw. der street-level bureaucrats, auf die ihre Vorgesetzten nur beschränkten Einfluss haben, werden zur angewandten Stadtpolitik:
„Because of management’s limited control of front-line practice, a lack
of resources and opaque policies, street-level bureaucrats are forced
to find practical solutions on the front line, and this becomes policy.“
(ebd.: 5)
Solche kleinteiligen, scheinbar individuellen Entscheidungen, die aber
doch eine sehr grundlegende Rolle spielen und auf institutionellem Rassismus, institutionsinternen Logiken und Kostenfaktoren sowie vom öffentlichen Diskurs beeinflussten Überlegungen und situativen Affekten
beruhen, sind aus den Regimen der Arbeit und Migration nicht wegzudenken und machen durchaus auch deren dynamischen Charakter mit
aus.85
Im Folgenden möchte ich die Analysen aber trotzdem nicht auf die Praktiken der street-level bureaucrats konzentrieren, sondern vielmehr, von
dem Konflikt im Amt für Wohnen und Migration ausgehend, Prozessen
des policy-making nachspüren, die über diesen einzelnen Konflikt und
die Praktiken in diesem Amt hinausgehen. Dabei werde ich immer wieder auf Artikulationen des Regimes der EU-internen Migration stoßen,
die auch an diesem Vormittag eine Rolle gespielt haben: der ‚Sondertopf‘, das Angebot einer Rückfahrkarte, eine Liste an Anforderungen,
die Antwort auf eine Stadtratsanfrage, etc. Als Sebahattin Yankov, Hristo Vankov und ich im Mai 2010 das erste Mal das Amt für Wohnen und
Migration betraten, war mir das alles noch sehr neu, heute reihen sich
diese Verdichtungen des Regimes in ein – sicher nicht vollständiges,
aber doch sehr komplexes – Bild ein, das ich im Folgenden nachzeichnen
möchte. Zuerst soll knapp auf die Akteure und Institutionen eingegangen werden, die die Obdachlosenpolitik der Stadt München bestimmen.
85
Es hätte längerfristiger teilnehmender Beobachtung und Interviews
mit den street-level bureaucrats im Amt für Wohnen und Migration benötigt,
um die Frage nach diesen institutionalisierten Handlungsräumen und welche
Rolle verschiedene Rationalitäten – etwa rassistische, humanitäre, ökonomisch,
klassistische, aber sicher auch relativ autonome amtsinterne Logiken – und
auch Unwissen spielen, eingehender beantworten zu können.
184
�Dann werde ich nachverfolgen, wie die städtischen Akteure die sozialen
Verhältnisse der EU-internen Migration und insbesondere die Obdachlosigkeit als Problem erkannt und konstruiert haben und mit welchen
Mitteln sie zwischen den Jahren 2006 und 2013 versucht haben, mit diesem Problem umzugehen.
Jalla Wohnungsamt! Eine Genealogie der Münchner Obdachlosenpolitik gegenüber Migrant*innen
Institutionen der Münchner Obdachlosenpolitik
Das Amt für Wohnen und Migration, eine Unterabteilung des Sozialreferats, ist sowohl für die Obdachlosen- wie für die Migrationspolitik der
Stadt München zuständig. Es hat im Jahr 2011 seinen hundertjährigen
Geburtstag gefeiert, besteht unter diesem Namen aber erst seit 2004 (zuvor: Wohnungs- und Flüchtlingsamt). Die Broschüre zum hundertjährigen Geburtstag (Amt für Wohnen und Migration, 2011) erzählt eine
Geschichte des Wohnungsamtes, die von Krise zu Krise schreite und
von im deutschlandweiten Vergleich extrem teuren Wohnungsmarkt
geprägt sei. Sie stellt dar, wie verschiedene Krisen, die durch Zuwanderung entstanden, gemeistert worden seien – ob nach dem Zweiten Weltkrieg, als 60% der Bausubstanz zerstört war, oder Anfang der 1990er Jahre, als Notunterkünfte für 20.000 Flüchtlinge aufgebaut wurden. Krise, so
scheint es, ist schon seit mindestens hundert Jahren der Normalzustand
Münchner Wohnraumpolitik. Heute hat das Amt für Wohnen und Migration eine breite Palette an Aufgaben, die auf die verschiedenen Abteilungen verteilt sind, deren Namen eine Vorstellung der Tätigkeiten des
Amtes geben: Abteilung Wohnraumerhalt, Büro für Rückkehrhilfen/
Rückkehrberatung Coming Home, Integrationshilfe nach Zuwanderung,
Soziale Wohnraumförderung-Wohnungslosenhilfe, Fachbereich Objektplanung, Immobilienmanagement, Kommunaler Wohnungsbau, Stelle
für Interkulturelle Arbeit und Zentrale Wohnungslosenhilfe (ZEW).
Vertikal lässt sich das Amt auch in diejenigen Abteilungen aufteilen, die
Kundenkontakt haben und jene, die eher Steuerungsfunktionen einnehmen oder innerhalb der Verwaltung arbeiten. Ich sage auch deswegen
vertikal, weil ich die räumliche Aufteilung während meines Praktikums
185
�bei der Stelle für interkulturelle Arbeit im Jahr 2008 so erlebt habe. Mein
Büroplatz war im vierten Stockwerk, in dem auch die Amtsleitung saß.
Außer beim Gehen und Kommen hatte ich keinerlei Berührung mit dem
Publikumsverkehr, nur vor dem benachbarten Büro für Rückkehrhilfen Coming Home saßen hin und wieder einzelne Personen wartend im
Gang. Als ich zwei Jahre später das erste Mal obdachlose Personen begleitete, um eine Unterkunft zu beantragen, ergab sich ein vollkommen
neues Bild des Amtes bzw. der ersten beiden Stockwerke des Gebäudes, in denen sich die Zentrale Wohnungslosenhilfe (ZEW) inklusive
des Münchner Jobcenters für Wohnungslose befindet. Hier herrschte
ein reges Kommen, Warten und Gehen, überwacht vom Security Service.
Der in der ethnografischen Situationsbeschreibung dargestellte Ablauf der Beantragung einer Notunterkunft lässt sich schematisch
wie folgt darstellen: Von der Infothek werden Hilfesuchende an die
Sachbearbeiter*innen im ersten oder zweiten Stock weitergeleitet, die
wiederum zum hausinternen Jobcenter für Wohnungslose weiterleiten,
denn für eine Einweisung (so wird das Schreiben genannt, das obdachlosen Personen einen Platz in einer Notunterkunft zuweist) will die ZEW
eine Finanzierungsbestätigung des Jobcenters vorliegen haben. Der
Bund übernimmt nämlich über das Jobcenter 29,1 Prozent der Kosten der
Unterkunft. Personen, die nach Einschätzung der Sachbearbeiter*innen
unterbringungsberechtigt sind, bekommen dann einen Einweisungsbescheid in die Hand gedrückt. Mit diesem bekommen sie einen Bettplatz
oder eine Wohneinheit in einer Notunterkunft. Die Stadt bringt akut
obdachlose Personen in Pensionen oder Notunterbringungen unter. Das
Amt betreibt eigene Unterkünfte und Pensionen, weist aber auch in Unterkünfte von freien Trägern oder in Zeiten der Knappheit in privat betriebene Pensionen ein. Alleinstehende Personen bekommen meist ein
Bett in einem Mehrbettzimmer zugewiesen, Paare oder Familien eine
abgetrennte Wohneinheit. Kochgelegenheiten und sanitäre Einrichtungen werden in der Regel von mehreren Parteien geteilt.
Viele der für die Münchner Obdachlosenpolitik relevanten Entscheidungen werden im Stadtrat getroffen. Der Stadtrat kann als Münchner
Gemeinderat faktisch als kommunales Parlament begriffen werden,
auch wenn er strikt genommen keine legislative Kompetenz hat, sondern nur Verordnungen und Satzungen erlassen kann, die den Gesetzen
der Landes- oder Bundesebene nachrangig sind. Eine wichtige Aufgabe des Stadtrates besteht darin, den Haushalt zu bestimmen – also zu
186
�entscheiden, wofür wie viel Geld ausgegeben wird. Die alle sechs Jahre
gewählten 81 Stadträt*innen arbeiten ehrenamtlich. Eine Ausnahme bilden die Referent*innen der kommunalen Referate (Sozial-, Kommunal-,
Baureferat etc.), welche gleichzeitig auch Stadträt*innen sind. Bis 2014
gab es eine rot-grüne Mehrheit, danach regierte die SPD in Koalition
mit der CSU. Beschlüsse werden auf Grundlage von Anträgen getroffen, welche von Stadträt*innen, Fraktionen und dem Oberbürgermeister gestellt werden können. Auf Grundlage der Anträge erarbeitet die
Verwaltung der Stadt (d.h. die jeweilig zuständigen Referate und die
diesen untergeordneten Ämter und Stellen) Beschlussvorlagen, die
dann wiederum im Stadtrat diskutiert und als Beschlüsse verabschiedet werden, sofern eine einfache Mehrheit in der etwa einmal monatlich stattfindenden Vollversammlung des Stadtrats für diese abstimmt.
Zwischenzeitlich treffen sich die jeweiligen Ausschüsse, z.B. der Sozial- oder der Wirtschaftsausschuss. Neben Anträgen können auch Anfragen im Stadtrat gestellt werden, die von der Verwaltung innerhalb
einer gewissen Frist (drei Wochen oder drei Monate) zu beantworten
sind. Es waren vor allem Stadträt*innen der Grünen Partei, die das Thema (obdachlose) EU-Migrant*innen auf den Tisch gebracht haben und
am Ball blieben. Auf ihre in den Jahren 2006, 2010 und 2012 gestellten
Anfragen und Anträge zum Thema EU-Migration werde ich in diesem
Kapitel immer wieder zurück kommen.86 Die Wohnungslosigkeit von
neu zugewanderten Unionsbürger*innen stellte – neben der Schaffung
neuer Beratungsprojekte, dem Umgang mit Betteln, mit Prostitution,
mit ‚wildem Campieren‘ (Landeshauptstadt München, 2014: 14) und gesundheitlicher Versorgung – ein zentrales Unterthema des sich neu formierenden städtischen Politikbereichs ‚Armutszuwanderung‘ dar. Das
Stichwort ‚Armutszuwanderung‘ tauchte aber, wie ich zeigen werde,
erst im Jahr 2012 auf.
Die Kommune ist nicht der einzige Akteur der Obdachlosenhilfe in
München. Auch die verschiedenen freien Träger, also christliche und
unabhängige Wohlfahrtsinstitutionen, die neben Unterkünften auch
86
Auch der Stadtrat der ausländerfeindlichen Bürgerinitiative Ausländerstop (BIA) stellte Anfragen, die im weitesten Sinne auch mit EU-Migration
zu tun hatten, von mir in diesem Kapitel aber nicht behandelt werden, so etwa
„Sinti und Roma in München – aktuelle Situation“ vom 13.09.2011 und „Tuberkulose-Risiko durch Tausende Sinti und Roma aus Bulgarien?“ vom 25.10.2012.
Die Anfrage eines CSU-Angeordneten zum „Bettlerproblem im Bahnhofsviertel“ vom 30.06.2009 behandle ich auch nicht.
187
�Aufenthalts- und Beratungsstellen, Streetwork-Projekte, Teeküchen,
etc. betreiben, sind beteiligt. Bis auf die ausschließlich von der katholischen Kirche finanzierten Angebote für Obdachlose bei St. Bonifaz,
sind sie alle von der Stadt (ko-)finanziert. Wie noch deutlich werden
wird, war die enge Zusammenarbeit nicht immer konfliktfrei. So berichtete ein Mitarbeiter einer der Einrichtungen, dass es durchaus zu
Unmut gekommen wäre, als die Stadt seiner Einrichtung bekannt gegeben hätte, dass sie ihre Zielgruppe auf „ortsansässige“, „klassische“
Obdachlose begrenzen und migrantischen Obdachlosen ohne Arbeitsvertrag den Zugang verweigern sollte. Im Laufe des untersuchten Zeitraums kamen einige weitere Stellen hinzu, die (auch) hilfesuchende und
obdachlose Unionsbürger*innen zur Zielgruppe haben: erst das Projekt
Bildung statt Betteln der Caritas, dann das im vorherigen Kapitel bereits
erwähnte Infozentrum Migration und Arbeit der Arbeiterwohlfahrt und
schließlich die Migrationsberatung Wohnungloser Schiller 25 des Evangelischen Hilfswerks.
Politische Paradigmen
Das städtische Regime, dem die EU-Migration zum Problem wurde,
knüpfte an vorhandene Paradigmen an: zum einen an das Prinzip Wohnen statt Unterbringen (Wohnungs- und Flüchtlingsamt, 2002), das die
Wohnungslosenpolitik seit Anfang der 2000er Jahre prägt und zum anderen an das ebenfalls als sehr fortschrittlich geltende Münchner Integrationskonzept (Landeshauptstadt München, 2008) und seine Leitidee,
das Migration in München erwünscht sei. Das Integrationskonzept wurde 2008 vom Stadtrat einstimmig beschlossen und zuvor von der Stelle
für interkulturelle Arbeit entwickelt. Mit dem Konzept „bekennt sich
München zur Vielfalt in all ihren Facetten und begreift Migration als
einen selbstverständlichen Prozess in einer Einwanderungsgesellschaft“
(ebd.: 7). Grundlage ist die Definition Münchens als Einwanderungsstadt und ein potenzialorientierter Umgang mit Vielfalt.
„Einwanderung ist und bleibt ein gesellschaftliches Faktum in München und wird auch in Zukunft die Entwicklung der Stadt maßgeblich
mitbestimmen. Migration ist erwünscht und notwendig und stellt eine
Chance für eine dynamische Stadtentwicklung dar.“ (ebd.)
188
�Das Konzept baut auf der Prognose auf, dass Städten geopolitisch immer mehr Bedeutung zukomme und sie zunehmend von Einwanderung
geprägt seien:
„Der Globalisierungs- und Erweiterungsprozess der EU sowie die
wachsende internationale Bedeutung des Standortes München wird
die Präsenz von Menschen unterschiedlicher Nationen und kultureller
Prägungen in der Stadt weiter fördern.“ (ebd.)
Ziel sei es, zu einer „sozial integrierten europäischen Stadt“ (ebd.: 16,
Hervorhebung durch Autorin) zu werden. Dabei wären sowohl die „aufnehmende Gesellschaft“ (ebd.: 23) als auch die „Zugewanderte[n]“ (ebd.:
13) gefordert:
„Unser Integrationsverständnis respektiert und wertschätzt kulturelle
Vielfalt und fördert die in der Vielfalt liegenden Potenziale. Integration
wird als wechselseitiger Prozess verstanden, der Menschen ohne und
mit Migrationshintergrund, Mehrheit wie Minderheiten betrifft. Daher
richtet sich das kommunale Integrationskonzept an alle Akteurinnen
und Akteure in der Stadtgesellschaft, gleich welcher Herkunft, um gemeinsam und gleichberechtigt die Zukunft unserer Stadt zu gestalten.“
(ebd.: 12)
Der Prozess der Integration basiere darauf, „gemeinsame freiheitlichdemokratische Normen und Regeln“ (ebd.: 16) anzuerkennen, die Potenziale von Vielfalt zu nutzen und Diskriminierung und Rassismus
entgegen zu wirken. Die Ziele des Integrationskonzeptes, allen voran
die „interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung“, sollten mit den Instrumenten der „strategischen Steuerung“ umgesetzt werden.
Mathias Rodatz (2014) hat für Frankfurt a.M. und Stephan Lanz (2009)
für Berlin erforscht, wie die dortigen städtischen Integrationskonzepte implementiert und debattiert wurden. Beide zeigen, wie die Auseinandersetzungen um die städtischen Integrationspolitiken von der
konservativen Verteidigung des Einwanderungsstopps, antirassistischen
Forderungen nach gleichen Rechten und der neoliberalen Potenzialorientierung geprägt waren und wie sich die letztere Figur besonders stark
einschreiben konnte. Während Rodatz sich für das ‚Innen‘ des Feldes,
für die Potenziale der vielfaltorientierten Wende der Migrationspolitik
189
�interessiert, streift Lanz durchaus auch die Frage, was für ein ‚Außen‘
der Integrationsdiskurs produziert. Nach dem Prinzip „Fordern und Sortieren“ (Lanz, 2009) fördere der Staat die Integration „würdiger“ Gruppen, gebe aber „unwürdige“ Gruppen tendenziell auf und unterstelle
sie einer repressiven Kontrolle (vgl. ebd.: 112). Dabei folge er neoliberalen Verwertungslogiken im Sinne der „Ökonomisierung des Sozialen“
(Bröckling, Krasmann & Lemke, 2000; Foucault, 2000):
„Der Aktivierungsimperativ, der Individuen als unternehmerische, für
ihre materielle Existenz selbst verantwortliche Subjekte adressiert und
sie bei Bedarf mit Hilfe repressiver Sanktionsinstrumente zu einem Job
verpflichtet, bildet den neoliberalen Kern des aktuellen Integrationsdiskurses.“ (Lanz, 2009: 112)
Dieser Prozess verwandele „das sozialstaatliche Recht auch Armer auf
ein selbstbestimmtes Leben in ihre Pflicht […], zu einem selektiv definierten ‚Gemeinwohl‘ beizutragen“ (ebd.: 111). Der Begriff Integration
impliziere nicht rechtlich-politische Ansprüche, sondern soziokulturelle staatliche Fürsorge und die Verantwortung des Einzelnen; er blende
Herrschafts- und Kontrollanspruch aus und assoziiere Gerechtigkeit
und Ausgleich (vgl. auch Bojadžijev & Ronneberger, 2001).
Natürlich können diese Ergebnisse nicht pauschal auf München übertragen werden. Neben deutlichen Zielsetzungen gegen Diskriminierung
und Rassismus nimmt aber auch im Münchner Integrationskonzept die
Potenzialorientierung sehr viel Raum ein. In ihm wird auch deutlich,
dass nicht alle Migrant*innen zur Zielgruppe der Integrationsbemühungen gehören. Diese schließt zwar nicht nur „Zuwanderinnen und Zuwanderer mit einer dauerhaften Bleibeperspektive“ (Landeshauptstadt
München, 2008: 10) ein, sondern auch „Flüchtlinge, die gegebenenfalls
in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollen oder müssen“ (ebd.). Für
„Menschen, die ohne gültige Papiere in München leben“ (ebd.) gelte das Konzept aber nicht; trotzdem sei es Ziel, „die humanitäre Situation dieser Menschen zu verbessern“ (ebd.). Von Armut betroffenen
EU-Migrant*innen waren für die mit Integration befassten Stellen der
Stadt München lange kein Thema. Sie wurden bis zu einem Antrag
der Grünen im Stadtrat im Jahr 2012, das Integrationskonzept auf sie
zu erweitern, nicht unter der Perspektive Integration wahrgenommen
(vgl. Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste, 2012). Und auch die von
190
�dem Antrag mit angestoßenen Auseinandersetzungen in der Münchner
Kommunalpolitik sollten zur Ausgrenzung der als unwürdig befundenen ‚Armutszuwander*innen‘ aus der Zielgruppe des Integrationskonzepts führen, da ihnen Potenzial bzw. ‚Perspektiven‘ fehlten, wie gezeigt
werden wird.
Paradigmenwechsel „Wohnen statt Unterbringen“
– from welfare to workfare?
Im Jahr 2001 wurde ein Paradigmenwechsel der städtischen Wohnraumpolitik eingeleitet, der heute unter dem Motto Wohnen statt Unterbringen bekannt ist und auch weiterhin fortgeschrieben wird (vgl. Amt für
Wohnen und Migration, 2012b; Wohnungs- und Flüchtlingsamt, 2002).
Langfristiges Ziel war, wie das Motto schon sagt, Notunterkünfte abzuschaffen (weil diese sozial nicht zu tragen seien), und Obdachlose (jedenfalls diejenigen, für welche die Stadt sich zuständig sieht) stattdessen
schnellstmöglich in reguläre Wohnungen zu vermitteln. Hintergrund
der Neuausrichtung stellt eine Krise der sozialen Wohnraumpolitik dar,
die die Stadtpolitik im Jahr 2001 in Aufregung versetzte. Während „seit
Beginn der neunziger Jahre […] über 30.000 Wohnungen aus der sozialen Bindung gefallen“ waren (Amt für Wohnen und Migration, 2011:
49), so die Schrift zum hundertsten Geburtstag des Wohnungsamtes,
schnürte der Bund im Jahr 2000 ein Sparpaket, das die Förderung des
sozialen Wohnungsbaus stark kürzte. Auch „[d]urch das wirtschaftliche
Wachstum der Landeshauptstadt wurde preiswerter Wohnraum immer
knapper, die Neubauraten im öffentlich geförderten Mietwohnungsbau
gingen zurück“ (ebd.: 49). Als Folge waren „die Vermittlungsmöglichkeiten in dauerhaftes Wohnen […] begrenzt“ (ebd.: 48). Über 2.200 obdachlose Menschen lebten in Notunterkünften und die Zahl war im Steigen
begriffen (vgl. ebd.). Im Mai 2001 berief der damalige Oberbürgermeister
einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse zum Thema Wohnungslosigkeit ein, der „so schnell wie möglich ausreichend Kapazitäten für
die Unterbringung von Wohnungslosen“ (ebd.: 49) schaffen sollte.
Innerhalb einiger Monate wurden 1.738 Notbetten in provisorischen
Bungalows und Containern aufgestellt (vgl. ebd.). Im September 2001
fand die ‚Aufbruchs‘-Fachtagung in Tutzing statt, die zum Münchner Gesamtplan Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe
191
�(Wohnungs- und Flüchtlingsamt, 2002) sowie zum Handlungsprogramm Wohnen in München III (Referat für Stadtplanung und Bauordnung, 2001) führte und somit den Paradigmenwechsel Wohnen
statt Unterbringen markierte, der bundes- und europaweit Beachtung
gefunden habe (vgl. Amt für Wohnen und Migration, 2011: 50). Ziel
war, wie gesagt, obdachlose Personen so schnell wie möglich in längerfristigen Wohnraum zu vermitteln. Im Detail stieß der Paradigmenwechsel verschiedene Schritte und Prozesse an. Unter anderem
sah er kommunal finanzierte Wohnungsbauprogramme für Benachteiligte sowie spezielle Einrichtungen und betreute Wohnformen
für „psychisch kranke oder suchtkranke bzw. pflegebedürftige wohnungslose Menschen“ (ebd.) vor. Im Mittelpunkt stand die lückenlose
Betreuung und Veränderung des Verhaltens der Obdachlosen: „Clearinghäuser“ (ebd.) sollten die „Wohnperspektive“ (ebd.) von wohnungslosen Haushalten abklären und die Betroffenen schnell in dauerhaften Wohnraum weitervermitteln. „[P]räventive Maßnahmen im
Bereich der Sozialarbeit“ (ebd.) – z.B. die „Konzeption der sozialorientierten Hausverwaltung“ (ebd.) – sollten bedrohte Mietverhältnisse erhalten und die Stabilität von Wohngebieten mit „besonderem
sozialpolitischen Handlungsbedarf“ (ebd.) sollte durch „quartiersbezogene Bewohnerarbeit“ (ebd.) gefördert werden. Obdachlose Personen wurden unter einer neuen Perspektive betrachtet und zu einem ganz neuen Subjekt der Wohnungslosenhilfe. Statt einfach nur
Bedürftigen Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, wurde das ganze
Leben und die Verhaltensweisen der Obdachlosen zur Aufgabe der
Wohnungslosenpolitik. Es ging nun darum, die ‚sozialen Probleme‘
der Obdachlosen und auch der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen zu lösen, ihre ‚Potenziale‘ zu fördern und sie zu ‚verantwortungsvollem Handeln‘ zu aktivieren, so dass sie Wohnraum finden
und halten könnten. Viele dieser Aufgaben wurden an Wohlfahrtseinrichtungen ausgelagert, die als „gut vernetztes System“ (Amt für
Wohnen und Migration, 2011: 52) dazu beitrügen:
„dass die städtischen Unterbringungsmöglichkeiten nicht überlastet
werden und dass ein großer Teil des in der Regel mit großen sozialen
Problemen behafteten Personenkreises einem adäquaten Betreuungssetting zugeführt werden kann. Das umfangreiche Angebot der Verbände erstreckt sich auch auf ambulante Einrichtungen und Maßnah-
192
�men, wie z.B. die Aufsuchende Sozialarbeit im Sozialraum, Angebote
im Bereich Arbeitslosigkeit, Beratung und Programme zum Thema
Sucht, das Bereitstellen von Kleiderkammer, Wohn- und Finanztraining, etc.“ (ebd.)
In anderen Worten: Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe wurden
von Einrichtungen der Grundversorgung im Sozialstaat zu aktivierenden Durchlaufstationen umdefiniert. So reiht sich dieser Paradigmenwechsel nahtlos in den transnationalen Prozess der Umstrukturierung
der Sozialsysteme um die Jahrtausendwende ein. Es ging darum, „das
Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung um[zu]wandeln“ (Schröder & Blair, 1999), wie der damalige
britische Premierminister und der damalige Bundeskanzler der BRD in
einer gemeinsamen Veröffentlichung, die die Eckpunkte ihrer Vision
einer sozialdemokratischen neuen Mitte absteckte, schon im Jahr 1999
proklamatisch festgestellt hatten. Mit dem Paradigma Wohnen statt Unterbringen sprang München auf diesen Zug auf, noch bevor im Februar
2002 die Hartz-Kommission eingesetzt wurde, die Bundesregierung im
März 2003 die Agenda 2010 verkündete und mit der Hartz IV Reform
und ihrem Slogan Fördern und Fordern im Dezember 2003 das Kernstück
der Sozialreform auf Bundesebene beschlossen worden war. Im siebten
Kapitel werde ich unter dem Stichwort workfare (vgl. Lanz, 2009b; Peck,
2001; Wacquant, 2011) noch einmal genauer auf diesen Prozess, mit dem
sich soziale Sicherungseinrichtungen in Aktivierungsprogramme umwandeln, eingehen.
Das damalige Wohnungs- und Flüchtlingsamt reagierte auch, indem
es die Verpflichtung zur Unterbringung sehr eng auslegte und neue
Schranken errichtete. Im November 2001 erließ es eine neue Dienstanweisung (vgl. Wohnungs- und Flüchtlingsamt, 2001): Obdachlose
mussten von nun an als Voraussetzung für die Unterbringung eine
Münchner Meldebestätigung vorlegen.87 Waren sie bis zum 7. November 2001 nicht polizeilich in München gemeldet gewesen, bekamen sie
höchstens ein Ticket in eine andere deutsche Gemeinde. Dies traf neue
Münchner*innen und Personen in extrem prekären Wohnverhältnissen,
die mangels eines Mietvertrages sich nicht hatten anmelden können.
87
„Obdachlose Personen, die bis zum 07.11.2001 nicht in München angemeldet waren, werden in der Fachstelle nicht mehr untergebracht“ (Wohnungsund Flüchtlingsamt, 2001).
193
�Es ist anzunehmen, dass nicht wenige Obdachlose aufgrund von dieser
Regelung nicht mehr untergebracht und so auch erst gar nicht zum
Objekt der Aktivierungsmaßnahmen wurden. Das Verwaltungsgericht
sollte diese Regelung allerdings kurz darauf als rechtswidrig erklären.
Die Anwältin der obdachlosen Person, die gegen die Regelung klagte,
war keine Unbekannte, sondern ehemalige Münchner Stadträtin für
die Grünen und Richterin am Bayerischen Verfassungsgericht. Sie hatte schon öfters Klagen gegen staatliche Repression geführt. Hier klagte
ein Obdachloser gegen das Wohnungsamt, nachdem er anhand der
neuen Dienstanweisung von 2001 abgelehnt worden war, weil er in
München nicht polizeilich gemeldet gewesen war. Etwa einen Monat,
bevor er die Klage erhob, war er nach München zurückgekehrt. Zuvor
hatte er seinen Aufenthalt in München für etwa sechs Wochen wegen
einer Arbeitsstelle in einer anderen Gemeinde unterbrochen, dort ein
Zimmer gemietet und sich polizeilich gemeldet. Zurück in München
war er bei einer Bekannten untergekommen oder hatte sich im Freien
aufgehalten. In seinem Urteil88 legte das Bayerische Verwaltungsgericht dar, dass der Umgang mit Obdachlosigkeit im Zuständigkeitsbereich der Kommunen liege. Dies ergebe sich aus dem Landesstraf- und
Verordnungsgesetz und der Bayerischen Gemeindeordnung. Diese
verpflichteten die Gemeinden nämlich, Gefahr für Leib und Leben abzuwenden. Dann wendet es sich der Frage zu, welche Gemeinde zuständig für die Unterbringung ist. Bei der Beurteilung dieser Frage
ginge es weder darum, wo „er früher einmal den Schwerpunkt seiner
Lebensverhältnisse hatte“, noch darum, „ob und gegebenenfalls wo die
obdachlose Person gemeldet war“.89 Es kommt zu dem Schluss, dass
„der Betreffende durch Gebrauchmachen von dem auch ihm zustehenden Grundrecht der Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 Grundgesetz -GG)[sic] in gewissem Umfang aber Einfluss darauf nehmen [kann], wo die
Obdachlosigkeit eintritt.“90 Die rechtliche Verpflichtung der Kommunen,
unfreiwillig Obdachlose unterzubringen, ergibt sich interessanterweise
nicht aus dem Sozial-, sondern aus dem Sicherheitsrecht. Denn Obdachlosigkeit gilt in der rechtsinternen Logik als Gefahr für die grundgesetz88
Bayerisches Verwaltungsgericht München, B. v. 06.12.2001 - M 6a E
01.5884. (2. Instanz: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 07.01.2002 - 4 ZE
01.3176.)
89
Vgl. Fn. 83.
90
Vgl. Fn. 85
194
�lich gesicherten Rechtsgüter der Menschenwürde, Gesundheit, Schutz
der Familie etc. und ist damit als Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung einzuschätzen (vgl. auch Ruder, 2015). Bei einer solchen
Gefahr ist die Kommune als zuständige Sicherheitsbehörde verpflichtet einzugreifen und (der Obdachlosigkeit) Abhilfe zu verschaffen. Das
klingt erst einmal sehr einfach und scheint wenig Spielraum zu lassen.
Diese Verpflichtung wird aber nicht nur in der Praxis ignoriert (wie der
weiter oben beschriebene Versuch, eine Unterbringung zu beantragen,
gezeigt hat), sondern es haben sich (wie die folgenden Analysen zeigen werden) auch mehrere Argumentationslinien entwickelt, mit denen
das Amt für Wohnen und Migration, das hier als Sicherheitsbehörde
tätig wird, behauptet, dass es in gewissen Fallkonstellationen nicht für
die Unterbringung von Obdachlosen zuständig ist. Durch den Paradigmenwechsel Wohnen statt Unterbringen verschiebt sich der Fokus von
der sicherheits- zur sozialpolitischen Dimension der Wohnungslosenpolitik. Es findet also auch hier, wie bei der Versicherheitlichung des
‚Tagelöhnermarkts‘, eine Verschiebung von Politikfeldern statt. Interessanterweise wird aber nicht eine soziale Problemstellung versicherheitlicht, sondern ein sicherheitsrechtliches Politikfeld wird zum Problem
der Sozialpolitik gemacht, die wiederum gleichzeitig im Sinne des Aktivierungsparadigmas ökonomisiert wird. Als Erfolg des Paradigmenwechsels zu Wohnen statt Unterbringen, der neben einem neuen Wohnbauprogramm, der Verschärfung der Aufnahmekriterien und der engen
Zusammenarbeit mit zivilen Organisationen insbesondere die aktivierende, enge Betreuung der Wohnungslosen eingeführt hat, wurde 2006
die letzte Kontaineranlage abgebaut. Im Jahr 2008 erreichte die Zahl der
Obdachlosen ihren Tiefstand mit 1.700 untergebrachten Personen, so
der Bericht zum hundertjährigen Geburtstag des Wohnungsamts (vgl.
Amt für Wohnen und Migration, 2011: 58).
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Münchner Wohnraum- und Integrationspolitik zu dem Zeitpunkt, als die EU-Migration der Stadtpolitik
zum Problem wurde, als städtische Inklusions- und Aktivierungspolitik
gelesen werden kann, die Abstand nahm von einer Politik des Einwanderungsstopps und einem vernachlässigenden Umgang mit Obdachlosen. Stattdessen folgte sie der neoliberalen Logik der Aktivierung, die
soziale Rechte und sozialpolitische Programme zu Aktivierungsinstrumenten umfunktioniert. Diese Politik war durchaus mit scharfen Grenzziehungen kombinierbar, wie der Ausschluss von undokumentierten
195
�Migrant*innen aus der Zielgruppe des Integrationskonzeptes und nichtangemeldeter Personen aus den Notunterkünften zeigt. Im Folgenden
wende ich mich der Frage zu, wie die so strukturierte Stadtpolitik auf
unfreiwillig obdachlose EU-Migrant*innen reagierte.
Entdeckung und Definition des Problems
Indem ich eine Auswahl von städtischen Berichten, Entschlüssen, Anfragen und Anträgen aus den Jahren 2006 bis 2014 quer lese und neben ethnografische Erfahrungsberichte und Interviews stelle, kann
ich im Folgenden zeigen, wie die von Obdachlosigkeit betroffenen
Unionsbürger*innen der Kommunalpolitik zum Problem wurden, wie
sehr die Problemdefinition umkämpft war und wie mit Problemlösungen experimentiert wurde.
Anfrage 2006: Einrichtung eines Sondertopfes
Die erste Stadtratsanfrage zum Thema Armut von Unionsbürger*innen
in München erfolgte im Jahr 2006. Der Anlass war eine Änderung der
Sozialgesetzgebung des Bundes. Im Jahr 2006 schloss die Bundesregierung Ausländer*innen, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem
Zweck der Arbeitssuche ergebe und ihre Familienangehörigen vom
Bezug der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) aus.91 Betroffene Ausländer*innen waren somit von dem Recht auf ein Existenzminimum ausgeschlossen. In München fragte die Fraktion Die
Grünen/rosa liste im Stadtrat nach den Konsequenzen des neuen Ausschlusses von arbeitssuchenden Ausländer*innen für die Landeshauptstadt München (vgl. Fraktion Die Grünen/rosa liste, 2006). Die Antwort
des Sozialreferats stellte dar, dass der Ausschluss fast ausschließlich
Unionsbürger*innen betreffe (vgl. Amt für Soziale Sicherung & Amt für
Wohnen und Migration, 2006). Sonst wäre nur die relativ kleine Gruppe
der Drittstaatler*innen, die nach erfolgreichem Abschluss ihres Studi91
Die Regelung schließt im Wortlaut „Ausländerinnen und Ausländer,
deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt, und
ihre Familienangehörigen“ von den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II
aus (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II).
196
�ums in Deutschland über eine Aufenthaltserlaubnis verfügten, betroffen
(vgl. ebd.). Die Landeshauptstadt unterstützt also die Ausschlusspolitik
des Bundes und richtet sich somit an den staatlichen Grenzziehungen
von Bürgerschaft aus.92 Auch von Seiten der Kommune würden keine
Leistungen gezahlt werden, denn dies
„stünde [...] im Gegensatz zur Absicht des Gesetzgebers, der durch die
gesetzliche Neuregelung ausschließt, dass EU-Ausländer/-innen mit
ihrer Familie zwar zum Zweck der Arbeitssuche einreisen und sich
hier aufhalten, tatsächlich aber steuerfinanzierte Transferleistungen
für den Lebensunterhalt beziehen.“ (ebd.: 12)
Schon ganz am Anfang der städtischen Problematisierung von
Unionsbürger*innen in München klingt also die Figur des ‚Sozialleistungstourismus‘ an. Der Ausschluss sei legitim, denn es sei
„ausgeschlossen, dass ein freizügigkeitsberechtigter EU-Bürger nicht in
sein Heimatland zurückkehren kann. Sofern ein EU-Bürger nicht in
seine Heimat zurückkehren will, etwa weil er den Aufenthalt in der
Bundesrepublik aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen einer
Rückkehr in sein Heimatland vorzieht, hat der Gesetzgeber mit der
oben beschriebenen Regelung im SGB II [...] festgelegt, dass der Lebensunterhalt in Deutschland selbst finanziert werden muss.“ (ebd.:
11)
Neben dieser ablehnenden Haltung räumt das Sozialreferat in der Antwort auf die Anfrage der Grünen und der rosa liste aber ein, für die
Unterbringung obdachloser Personen und für die dadurch entstehenden
Kosten unabhängig von Leistungsansprüchen und Aufenthaltsstatus
92
Im sechsten Kapitel wird sich zeigen, dass die Stadt hier durchaus
auch die Möglichkeit gehabt hätte, den Ausschluss zu kritisieren und anzugreifen, da er lange gegen EU-Recht verstieß. Das siebte Kapitel, in dem die
Gesetzesverschärfung auf Anstoß des Städtetags im Jahr 2013 nachvollzogen
wird, zeigt, wie die Städte, unter ihnen München, sich in einem einflussreichen
Positionspapier an der Exklusionslogik des national-sozialen Staates ausrichten und nicht an den Europäisierungsprozessen orientieren, indem sie verlangen, ‚Armutszuwanderung‘ effektiver zu bekämpfen, statt den sogenannten
‚Armutszuwander*innen aus Südosteuropa‘ soziale Rechte zu gewährleisten.
197
�zuständig zu sein.93 Gleichzeitig moniert es eine „Verlagerung von Kosten vom Bund auf die Kommune“ (ebd.: 12), denn der Bund trage bei
Hartz IV-Empfänger*innen 29,1 Prozent der Kosten der Unterkunft. Um
diese Mehrkosten decken zu können, richtete der Stadtrat einen Sondertopf von 100.000 Euro im Jahr ein (ebd.: 13) - der Sondertopf, der mir
vier Jahre später im Amt begegnete. Damit sei das Problem aber nicht
gelöst, erklärt das Sozialreferat, sondern eine Reihe neuer Probleme
entstünden, denn die von Sozialleistungen Ausgeschlossenen verfügten
dann zwar über eine Unterkunft, aber über kein Einkommen. Das Referat rechnet zu diesem Zeitpunkt trotzdem mit keiner „längerfristigen
Problematik“ (ebd.: 12), es gehe „nicht davon aus, dass es zur völligen
Verarmung von ausländischen Familien kommen wird“ (ebd.). Stattdessen werde es „zu einem gewissen Abschreckungseffekt kommen,
durch den die Zahl der zum Zweck der Arbeitssuche zuziehenden EUAusländer/-innen zurückgehen wird“ (ebd.); es vermutet also, dass eine
Rücknahme sozialer Rechte zu einem „Abschreckungseffekt“ führe. Die
Annahme, dass die Einschränkung sozialer Rechte ein wirksames Instrument zur Steuerung von Migration darstelle, sollte in den folgenden
Aushandlungen immer wieder eine Rolle spielen, obwohl der Zuzug von
Unionsbürger*innen auch nach dem Ausschluss aus dem Hartz IV steigen und somit diese erste Prognose schnell widerlegen sollte und auch
die migrationspolitischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte das Gegenteil versprachen.
Zu erwähnen bleibt, dass die Antwort des Sozialreferats nicht den
Ausschluss von in München lebenden Menschen von ihrem Recht auf
ein Existenzminimum durch den Bund zum Problem macht, sondern
vielmehr die „psychischen Probleme“ (ebd.: 2) derjenigen, die trotz
Verarmung nicht ausreisen könnten,94 und die „besonderen sozialen
Schwierigkeiten“ (ebd.: 11) derjenigen, die „bisher keiner zwölfmonatigen ununterbrochenen Erwerbstätigkeit nachgehen können“ (ebd.)
93
„[D]ie Landeshauptstadt München [ist] – unabhängig von Leistungsansprüchen nach dem SGB II oder SGB XII – bei Wohnungslosigkeit für die
Unterbringung der wohnungslosen Personen nach Art. 6, 7 LStVG zuständig.
Dies gilt auch für arbeitssuchende Ausländerinnen und Ausländer“ (vgl. Amt
für Soziale Sicherung & Amt für Wohnen und Migration, 2006: 2).
94
„Derzeit kann allerdings noch nicht gesagt werden, welche Auswirkungen die gesetzliche Änderung auf den Personenkreis hat, der z.B. wegen
psychischer Probleme nicht ausreist“ (vgl. Amt für Soziale Sicherung & Amt
für Wohnen und Migration, 2006: 12).
198
�und somit keinen Anspruch auf soziale Leistungen hätten. Gleichwohl
sah sich die Stadt zu diesem Zeitpunkt noch in der Pflicht, obdachlose
Ausländer*innen unabhängig vom Anspruch auf soziale Leistungen unterzubringen und gab auch finanzielle Mittel hierfür frei.
Während diese Anfrage als Reaktion auf eine Gesetzesänderung auf
Bundesebene gestellt wurde, ging die nächste Anfrage drei Jahre später
von einer konkreten Situation aus.
Anfrage Untersbergstraße 2009/2010: ‚Münchner
Problemhaus‘?
Im Oktober 2009 stellten Stadträt*innen der Grünen Partei eine Stadtratsanfrage, um auf einen Skandal aufmerksam zu machen:
„In München leben derzeit allein in einem Arbeiterwohnheim eines
privaten Vermieters in der Untersbergstraße schätzungsweise 500 Menschen aus Südosteuropa in teils prekären Verhältnissen. Seit geraumer
Zeit leben dort auch zunehmend mehr Familien mit Kindern.“ (Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste, 2009)95
Sie stellten (etwa drei Jahre, bevor die Figur ‚Armutszuwanderung‘ hegemonial werden sollte) die prekären Wohnverhältnisse in Zusammenhang mit der europäischen Freizügigkeitsregelung, im Zuge deren „deutsche Städte einen vermehrten Zuzug von Menschen z.B. aus Rumänien
und Bulgarien“ (ebd.) verzeichneten. Sie verwiesen auch darauf, dass
die Stadt möglicherweise verpflichtet sei, die Menschen unterzubringen
und auf den 2006 für solche Verpflichtungen gegründeten Sondertopf.
Außerdem fragten sie nach der sozialen und rechtlichen Situation der
(minderjährigen) Bewohner*innen des Wohnheims, nach dem Umgang des Münchner Sozialreferats und des Kreisverwaltungsreferats
95
Das Haus in der Untersbergstraße, inzwischen abgerissen, hatte eine
bewegte Geschichte. In den 1990ern diente es als staatliche Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, später als privates Wohnheim, aber auch die LHS
mietete dort Plätze zur Notunterbringung von Obdachlosen an. Mir war das
Haus nicht nur bekannt, weil bis zum Abriss 2012 immer wieder bulgarische
Arbeitnehmer hier unterkamen, sondern auch, weil Werkvertragsarbeiter, die
ich im Rahmen meiner Forschung für Crossing Munich begleitet hatte, hier gewohnt hatten.
199
�mit ihrer spezifischen Situation und nach den Reaktionen anderer
deutscher Städte auf den „vermehrten, nicht geregelten Zuzug“ (ebd.).
Der Sozialreferent leitete die Antwort damit ein, dass hier jenes Problem deutlich werde, dass die Unionsbürger*innen freizügig seien,
vom Bundesgesetzgeber als Arbeitssuchende von Leistungen ausgeschlossen würden, aber von der Stadt untergebracht werden müssten
(vgl. Sozialreferat, 2009). Dann erfolgte eine Situationsbeschreibung,
die auf der Schilderung von Sozialarbeiter*innen und den Betreibern
der Untersbergstraße beruht: In dem Arbeiterwohnheim seien etwa
55 Zimmer von Bulgar*innen belegt, wobei bis zu sechs Personen in
einem Zimmer unterkämen. Unter den Bewohner*innen seien 60 Kinder, deren Lage von Sozialarbeiter*innen als kindeswohlgefährdend
eingeschätzt werde. Die Bewohner*innen des Wohnheims seien teilweise schon ein bis drei Jahre in München angemeldet. Es sei nicht
bekannt, wie sie ihren Lebensunterhalt bestritten.96 Sie hätten keine
Ansprüche auf Sozialleistungen und „[a]ufgrund mangelnder beruflicher Qualifikationen und Sprachkenntnisse […] keine Chance […], auf
dem Arbeitsmarkt unterzukommen und sich hier zu integrieren“ (ebd.:
4f). Das Sozialreferat legte ihnen, „soweit es ihnen nicht gelungen ist,
Arbeit zu finden, die Heimreise nahe“ (ebd.: 7), für diese erhielten sie
„[g]egebenenfalls […] auch Beratung und Unterstützung“ (ebd.). Eine
Unterbringung durch die Stadt sei zwar nicht grundsätzlich vorgesehen, aber „sollten Haushalte von sich aus auf das Amt für Wohnen
und Migration zukommen mit der Bitte um Unterbringung, so werden
die Haushalte befristet im Notunterbringungssystem untergebracht“
(ebd.). Diesen Satz, der die Bereitschaft zur Unterbringung ausdrückt,
hatte ich im Amt für Wohnen und Migration zitiert, um für Sebahattin
Yankov und Hristo Vankov eine Notunterbringung durchzusetzen.
Weiter stellt das Antwortschreiben fest, dass die Information des Sozialleistungsbezugs (bzw. der Notunterbringung) der Ausländerbehörde
übermittelt werde, welche dann prüfen werde, „ob der Verlust der Freizügigkeit festgestellt werden kann und ob eine Ausreisepflicht besteht.
Allerdings weist die Ausländerbehörde darauf hin, dass dies nur in
96
Dass die Bewohner*innen über ein Einkommen verfügen mussten,
weil die Mieten extrem hoch und im Voraus zu zahlen waren, wurde nicht
erwähnt. Die Preisliste des A1-Wohnheims in der Untersbergstraße von 2010
zeichnet 897,20 netto pro Monat für ein Vier-Bett-Zimmer aus. Mir liegt eine
Rechnung von 2012 vor, die für einen Monat pro Person 820 Euro berechnet.
200
�seltenen Fällen zur Ausreise der Betroffenen führen wird“ (ebd.), denn
die Ausreisepflicht gehe mit keiner Wiedereinreisesperre einher. Auch
eine „aufwändige Aufenthaltsbeendigung mit Ausübung unmittelbaren
Zwangs durch die Polizei trägt somit nicht zu einer nachhaltigen Problemlösung bei“ (ebd.: 6), so das Sozialreferat.97
Des weiteren legt das Schreiben dar, dass weder im Deutschen noch
im Bayerischen Städtetag „die Frage des Umgangs mit diesem Problem“
(ebd.: 7) bisher aufgegriffen worden sei. Als das Sozialreferat das Thema
in die Sozialamtsleitertagung eingebracht habe, habe „sich ergeben, dass
dieses Problem zwar in einer Reihe von Städten auftritt, dies aber bislang nicht zu weitergehenden Überlegungen geführt hat“ (ebd.). München kann also durchaus als eine der ersten Kommunen gesehen werden, die eine Thematisierung des „Problems“ anregte.
Das Sozialreferat machte in seinem Papier deutlich, dass es die neuen
Zuwander*innen als „Problem“ wahrnehme und am liebsten los werden
wolle, insbesondere, wenn sie keiner (dokumentierten) Arbeit nachgingen und der kommunalen Einschätzung nach auch keine Aussicht auf
Arbeit hätten – etwa wenn sie über geringe oder keine Qualifikationen
verfügten und kein Deutsch sprächen. Nur widerwillig räumt das Sozialreferat ein, zur Unterbringung verpflichtet zu sein, und gibt zu, dass
eine Aberkennung der Freizügigkeit wenig erfolgversprechend sei.
Das ‚Problem Untersbergstraße‘ zumindest sollte sich schnell lösen,
da der Betreiber des Wohnheims seinen bulgarischen Mieter*innen im
Zuge der öffentlichen Aufmerksamkeit kündigte (vgl. ebd.).
Podiumsdiskussion: „Was unter den Nägeln
brennt...“
Im Mai 2010 (13.05.2010) veranstaltete die Bahnhofsmission im Rahmen
des Kirchentages eine Podiumsdiskussion zum Thema EU-Bürger/innen
zweiter Klasse. Auf dem Podium saßen der Leiter der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit in München, eine Münchner Europaparlamentsabgeordnete (FDP), der Leiter des Amts für Wohnen und Migration und die
Leiterin der Münchner Bahnhofsmission. Es war eine der ersten - wenn
nicht die erste - öffentliche Veranstaltung zum Thema in München.
97
Dies zeigten „mehrere bei der Ausländerbehörde anhängige Fälle von
immer wieder neu einreisenden EU-Staatsangehörigen“ (ebd.).
201
�Einlass bekamen eigentlich nur registrierte Teilnehmer*innen des
Kirchentages. Nachdem sich etwa 20 EU-Migrant*innen mit einigen
Unterstützer*innen und Transparenten vor der Tür aufgestellt hatten,
gewährten ihnen die Organisator*innen aber trotzdem spontan Zugang
zur Veranstaltung. Gerade deswegen sei die Veranstaltung besonders
gelungen gewesen, erklärte die Leiterin der Bahnhofsmission in einem
Interview mit mir im Dezember 2010:
„Was dann die Qualität ausgemacht hat, dass sie mit ihrer Gruppe
kamen, was wir auch nicht geplant hatten. Und was dann ja passiert
ist, das Spannendste, dieser direkte Dialog zwischen [dem Leiter des
Amts für Wohnen und Migration, Anmerkung der Autorin] und den
Betroffenen. Hat ein Mensch in so einer Funktion nicht so oft.“
Der Beitrag des Leiters der Finanzkontrolle, der auf Ausbeutungsverhältnisse hingewiesen hatte, gefiel ihr auch:
„Was der gesagt hat, das fand ich total klasse. Dass es hier einen Markt
gibt. Dass es hier Fünf-Sterne-Hotels gibt, die neu gebaut werden und
dann auf der untersten Schiene der Sub-Sub-Sub-Unternehmer kriegt
1,50 Euro. Ich fand, der hat tolle Positionen vertreten, fand ich persönlich. Auch ein zukünftiger Amtsleiter, der mit am Tisch sitzt, muss sich
das erstmal mit anhören.“
Die Bahnhofsmission, die sie auch als „Seismographin“ bezeichnet, hatte die Veranstaltung als eine ihrer seltenen öffentlichen Aktionen organisiert:
„Es war schnell klar, dass es dieses Thema ist, was uns auf den Nägeln
brennt, wo wir ein Stück weit auch das Gefühl haben, dass wir das
Fähnchen hochhalten und sagen, Leute, hier gibt es ein Problem und es
nimmt erstmal so schnell keiner zur Kenntnis.“
Die Veranstaltung habe mit anderen Faktoren dazu beigetragen, dass
die Situation von Unionsbürger*innen in München auf die kommunalpolitische Tagesordnung gekommen sei:
202
�„Zum einen war es im Sommer auch dieses große Thema mit dem
Sechsmonatsding. Da geht es darum, wer ist hier wohnungslos und
wer kriegt hier was, jetzt für alle? Und dann gehen schriftliche Dienstanweisungen hin und her. Und dann meinetwegen die Anfrage von den
Grünen und dass ver.di drin ist und dass auch die Medien mehr darüber berichten. Öffentlicher Druck über Medienberichterstattung. Das
sind alles schon Faktoren. Die Bahnhofsmission ist da nur ein Element.
Aber ich fand das dann doch auch nicht unwichtig“.
Runder Tisch bei ver.di: „Da sträuben sich sämtliche Haare!“
Ebenfalls im Mai 2010 (19.05.2010) lud die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft in Kooperation mit der Initiative Zivilcourage kommunale Akteure zu einem Runden Tisch ein. Der Einladung waren acht
Arbeiter*innen, ein Stadtrat der Linken, der SPD und eine Stadträtin
der Grünen sowie die Leiterin der Bahnhofsmission nachgekommen.
Daneben nahmen zwei Hauptamtliche des Fachbereichs 13 von der
ver.di und drei Mitglieder der Initiative Zivilcourage, inklusive mir, an
der Veranstaltung teil. In der Vorstellungsrunde waren sich alle einig, dass hier etwas getan werden müsste, und vor allem die Stadt
München gefordert wäre. Es herrschte Aufbruchstimmung. Dann erklärte die Leiterin des Fachbereichs 13 (Besondere Dienstleitungen)
die Gründe hinter der Einladung: „Wir haben da Sachen erfahren, da
sträuben sich sämtliche Haare“. Sie positionierte sich klar auf der Seite
der „Kolleg*innen“ und problematisierte aus deren Perspektive Ausschluss und Diskriminierung. Zum einen gäbe es das „Problem mit
dem Arbeitsrecht“. Darum ginge es hier aber weniger, denn: „Das können wir ganz gut in den Griff kriegen. Wir haben auch schon bisschen was erreicht für einen Teil der Kollegen und sind da auch immer
glücklich“. Als weiteres Problem benannte sie zum einen Rassismus
auf der Straße und Probleme mit dem „Umgang auf den Ämtern“,
der „teilweise auch unmöglich sei“. Als „einen ganz entscheidenden
Punkt“, als „Riesenproblem“ benannte sie schließlich die „Probleme
mit Unterkunft, Wohnen“:
203
�„Weil ein fester Wohnsitz ist Voraussetzung für einen Gewerbeschein und natürlich auch um irgendwelche Sozialleistungen soweit möglich zu kriegen. Also das Wohnungsproblem ist ein Riesenproblem.“
Die folgenden Berichte der EU-migrantischen Kolleg*innen von ihren Erfahrungen unterstrichen diese erste Zusammenfassung. Sie
verlangten zusätzlich einen eigenen Raum als Café bzw. Aufenthaltsraum.
Daraufhin erklärte die Stadträtin der Grünen ihre emotionale Betroffenheit: „Es ist dramatisch, klar, emotional geht es mir sehr
nah. Das war uns auch vorher deutlich. Heute noch mehr, weil
ich Gesichter dazu habe. Vorher war es abstrakt“. Sie nahm aber
durch ihre Einschätzung, „dass wir morgen kein Problem lösen
werden“, der Aufbruchstimmung Wind aus den Segeln. Sie kündigte an, die Probleme kommunalpolitisch zu thematisieren, nämlich
durch einen „runden Tisch [ ] zu der Frage, wie geht man längerfristig damit um, welche längerfristigen Projekte [sind] einzuleiten“. Ähnlich wie die Leiterin der Bahnhofsmission und entgegen
der Ersteinschätzung der Stadt ging sie davon aus, dass diese neue
Form der Migration jetzt unumkehrbare Realität in München wäre:
„Die Gruppe wird immer da sein, die Gesichter werden sich zwar
ändern. Und jeder, der die Wirklichkeit kennt, weiß auch, dass das
nicht zu stoppen ist“. Klar wäre: „Wir brauchen das Amt für Wohnen und Migration wegen den Notunterkünften.“
Dass die Gewerkschaft sich einmischte, hat viel Aufmerksamkeit in
der Kommunalpolitik gefunden. Ihr Einsatz für die migrantischen
Lohnabhängigen und gegen ihren Ausschluss, ihre Ausbeutung und
gegen Rassismus hat sicherlich der Problematisierung der ‚hilfebedürftigen Zuwander*innen‘ als ‚unproduktive Andere‘ entgegengewirkt, denn die Figur des ‚Gewerkschaftsmitglieds‘ ist mit der
Idee von ‚Sozialtourismus‘ nur schwer vereinbar. Nachdem sich die
gewerkschaftlichen Akteure wieder aus den Aushandlungen um
die EU-migrantischen Arbeiter*innen herausgezogen hatten (Anfang 2011), verwiesen nicht nur die Leiterin der Bahnhofsmission,
sondern auch Stadträt*innen und der Leiter des Amtes für Wohnen
und Migration mehrmals darauf, dass ihre Stimme im Jahr 2010 eine
wichtige Rolle gespielt hätte.
204
�Die liberale Perspektive der grünen Stadträtin, die eher auf das Drama
der humanitären Situation fokussierte und feststellte, dass die Migration nicht zu stoppen und deswegen längerfristig anzugehen wäre, sollte
hingegen weiter wirkmächtig bleiben.
Konflikt um Wohnraum II: „Jalla Wohnungsamt!“
Bei einer Bemerkung des Amtsleiters auf der Podiumsdiskussion hatte ich die Ohren gespitzt: Eine Anmeldung reichte zur Unterbringung,
hatte er erklärt! Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und starteten
schon wenige Tage darauf einen Versuch, den Leiter des Amtes beim
Wort zu nehmen. So warteten eines Morgens im Mai 2010 vor dem Amt
für Wohnen und Migration schon etwa 15 Menschen auf mich. Am vorigen Tag hatten wir uns für heute hier verabredet, um ihre Notunterbringung zu beantragen. Der Pförtner des Amtes war auch da und fragte,
ob ich „Lisa“ wäre. Er hätte schon einige Male gefragt, was die Gruppe
wollte und sie hätten gesagt, sie warteten auf „Lisa“. Pembe packte mich
am Arm, mit einer Handbewegung und einem „Jalla!“ - „Auf geht“s! Ich
wollte noch schnell erklären, dass undokumentierte Arbeit hier nicht
als Arbeit gälte und somit nicht erwähnenswert wäre, war aber schon
längst in der Infothek. Ein Tohuwabohu, alle wollten gleichzeitig in die
Räume, aber nur der Eintritt in einzelnen „Haushalten“ war erlaubt,
dazu mussten die Antragstellenden direkt verwandt oder verheiratet
sein. Ich sagte, es wäre bei allen der gleiche Fall. Nach kurzer Zeit kam
ein türkischsprachiger Sprachmittler. Ob irgendjemand sozialversicherungspflichtig gearbeitet hätte? Eine Person sagte ja. Eine Frau, die von
den anderen Mitarbeiter*innen des Amtes respektvoll behandelt wurde, ging von Raum zu Raum, sagte, sie regelte das, wir sollten hoch
kommen. Dann bekamen alle Laufzettel und wir gingen in den ersten
Stock. Oben herrschte wieder Chaos, die Sachbearbeiter*innen schienen überfordert. Die „Haushalte“ mussten einzeln Nummern ziehen
und wurden nach und nach aufgerufen. Ich konnte nicht bei allen sein,
rannte, ebenso wie der Dolmetscher, herum. Die Person von zuvor, sie
schien eine Vorgesetzte zu sein, war auch immer wieder zugegen und
sagte den Sachbearbeiterinnen, sie sollten es nicht so genau nehmen.
Einige nahmen viele Daten auf und ließen die Aussage unterschreiben:
Wo sie vorher gewohnt hätten, ob sie gearbeitet hätten, wann und wo.
Reine Postadressen schienen kein Problem und nicht strafbar zu sein.
205
�Von Bearbeiterin zu Bearbeiterin war die Situation unterschiedlich.
Aber alle schüttelten den Kopf, wieso das auf einmal alles anders wäre?
Einige Sachbearbeiterinnen sagten wieder Dinge wie, nicht dem Staat
auf der Tasche liegen, dass es nicht sein könnte, dass jemand sechs Monate ohne Wohnung gewesen wäre und so gepflegt aussähe, sie kannten
ja „das Klientel“. Auch eine Erzählung von Bussen, die vor dem Amt
gestanden wären und Menschen „ausgespuckt“ hätten, die jeweils einen Zettel in der Hand gehabt hätten, auf dem „Sozialgeld und Sozialwohnung“ gestanden wäre, tauchte mehrmals auf. Eine Sachbearbeiterin wollte ein Schreiben vom Vermieter mit einer Bestätigung, dass der
antragstellende Obdachlose dort nicht mehr wohnen könnte. Da kam
die Vorgesetzte und sagte, das wäre jetzt nicht so wichtig. Schließlich
wurden alle Antragsstellenden für vier bis zwölf Wochen in Notunterkünfte eingewiesen.
Wir sagten weiteren wohnungslosen Personen Bescheid, sie sollten am
nächsten Tag eine Unterkunft beantragen. Wieder wurden alle Antragstellenden ohne Probleme untergebracht. Zwei oder drei Tage später
schloss sich das Fenster aber wieder: Niemand wurde mehr untergebracht. Bei einer Raucherpause vor dem Amt erzählte mir ein Sachbearbeiter einige Wochen später, es hätte wohl Streit zwischen der Chefetage des Jobcenters und der des Wohnungsamts gegeben. Das hätte
drei Tage gedauert, sogar der bulgarische Konsul wäre eingeladen worden, dann hätte das Jobcenter gewonnen, und die Tore wären wieder
geschlossen worden. Leider konnte ich nichts über den Wahrheitsgehalt
dieser Gerüchte herausfinden. Fest stand, dass es für die wohnungslosen, bulgarischen Arbeiter*innen nach wenigen Tagen wieder extrem
schwierig bis unmöglich geworden war, von der Stadt ein Dach über
dem Kopf zu bekommen.
Runder Tisch Hilfebedürftige Zuwanderer*innen
Im Juli 2010 lud das Amt für Wohnen und Migration dann zu einem
Runden Tisch ein. Über 35 Personen von etwa 20 Institutionen, Einrichtungen und Initiativen kamen der Einladung nach und präsentierten sehr unterschiedliche Problematisierungen und Lösungsvorschläge.
Ziel des Runden Tisches war, Problemlagen festzustellen, einen Überblick über bestehende Angebote für EU-Migrant*innen zu erhalten und
Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Der Leiter des Amtes begrüßte
206
�seine „Kolleginnen und Kollegen“. Seit 2007 wäre bundesweit ein Zuzug
zu verzeichnen, der Herausforderungen brächte - er rede betont von
„Herausforderungen“, nicht von „Problemen“. Der Zugang zu Sozialleistungen wäre aber extrem begrenzt, nur bei Erwerbstätigkeit gäbe
es eine Perspektive. Bundesweit bestünde nur in München eine Chance
auf Arbeit.
In der ersten Runde erzählten die einzelnen Einrichtungen von ihren
Erfahrungen. Die meisten betonten die Not und erklärten, dass sie mehr
Finanzen bräuchten. Das Amt für Wohnen und Migration war für viele
der Geldhahn, von dem sie abhängig waren.
Auch ich war als Vertreterin der Initiative Zivilcourage geladen. Meine
Feldnotizen verraten meine eigene Involviertheit: Sie sind eher geprägt
von Notizen dazu, was ich einbringen wollte, als von Beobachtungen.
Einiges habe ich aber doch notiert. Es herrschte ein Potpourri an Informationen und Ideen: Viele Teilnehmer*innen bestätigten, die Situation
hätte sich in den letzten Monaten bzw. Jahren stark verändert. Während
die Bahnhofsmission sagte: Das wäre Migration, das wäre schon immer
so, verwiesen andere abwertend auf die „neuen Qualitäten“, die die „Zuwanderung von Roma und Sinti“ mit sich brächte. Projekte im Heimatland wären am sinnvollsten, um die Migration schon dort zu stoppen.
Auch aus dem Amt kamen teilweise repressive Stimmen: Es wäre nötig,
die Regeln zu verschärfen. Im Jahr 2010 wären schon 625 Millionen Euro
in den Wohnungsbau investiert worden. Für diese Gruppe der hilfebedürftigen Zuwander*innen aus den neuen EU-Beitrittsstaaten käme nur
die „Förderung vor Ort im Heimatland“ und Rückkehrhilfe in Frage. Hilfen in München könnten „hospitalisierend wirken“. Andere Teilnehmende sagten, weil die Teestube Komm obdachlose Ausländer*innen ohne
Arbeitsvertrag nicht mehr aufnehmen dürfte, bräuchte es ein ähnliches
Angebot, eine Teestube mit Fachberatung und Qualifizierungsmaßnahmen für obdachlose Migrant*innen. Menschenhandel müsste bekämpft
werden und Zwangsprostitution, so eine Frau, die sich als Bulgarin und
somit Expertin für den Personenkreis vorstellte: Bei den Roma würden
aufgrund von Armut viele Frauen verkauft werden. Eine etablierte Migrationsberatungsstelle wunderte sich: Es gäbe ja schon viele Beratungsstellen, aber diese Menschen schlügen bei ihnen nicht auf. Ich meldete
mich auch und sagte, meinen Notizen folgend, dass die Rückfahrhilfe nicht ausreichte. Die Leute arbeiteten und nähmen dabei keine Arbeitsplätze weg, sondern ließen die Wirtschaft boomen. Restriktionen
207
�verhinderten die Migration nicht, sondern trieben die Migrant*innen
ins Unsichtbare. Auch ein reines Beratungsangebot reichte nicht aus,
vielmehr müssten Wohnmöglichkeiten geschaffen werden. Am wichtigsten wäre es, den Migrant*innen mit Respekt zu begegnen und das
nächste Mal auch Betroffene einzuladen, statt nur über sie zu sprechen.
Eine grundsätzliche Änderung der Regelungen brachte kaum jemand ins Gespräch; nur Ausnahmeregelungen, mehr finanzielle
Mittel für bestehende und der Aufbau weiterer Beratungsstellen sowie mehr Vernetzung wurden gefordert. Auch konkrete Vereinbarungen wurden keine getroffen. Einige Wochen später schickten die
Organisator*innen ein Protokoll und eine Teilnehmer*innenliste mit
Kontaktdaten per Email an die Teilnehmenden. Einige Monate später kommentierte ein*e Mitarbeiter*in einer Wohlfahrtsorganisation
mir gegenüber desillusioniert: „Wenn das Wohnungsamt einen Runden Tisch einberuft und hinterher erfährt man, dass vorher schon
klar war, dass es noch weiter verschärft wird, dann trägt das auch
nicht weiter zur Motivation bei“. Als ganz so sinnfrei würde ich dieses Treffen aber nicht bezeichnen. Die beteiligten Akteure konnte
hier Netzwerke knüpfen, Informationen beschaffen, Ideen sammeln,
mögliche Partner*innen kennenlernen – kurz gesagt: das Terrain
sondieren.
Um die städtischen Logiken besser verstehen zu können, möchte ich
im Folgenden näher darauf eingehen, mit welchen ‚Problemen‘ sich
der Leiter des Amtes für Wohnen und Migration konfrontiert sah
und welche Begründungen und Lösungsstrategien er im Auge hatte.
Der Amtsleiter: „Jeder ist seines eigenen Glückes
Schmied“
Meine erste Begegnung mit dem Amtsleiter, Mitglied der Grünen
Partei, der die städtische Politik gegenüber Unionsbürger*innen
wohl wie kein anderer prägte, fand während der Podiumsdiskussion EU-Bürger/innen zweiter Klasse statt. Danach sind wir uns immer
wieder auf Veranstaltungen begegnet und ich habe im Juni 2011 auch
ein Interview mit ihm geführt. Er leitete seine Ausführungen immer
mit der Bekräftigung des Integrationskonzepts der Stadt München
208
�ein. Seine Beiträge zur Podiumsdiskussion geben einen guten Eindruck seiner Argumentation:
„Ich will etwas vorausschicken: ein Amt, das sich mit Integrationspolitik zu beschäftigen hat, das ist meine Aufgabe. Die Landeshauptstadt
begrüßt Zuwanderung, wir sind darauf angewiesen und begrüßen sie.
Wir sind daran interessiert, dass, wer zuwandert, sich integriert.“98
Dann ging er auf strukturelle Probleme ein:
„Münchner leiden unter Wohnungsnot, unabhängig ob sie aus Beitrittsstaaten kommen oder nicht. In meinem Amt sind jährlich 20-25.000
Menschen, die sich vorstellen und eine Sozialwohnung beantragen. Wir
vergeben jährlich circa 3.500 Wohnungen. Mehr haben wir nicht. Wir
haben hier ein Problem.“
Sozialdiagnostisch verwies er sowohl auf das Dilemma, in dem neue
Münchner*innen oft stecken - „Es ist manchmal ein Teufelskreis. Keine
Wohnung, keine Arbeit und umgekehrt.“ - wie auch auf die sozialen
Realitäten der working poor:
„Dazu gehören auch die Beitrittsstaaten, das ist gar keine Diskussion.
Polizeilich gemeldet, sie sind berufstätig, vielleicht in Minijobs, vielleicht arbeiten sie sogar sieben, acht, neun oder zehn Stunden am Tag.
Aber es reicht nicht. Was können wir tun?“
Da er die Stadt zu diesem Zeitpunkt noch in der gesetzlichen Pflicht
sah, unterzubringen, sie aber keine Sozialleistungen geben könnte, sah
er sich in einem Dilemma: „Einerseits Freizügigkeit, andererseits ist die
Wohnungsbehörde verpflichtet zur Unterbringung, das ist unser Job,
das haben wir zu tun! Dann dürfen wir aber nicht leisten.“ Denn: „Sie
98
Das Thema Integration erläutert er folgendermaßen weiter: „Zuwanderer […] haben grundsätzlich in der Bundesrepublik Anspruch auf integrationsunterstützende Hilfen. Das fängt damit an, dass wir von euch oder ihnen
erwarten, Sie mögen bitte Deutsch lernen. Sie mögen sich mit der Gesellschaft
auseinandersetzen. Nur dann werden sie eine Chance haben, perspektivisch in
den Arbeitsmarkt so hereinzukommen, dass die Füße auf dem Boden sind. […]
Wir sind interessiert an Zuwanderung. Aber es geht auch darum, wie man den
Weg hinein in die Arbeit findet.“
209
�haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen, das ist genau das, was der
Gesetzgeber festgelegt hat“. An diese Vorgaben hätte er sich zu halten:
„Wir sind schließlich keine Bananenrepublik, sondern an Recht und Gesetz gebunden!“ In einem Interview im Juni 2011 erklärte er mir das
Dilemma noch genauer: „Wovon sollen sie denn Miete zahlen? Des geht
net! [betont bayerischer Dialekt, Anmerkung der Autorin] Verstehen
sie? Und dann haben wir sie in einer Endlosschleife in einem System,
das keine Hilfe für sie ist“. Denn die Notunterkünfte sollten eine vorübergehende Lösung sein: „Da gilt der Satz, das ist eine vorübergehende
Bleibe. Das meinen wir auch ernst. Innerhalb von einem Jahr wollen wir
alle in eine Wohnung vermittelt haben“.
Er sah die Ämter aber nicht nur rechtlich verpflichtet, Unionsbürger*innen
von sozialen Leistungen auszuschließen sondern stellte sich auch politisch hinter den Ausschluss. So erklärte er im Interview: „Ich kann, darf,
will und werde auch keine Sozialleistungen zahlen“. Denn: „Hier gibt es
keine Versorgungshaltung“. Der Ausschluss von sozialen Rechten stellte für ihn also nicht das zugrundeliegende Problem dar, sondern das
Fehlverhalten Einzelner. So lag die Problemlösung seiner Meinung nach
auch nicht – oder nur sehr bedingt – in der Hand der Stadt oder des
Staates, sondern in der Selbstverantwortung der Einzelpersonen: „Ich
kann nur sagen, wer hier nach München kommt, muss sich selber um
seine Sachen kümmern. Das hört sich hart an, ist aber so. Eine Frau aus
Wuppertal wird auch zurückgeschickt“, erklärte er während der Podiumsdiskussion. Auch zwei Jahre später wiederholte er fast wortgleich:
„Jeder der kommt, muss sich auch selber um seinen Teil kümmern. Wir
können nicht Menschen, egal woher sie kommen... Auch eine deutsche
Bürgerin aus Wuppertal oder Essen, die hier herkommt und sagt: ‚Jetzt
bin ich hier. Ich hätte gern ’ne Wohnung!‘ – ‚Ja, das ist nett. Hätte ich
auch gerne! Kriegen sie aber von uns nicht, die suchen sie sich bitte
selber!‘“
In den Darstellungen des Amtsleiters kommt zum Ausdruck, dass es ihm
nicht um pauschale, staatsrassistische Ausschlüsse aufgrund von Nationalität oder Herkunft geht. Seine Argumentation bekräftigt vielmehr
den neoliberalen Individualismus und die postnationale Logik der urban
citizenship. Diese differenzierte Exklusionslogik, die auch als Artikulation des postliberalen Rassismus bezeichnet werden kann, nimmt nur
210
�diejenigen obdachlosen Personen in das Münchner Unterbringungssystem auf und akzeptiert sie somit als Münchner Bürger*innen, die erfolgreiche „Unternehmer*innen ihrer Selbst“ bzw. „Schmiede ihres eigenen
Glückes“ sind:
„Wir haben 96 Fälle derzeit untergebracht. Das heißt, es geht sehr wohl
mal. Und der Münchner Arbeitsmarkt ist so vital, dass er manchmal
auch Leute schluckt, die in Berlin, oder ich weiß nicht wo, niemals –
never! – eine Chance hätten. Okay. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist dann der Punkt, wo zwischen Hoffnung und Wollen
auch das Können kommt. Und diese Verpflichtung, die hat jeder selber.
Da gibt es dann den blöden Spruch mit dem: ‚Jeder ist seines eigenen
Glückes Schmied‘. Da geht nichts dran vorbei. Sie auch. Genauso wie
ich.“
Er unterscheidet zwischen den ‚guten‘ und den ‚schlechten‘
Migrant*innen: „Wir reden nicht von den qualifizierten und hoch qualifizierten, das ist nicht unser Thema. Sondern es sind die Anderen. Und
die sind in einer schwierigen Situation.“
Von der materiell-sozialen Verantwortung, die bei den Einzelnen liege,
somit freigesprochen, sieht er die Stadt nur noch in der Pflicht, Beratungsangebote aufzubauen, um die Eigenverantwortlichkeit zu unterstützen: „Es gibt einen Anspruch auf Beratung. Das glaube ich auch.“ Bei
der Beratung gehe es oft „darum, jemandem den Weg zurück zu ebnen,
wenn er die Füße hier nicht auf den Boden bekommt“. Denn:
„Wenn heute jemand neu nach München kommt, nichts hat, auch den
Weg in den Arbeitsmarkt nicht findet, so kriegt er von der Landeshauptstadt München allenfalls Unterstützung auf Rückkehr in sein
Heimatland“.
An den Argumentationen des Amtsleiters lassen sich einige der Rationalitäten, die die Stadtpolitik prägten, analysieren. Der Amtsleiter
zog die Grenze vordergründig nicht zwischen Nationalitäten, aber
auch nicht (immer) pauschal zwischen Qualifizierten und Nicht-Qualifizierten, sondern zwischen denjenigen, die sich selber helfen können und denjenigen, die es nicht schaffen, ‚ihr Glück zu schmieden‘.
Dann stellte er sich aber doch hinter den nationalstaatlichen Ausschluss
211
�von arbeitssuchenden Ausländer*innen aus dem Hartz IV, obwohl er
erklärte, dass Unionsbürger*innen in den Notunterkünften oft genau
wegen dieser Einschränkung ihrer sozialen Rechte unterhalb des Existenzminimums lebten. Er sieht die Lösung nicht darin, arbeitssuchenden Ausländer*innen das Recht auf soziale Leistungen zuzusprechen,
sondern darin, Personen, die „keinen Fuß auf den Boden bekommen“,
gar nicht erst unterzubringen und Beratungsangebote zu schaffen,
um EU-Migrant*innen „ohne Perspektive“ bei der Abreise und EUMigrant*innen „mit Perspektive“ bei der Integration zu unterstützen.
Erneute Krise des Unterbringungssystems wird
ausgerufen
Anfang 2010 erschütterte eine Warnung die städtischen Akteure: Es
könnte eine Krise des Notunterbringungssystems bevorstehen, sogar
schlimmer als Anfang der 2000er Jahre. Im Dezember 2009 lebten 1.977
Personen im städtischen Sofortunterbringungssystem. Das waren 327
Personen mehr als im Mai 2008, als die Zahl der untergebrachten Personen ihren niedrigsten Stand seit der Krise um die Jahrtausendwende
erreicht hatte. Im Oktober 2011 waren es schon 2.401 Personen. In den
Jahren zuvor war die Zahl der Plätze kontinuierlich abgebaut worden:
Während es im Jahr 2002 noch 5.197 Betten gab, waren es im März 2010
nur noch 2.379 (vgl. Amt für Wohnen und Migration, 2010a: 13). Anhand
dieser „dramatischen Entwicklungen“ kam eine Prognose für das Jahr
2012 im worst case auf bis zu 100 fehlende Unterkunftsplätze pro Monat
- das heißt, dass bis zu 100 unterbringungsberechtigte Personen nicht
untergebracht werden könnten. Das Sozialreferat warnte:
„[D]urch neu zu versorgende Zielgruppen in der Wohnungslosenhilfe
(bleibeberechtigte Flüchtlinge, osteuropäische EU-Bürger und -Bürgerinnen, einkommensschwache Familien im Zuge der Wirtschafts- und
Finanzkrise) bei gleichzeitigem Schwund an preisgünstigem Wohnraum auf Grund des Bindungsablaufs bei Sozialwohnungen (20082011: 7.110 Wohneinheiten), einem Rückgang der Wohnungsvergaben
um 26,5 % und einem großen Einbruch bei den Neubau-Zielzahlen des
Handlungsprogramms“ Wohnen in München IV“ (statt 1.300 geförderte Mietwohnungen weniger als 1.000 WE jährlich) [könnte] tendenzi-
212
�ell eine Situation nicht unähnlich der zwischen 2000 und 2003 drohen
[...], als der Bedarf an Unterbringungsplätzen sehr plötzlich und steil
anstieg und mit der Errichtung zahlreicher Notquartiere (Baracken,
Containeranlagen) reagiert werden musste.“ (Amt für Wohnen und
Migration, 2010a: 1f.)
Im Jahr 2012 sprach dann ein Mitarbeiter des Amtes für Wohnen und
Migration mir gegenüber von der „größten Krise der Wohnungslosigkeit
der Landeshauptstadt München“. Ein Grund für diese Krise läge in der
vermehrten „Zuwanderung“ von „osteuropäischen EU-Bürger*innen“
(vgl. Amt für Wohnen und Migration, 2012b).
Versuche der Problemlösung, Entwicklung neuer
Instrumente
Wie reagierte die Stadt auf diese Krise? Welche Rolle spielte die Problematisierung EU-interner Migration? Wie wurden die Problemwahrnehmungen weiterhin ausgehandelt? Welche Instrumente wurden zur
Problemlösung entwickelt?
Dienstanweisung Meldefrist 6 Monate
Spätestens im Dezember 2010 reagierte das Wohnungsamt ähnlich wie schon 2001 - durch eine restriktive Auslegung der
Wohnsitzanforderung (Amt für Wohnen und Migration, 2010b).
Es brachte nur noch Personen unter, die mindestens sechs Monate mit Hauptwohnsitz in München polizeilich gemeldet waren.
„Bei einer kürzeren Meldedauer ist davon auszugehen, dass die
Wohnungslosigkeit in einer anderen Gemeinde eingetreten ist“
(ebd.: 1). Als Grund ist in der entsprechenden Dienstanweisung
genannt, dass die „Unterbringungsmöglichkeiten weitgehend
ausgeschöpft“ (ebd.) wären. Das Wohnungsamt beschränkte damit seine Zuständigkeit auf die Unterbringung derjenigen Menschen, die in München obdachlos werden und schloss diejenigen,
die zwar in München obdachlos sind aber in anderen Gemeinden
obdachlos wurden, aus ihrem Versorgungsbereich aus. Nach der
213
�bisherigen Rechtsauslegung war dies aber rechtswidrig, wie das
oben erwähnte Urteil aus dem Jahr 200199 zeigte. Die Stadt musste die
Regelung zwar stark verteidigen und legitimieren, sie wurde aber erst
2015 wieder abgeschafft.
Im Sinne der Diskussionen zu urban citizenship stellte die Stadtpolitik
residency - den gewöhnlichen Aufenthalt bzw. Wohnsitz - als für alle
Nationalitäten geltende Bedingung für die Notunterbringung auf. Sie
definierte den Begriff des Aufenthalts aber restriktiv: nicht nur durch
den Mindestzeitraum von sechs Monaten, sondern auch durch die in
der Praxis angewandte Anforderung, den Aufenthalt durch eine Meldebestätigung nachzuweisen. Für eine Meldebestätigung forderte die
Meldebehörde aber oftmals einen Mietvertrag und teils sogar die persönliche Begleitung durch den/die Wohnungsgeber*in. Einen schriftlichen Mietvertrag konnten aber nicht nur Obdachlose nicht vorweisen,
sondern auch viele Personen in prekären Mietverhältnissen. Die melderechtliche Anmeldung wurde hier (wie auch in vielen anderen Bereichen) zur ausschlaggebenden Hürde, die den Zugang zu (Stadt-)Bürgerschaft verhinderte.
Eine weitere Dienstanweisung setzte seit Sommer 2010 fest, dass mittellose Personen ein Ticket in ihr Heimatland von der Bahnhofsmission ausgestellt bekämen. Zum einen förderten die Verantwortlichen des
Wohnungsamtes so die erwünschte Abreise der problematisierten Personen, zum anderen suchten sie so ihrer sicherheitsrechtlichen Pflicht
des Schutzes von Leib und Leben nachzukommen. Eine Mitarbeiterin
der Bahnhofsmission hatte noch eine dritte Erklärung:
„Die meisten Leute, die zu uns kommen, [waren] überhaupt nicht
mehr beim Amt. Die kommen gleich zu uns. Da ist das Amt durchaus
entlastet, dass [...] man im Amt auch nichts mehr sagen muss, sich
nicht entschuldigen muss. [...] Natürlich ist das entlastend, wenn ich
noch eine Alternative anbieten kann.“
Entlastend und entschuldigend für das Amt – nicht nur den Antragsstellenden, sondern auch anderen sozialen Akteuren wie den Wohlfahrtsorganisationen gegenüber – wirkten sicher auch die Härtefallregelungen, die sich durch die verschiedenen Dienstanweisungen zogen. Als
99
Bayerisches Verwaltungsgericht München, B. v. 06.12.2001 - M 6a E
01.5884. (2. Instanz: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 07.01.2002 - 4 ZE
01.3176.)
214
�Härtefälle bezeichnete das Sozialreferat in der Sechs-Monats-Regelung
Fälle, „bei denen eine Gefährdungssituation besteht (sowohl für Kinder
als auch für Erwachsene analog der Gefährdungsdefinition der Sozialbürgerhäuser)“ (Amt für Wohnen und Migration, 2010b), oder die „von
der Bahnhofsmission oder von St. Bonifaz, vom Café 104 und Ärzten
der Welt und von Malteser Migranten Medizin mit der Bitte um Anspruchsklärung gemeldet werden“ (ebd.). Für diese wurde eine extra Ansprechperson im Amt für Wohnen und Migration benannt. Mit diesen
Regelungen ging die Stadt über nationalstaatliche und EU-europäische
Grenzziehungen hinaus und setzte den Aufenthalt als Voraussetzung
für den Zugang zu den grundlegenden sozialen Rechten fest. Sie legte
das ius domicilii dabei aber sehr restriktiv aus - auf eine Weise, dass
viele EU-migrantische Arbeiter*innen ausgeschlossen blieben. Diese restriktive Grenzziehung schloss nicht nur Obdachlose, die seit weniger
als sechs Monaten in München lebten, aus, sondern auch solche, die sich
zuvor, zum Beispiel weil sie keinen Mietvertrag hatten, nicht anmelden
konnten. Den Ausschluss versah das Amt für Wohnen und Migration
mit humanitären Verbrämungen wie Härtefallregelungen und Rückkehrhilfe. Parallel schloss es EU-Migrant*innen aus sozialen Beratungsangeboten für Obdachlose aus und richtete im Laufe der Jahre für diese
„Zielgruppe“ eigene Beratungsstellen ein.
„Beratung, da müssen wir mehr tun“
Seit Oktober 2009 wurde die Teestube Komm, die wichtigste niederschwellige Anlaufstelle für Obdachlose in München, die einen Tagesaufenthalt, Postadressen, Waschmöglichkeiten und Beratung anbietet, von der Stadt München angewiesen, die meisten obdachlosen
Ausländer*innen abzuweisen. In der Praxis wurden Ausländer*innen
(bzw. nicht-deutschsprachige Personen) abgewiesen, wenn sie keinen
Arbeitsvertrag vorweisen konnten. Als ich einmal telefonisch anfragte,
ob die Teestube ein Postfach für eine obdachlose Person bulgarischer
Nationalität einrichten könnte, erklärte mir ein Mitarbeiter pauschal,
dass dies nicht ginge, denn sonst hätten sie „keine Kapazitäten mehr für
unsere Obdachlosen“, wobei die Betonung auf dem Possessivpronomen
lag. Ein*e andere*r Mitarbeiter*in erklärte, dass die Anweisung der Stadt
in der Einrichtung durchaus auf Unbehagen gestoßen sei. Sie wollten
darauf hinwirken, dass alternative Angebote geschaffen werden. Schon
215
�während der ersten Sondierungen und Runden Tische zum übergreifenden Thema ‚Zuwanderung aus Osteuropa‘, zu dem die Obdachlosigkeit ein Unterthema darstellte, hatte sich die Idee abgezeichnet, dass es
mehr Beratungsangebote bräuchte. Auch der Leiter des Amts für Wohnen und Migration war, wie gesehen, überzeugt: „Beratung, da müssen
wir mehr tun“. Schon im Mai 2010 beantragte dann die Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste (2010) im Münchner Stadtrat, dass die Stadt
eine „grundlegende Handlungsanleitung, wie mit der Zuwanderung aus
den neuen EU-Mitgliedsstaaten von Seiten der Stadt München umzugehen ist“ (ebd.) erarbeiten sollte, inklusive einer „in Zusammenarbeit
mit den Wohlfahrtsverbänden erarbeitete Konzeption, um bestehende
niederschwellige Beratungsangebote auch für Zuwanderinnen und Zuwanderer aus den neuen EU-Beitrittsländern zu öffnen“ (ebd.) und einer
„Darlegung, wie niederschwellige Beratungsangebote einen Einstieg in
das bestehende Hilfesystem in München für Zuwanderer ermöglichen“
(ebd.). Weiter heißt es in dem Antrag, dass auch wenn die Landeshauptstadt derzeit davon ausgehe, für diese Zielgruppe nicht zuständig zu
sein, sie „bei Kindswohlgefährdung oder andere[n] Faktoren (Gefahr
für Leib und Leben, Wohnungslosigkeit) […] zur Intervention verpflichtet“ (ebd.) sei. Es sei „notwendig, hier einen kommunalen Umgang zu
finden, der sich nicht auf Repression reduziert, sondern einen Zukunftsblick erhält, der sowohl die niederschwellige Beratung als auch die Hilfe
im notwendigen Einzelfall beinhaltet“ (ebd.). Bei der Zielgruppe handle
es sich nicht nur „um organisierte Bettler“ (ebd.), sondern „auch um die
oftmals verfolgte und ausgegrenzte Armutsbevölkerung aus den neuen
Beitrittsländern“ (ebd.). Wie Markus End zeigt, werden beide Kategorien - „organisierte Bettler“ und „verfolgte Armutsbevölkerung“ - oft
synonym für „Roma“ verwendet (vgl. End, 2014).100 Im November 2010
antwortete der Stadtrat (auf Vorschlag der Stadtverwaltung) mit der Erweiterung von drei bereits bestehenden Projekten mit städtischen Mitteln (vgl. Stadtjugendamt, 2010). Zum einen wurde das Projekt Bildung
100
Hier möchte ich auf die Forschung von Huub van Baar hinweisen, die
sich mit Antiziganismus und der Frage der Europäisierung des Regieren und
der Repräsentation von Roma beschäftigt (vgl. Van Baar, 2012). Dass die Figur
der Roma auch in den Münchner Regimen eine Rolle spielt, wird in diesen anfänglichen Aushandlungen am deutlichsten. Sie verliert dann aber meiner Analyse nach an Bedeutung. Ein Vergleich mit dem Regime in Berlin, in dem die
Figur ‚Roma‘ eine viel größere Rolle zu spielen scheint (vgl. Hielscher, 2013),
wäre sehr aufschlussreich.
216
�statt Betteln der Caritas gefördert, das die folgenden Schwerpunkte
habe:
„einen niederschwelligen, aufsuchenden und sprachlichen Zugang,
Verdeutlichung der (fehlenden) beruflichen Perspektiven, Hilfestellungen bei arbeitsrechtlichen Fragen, Unterstützung bei Fragen zur
Krankenversicherung, Hilfestellung bei der Klärung von erworbenen
Sozialleistungsansprüchen sowie Unterstützung und Motivation von
Familien mit Kindern zum Schulbesuch.“ (ebd.)
Die hier deutlich werdende Annahme, dass berufliche Perspektiven
fehlten und dass Familien ihre Kinder von alleine nicht in die Schule schickten, folgt antiziganistischen Stereotypen. Darauf, dass solche
rassistischen Überzeugungen im untersuchten Regime anschlussfähig
waren, verweisen auch die Äußerungen des Mitarbeiter einer Wohlfahrtsorganisation, der in der Kommunalpolitik als einer der ersten und
wichtigsten ‚Experten aus der Praxis‘ zu den EU-Migrant*innen galt
und immer wieder zu diversen Runden Tischen, internen Treffen und
öffentlichen Veranstaltungen als Experte geladen worden. Während
eines Interviews im November 2010 gab er seine Vorurteile zu den Roma
preis: „Die sind nicht bildungsgierig oder so. Das ist eine ganze Bevölkerungsgruppe.“ Die Stereotype des Mitarbeiters werden noch deutlicher,
wenn er die bulgarischen „Bevölkerungsgruppen“ der „Bulgaren“, „Türken“ und „Roma“ vergleicht:
„Die Türken bleiben in Bulgarien, die sind mit dem Land, mit dem
Beruf verbunden. Die sind sehr gute Bauer auf Baustellen, die arbeiten
immer während der kommunistischen Zeit. Die sind materiell sehr gut
aufgestellt. Sie hatten was. Die wollten nie migrieren [...]. Genauso
kommen auch die Bulgaren nach Deutschland. Wenn man sagt, dass
die Türken unter prekären Situationen, Lebensbedingungen leben –
das stimmt nicht. Die leben genauso gut wie die Bulgaren. Aber die
Roma nicht, das ist was anderes. Weil sie nicht in die Schule gehen und
nicht wollen.“
Als zweites Projekt bekam Jadwiga, eine „Fachberatungsstelle für
Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen-/Frauenhandel, Arbeitsausbeutung und Zwangsverheiratung zu bekämpfen“
217
�(Stadtjugendamt, 2010), 40.000 Euro zugesprochen. Schwerpunktmäßig
unterstütze Jadwiga den Kampf gegen Menschenhandel und die Rückkehr betroffener Frauen:
„Sie unterstützen in Bulgarien eine Beratungsstelle zur Prävention von
Menschenhandel in Zusammenarbeit mit der Roma-Union. 2009 konnte in 26 Fällen Klientinnen bei der freiwilligen Rückkehr ins Heimatland geholfen und durch die guten Kontakte im Heimatland individuelle Unterstützung und Hilfe angeboten werden.“ (ebd.)
Das dritte Projekt, das mit 100.000 Euro bezuschusst wurde, war S.I.N.T.I.,
ein Projekt, dessen Zielgruppe gar nicht die neuen Migrant*innen waren, sondern deutsche Sint*ezza, die meist in München aufgewachsen
sind.
Im Vorlauf dieses Entschlusses hatte es auch Gespräche mit leitenden
Mitarbeiter*innen des Amts für Wohnen und Migration zu einer Erweiterung und Veränderung des Konzepts des Projektes bei der Caritas
gegeben, in die die Initiative Zivilcourage stark involviert gewesen war,
indem sie ihr Konzept des Workers’ Centers einbrachte. Das entworfene
Projekt sollte von Bildung statt Betteln zu Willkommen in München umgetauft werden. Nach mehreren Gesprächen mit dem Amt für Wohnen
und Migration wurde der Antrag, noch bevor er in den Stadtrat kam, abgelehnt, da die Zielsetzung nicht derjenigen der Stadt entspräche bzw.
im Stadtrat nicht mehrheitsfähig wäre. Dies sollte der erste einer Reihe
von Versuchen der Initiative Zivilcourage sein, ein Unterstützungs- und
Beratungsprojekt mit dem Schwerpunkt Arbeit, inklusive selbstorganisiertem Café-Raum, zu gründen. Auch ein weiterer Versuch mit dem
Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) ein solches Projekt unter dem
Namen Café zur Arbeit zum Leben zu gründen, wurde in letzter Sekunde
von der Leitung des Referats abgelehnt. Erst im Jahr 2013 wurde schließlich das Infozentrum Migration und Arbeit mit der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) als Trägerin eingerichtet. Im Jahr 2013 entstand im Rahmen des
städtischen Konzepts zum Kälteschutz auch die Einrichtung Schiller 25,
die explizit die Beratung obdachloser Migrant*innen zum Auftrag hat
und vom Evangelischen Hilfswerk getragen wird. Menschen „ohne Perspektive in München“ sollen dort über ihre Perspektive in München und
im Heimatland beraten werden (vgl. Amt für Wohnen und Migration,
2012c).
218
�Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einrichtung von Beratungsstellen von vielen Akteuren unterstützt wurde und auch durchgesetzt werden konnte. In Bezug auf die Forderung nach Beratungsprojekten überschnitten sich verschiedene Interessen - die Beratung von
Migrant*innen passte sowohl zur städtischen Logik der Aktivierung als
auch zum Interesse der Wohlfahrtsverbände nach ihrer Vergrößerung,
zu promigrantischen Forderungen von „Willkommenskultur“ sowie zu
der konservativen Vorstellung von Rückkehrhilfe und der Bekämpfung
von Menschenhandel. Beratungsprojekte waren mit dem kommunalpolitischen Ausschluss z.B. aus der Obdachlosenhilfe durchaus vereinbar.
Sie boten den promigrantischen Kräften aber eine Art Kompromiss an,
der ihre Kritik an den kommunalen Grenzziehungen neutralisierte bzw.
abschwächte. Umstritten war allerdings durchaus, welche Art von Beratungsangeboten geschaffen werden sollten. Hier setzten sich diejenigen
Vorschläge durch, die soziale Unterschiede kulturalisierten bzw. rassistisch begründeten und/oder Rückkehr förderten. Mit dem Infozentrum
Migration und Arbeit und seinen Vorläufern wurde zwar ein Ansatz, der
sich pro-migrantisch und für soziale Rechte aussprach, von Anfang an
vorangetrieben und fand auch Unterstützung in der Stadtpolitik. Er hatte es aber ungleich schwerer, tatsächlich auch eine Mehrheit zu finden
und institutionalisiert zu werden. Ein Vorläuferprojekt mit dem Namen
Willkommen in München war nicht genehmigt worden, auch mit der Begründung, dies passe nicht zur städtischen Politik und sei nicht durchzusetzen. Nach diesem kurzen Exkurs zu den kommunalpolitischen
Aushandlungen rund um die Gründung von Beratungsstellen, wende
ich mich im Folgenden wieder dem Management des Notunterkunftssystems zu.
Thesenpapier gegen ‚Anreize zum Verbleib‘
Einen Einblick in die internen Aushandlungen der Obdachlosenhilfe im
Amt für Wohnen und Migration gibt ein Thesenpapier einiger Mitarbeiter von 2011 (vgl. Sozialreferat, 2011). Sie vertreten die Meinung, dass
die untergebrachten Personen noch mehr als zuvor zur Eigenverantwortung bzw. zum Auszug aus den Notunterkünften motiviert werden
müssten. Die Sozialarbeiter*innen in den Unterbringungen sollten sich
auf die Vermittlung in Wohnraum und die „Mobilisierung der Selbsthilfepotentiale“ (ebd.) durch „intensive aufsuchende Sozialarbeit“ (ebd.)
219
�beschränken. Es dürfe keine „Integration in der Wohnungslosenhilfe“
(ebd.) stattfinden, denn sei erst mal ein „umfangreiches Hilfesystem installiert […], fällt ein Ortswechsel naturgemäß schwer“ (ebd.). Sei die
Qualität der Unterbringung zu hoch, führe dies zu „Anreize[n] zum Verbleib“ (ebd.). „Besonders Haushalte aus den neuen EU-Beitrittsstaaten
und Familien aus Bürgerkriegsländern finden in unserer Sofortunterbringung oft die besten Wohnverhältnisse ihres Lebens vor“ (ebd.). Um
die Motivation wieder auszuziehen zu steigern, solle die Unterbringung
auch grundsätzlich befristet werden: „Damit setzen wir die betroffenen
Haushalte unter Zugzwang und diese nicht mehr uns!“ (ebd.)
Des weiteren solle die „Bringschuld im Rahmen der Mitwirkungspflicht“
(ebd.) erhöht werden. Dazu zähle neben der „eigenen Bemühung zur
Wohnungssuche“ (ebd.) auch die „Einforderung von Unterhaltsleistungen gegenüber Verwandten“ (ebd.). Bei einer Verweigerung von Mithilfe – etwa wenn Besichtigungstermine nicht wahrgenommen oder
Wohnungs- und Beratungsangebote abgelehnt würden – solle die Unterbringung beendet werden. An dem Thesenpapier wird noch einmal
deutlich, wie die aktivierende Sozialpolitik mit strafendem Druck, Überwachung und der Herabsetzung von sozialen Standards einhergeht.
Weitere Dienstanweisungen
Neben der erwähnten Dienstanweisung Meldefrist 6 Monate (Amt für
Wohnen und Migration, 2010), die für alle Antragsstellenden galt, traten
im Amt für Wohnen und Migration bald weitere Dienstanweisungen in
Kraft: eine Anweisung zur Beendigung der Unterbringung – Befristung
der Unterbringung (Objektbezogene Planung und Immobilien-Management, 2011) und im September 2011 die Dienstanweisung zur Unterbringung von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern (Objektbezogene Planung
und Immobilien-Management, 2012).
Erstere setzt ganz im Sinne des Thesenpapiers fest, dass Unterbringungen generell „auf die Dauer der Notlage“ befristet werden sollten. Bei
„fehlender Mitwirkung“, etwa der Ablehnung eines Wohnungsangebotes, die ein „unwirtschaftliches Verhalten“ darstelle, sei die Unterbringung zu beenden. Die zweite Dienstanweisung webt ein Dickicht an
Anforderungen: Antragstellende Unionsbürger*innen müssen nachweisen, über ausreichende Existenzmittel zu verfügen oder erwerbstätig
bzw. unverschuldet arbeitslos zu sein, um in München untergebracht
220
�zu werden. Damit lehnt sich die Münchner EU-Dienstanweisung an
rechtlich höchst umstrittene Ausschlusskriterien der deutschen Sozialgesetzbücher und des Freizügigkeitsgesetzes/EU an, in denen die Arbeitnehmereigenschaft (Erwerbstätigkeit oder unverschuldete Arbeitslosigkeit) und nicht der tatsächliche Lebensmittelpunkt als Grundlage
für den Zugang zu sozialen Rechten gesetzt wird. Zudem schließt sie
Unionsbürger*innen von Obdachlosenhilfe aus, die zuvor weniger als
sechs Monate in München gemeldet waren, die keinen schriftlichen
Nachweis der Kündigung ihres ehemaligen Mietverhältnisses erbringen konnten oder zuvor in einem gewerblichen Wohnheim gewohnt
haben. Mit diesen Kriterien grenzt die Stadt München den Begriff des
„gewöhnlichen Aufenthalts“ sehr eng ein.
Obdachlose Unionsbürger*innen müssten zudem nachweisen, über
keinen Wohnraum im Heimatland zu verfügen - denn Personen, die
andernorts über Wohnraum verfügten, seien eigentlich gar nicht obdachlos und stellten den Antrag auf Unterbringung somit rechtsmissbräuchlich. Weil sie ihre Notlage eigenständig beheben könnten, so die
Argumentation, müsse die Landeshauptstadt sie nicht unterbringen,
sondern höchstens ein Ticket ins Herkunftsland bezahlen. Zuletzt gibt
die Dienstanweisung vor, dass obdachlose Personen nachweisen müssten, selbst nach einer Wohnung gesucht und somit ihr Selbsthilfepotenzial ausgeschöpft zu haben, etwa durch eine Liste an Wohnungsangeboten. Effektiv schloss die Fülle an Nachweisen, die für eine Notunterkunft
zu erbringen waren, die meisten obdachlosen Unionsbürger*innen aus
dem regulären Unterbringungssystem der Stadt München aus. Das Amt
für Wohnen und Migration hatte ein engmaschiges Netz der differenzierten Exklusion geknüpft, das den Zutritt zwar nicht pauschal verwehrte, aber für die meisten prekarisierten Migrant*innen doch ihren
Ausschluss bedeutete. Nur die wenigsten konnten einen Arbeitsvertrag,
einen gekündigten Mietvertrag und mehr als sechs Monate Anmeldung
vorweisen und waren dann noch finanziell und zeitlich in der Lage, nach
Bulgarien zu fahren, um die erforderliche Bestätigung von der dortigen
Gemeinde, dass in ihrem Gebiet kein Wohnraum zur Verfügung stehe, zu
besorgen. Der Ausschluss Obdachloser aus dem Unterbringungssystem
geht mit dem Ausschluss aus der Münchner Bürgerschaft einher, weil
es ohne Bestätigung des/der Wohnungsgeber*in nicht möglich ist, sich
anzumelden und auch der Zugang zu weiteren staatlichen bzw. städtischen Angeboten versperrt ist. Das Amt für Wohnen und Migration
221
�wird faktisch zur internen Grenzbehörde, zur „liminalen Institution“
(Hielscher, 2013) und die Beantragung einer Obdachlosenunterkunft zu
einer „Grenzsituation“ (Lebuhn, 2012). Die Grenzen, die in diesen Situationen zum Ausdruck kommen, sind sowohl von der EU als auch vom
deutschen Nationalstaat sowie von der Stadt München gezogen.
Ein im Spätherbst 2010 mit dem Wohnungsamt ausgetragener Konflikt
gibt einen weiteren Eindruck der gelebten Realitäten dieser Grenzsituationen und zeigt, wie das Amt für Wohnen und Migration nicht müde
wurde, mit Ausschlusskriterien zu experimentieren.
Konflikt um Wohnraum III: Zugang unmöglich
München, Oktober 2011. Wir (Julia Marinova, ihr Partner Stalin Hristov
und ich) trafen uns vor dem Amt für Wohnen und Migration, um eine
Notunterkunft und langfristig eine Sozialwohnung zu beantragen. Die
Familie wohnte gemeinsam mit der Familie der Schwester in einer EinZimmer-Wohnung. Sie waren zu zehnt in der kleinen Wohnung. Die
Tochter hatte Asthma, beide Kinder gingen zur Schule. Stalin arbeitete
bei einem großen Abriss-Unternehmen in München. Er arbeitete sehr
viel, meist mehr als 10 Stunden am Tag und verdiente etwa 2000 Euro im
Monat, wobei er nicht alle Stunden auf seine Lohnabrechnung schreibe. Er hatte eine Arbeitserlaubnis und einen Arbeitsvertrag. Er sprach
gerne von seiner Arbeit, erzählte mir mehrmals, wie sie einen MusikClub ausgeräumt und dabei eine ganze Musikanlage, Sofas, etc. einfach
weggeworfen hätten. Julia Marinova hatte einen Job als Putzkraft, hatte
diesen allerdings aufgegeben, um für die asthmakranke Tochter zu sorgen. Sie hatte nun nur noch einen 400-Euro-Job, aber auch diesen mit
Vertrag. Sie putzte in einem Café, zwei Stunden jeden Tag. Die beiden
waren einige Wochen zuvor in das Workers’ Center gekommen, um Hilfe
bei der Wohnungssuche zu bekommen. Ich hatte inzwischen einige Erfahrung mit den Ansprüchen des Wohnungsamtes gewonnen. Mit Arbeitspapieren, Lohnnachweis, mehr als sechs Monaten angemeldetem
Aufenthalt in München und dem ärztlichen Attest für die Tochter sah
ich gute Chancen auf eine Unterbringung. Sie hatten nur noch keinen
aktuellen Arbeitsvertrag für Julia Marinova und keine Anerkennung
der gemeinsamen Elternschaft für die Kinder. Sie waren nicht verheiratet und in der Geburtsurkunde stand nur Julia Marinova. Es fehlte also
noch ein Papier, das bestätigte, dass es sich um eine „richtige“ Familie
222
�handelte - in anderen Fällen war eine amtlich beglaubigte „Anerkennung der Vaterschaft“ verlangt worden. Ich telefonierte also mit einigen
Notar*innen, die nach genaueren Informationen vom Amt fragten, welche Informationen sie bestätigen sollten. Auch eine Bestätigung, dass
sie nicht länger in dem Zimmer mit der anderen Familie wohnen könnten, schrieb ich der Familie, und die Schwester sollte es unterschreiben.
Für den Arbeitsvertrag rief ich die Chefin an, und sie versicherte mir,
sie würde ihn ihrer Angestellten geben. Mit allen Papieren, außer der
Vaterschaftsversicherung, gingen wir dann schließlich zum Amt. Erst
warteten wir etwa eine Stunde in der Infothek, Stalin holte einen Tee.
Dann ging es weiter in den ersten Stock, wieder Warten. Schließlich
redeten wir mit der zuständigen Sachbearbeiterin. Sie rechnete uns vor,
wie viel eine Notunterkunft kosten würde: bis zu 600 Euro pro Person
und Monat. Sie sagte auch, die Familie hätte sich das ja vorher überlegen können. Wenn sie ins Ausland ginge, würde sie sich mindestens ein
Jahr zuvor vorbereiten: Wohnung suchen, Job suchen, so mache man
das eben. Dann händigte sie uns ein Formular für das bulgarische Konsulat aus, mit dem dieses bestätigen sollte, dass die Familie im Heimatland wohnungslos wäre. Diese Anforderung war mir neu. Stalin sagte,
das Konsulat machte so etwas nicht für sie. Die Sachbearbeiterin sagte, das müsste jetzt so sein, denn es hätte einen Fall gegeben, wo ein
„Bulgare“, der hier in der Notunterkunft gelebt hätte, ein Haus an der
Schwarzmeerküste besessen hätte. Solch einem Missbrauch müsste man
vorbeugen. Mit einer Bestätigung des Jobcenters, dass sie Hartz-IV-berechtigt seien, und dem Formular des Konsulats, dass sie im Heimatland
wohnungslos seien, sollten wir wiederkommen - möglichst früh, weil
mittags oft schon alle Plätze vergeben seien. Wir verließen das Amt erschöpft.
Am nächsten Morgen rief mich Stalin Marinov vom Konsulat aus an,
dieses wollte das Formular nicht ausfüllen. Als wir es am nächsten Tag
noch einmal gemeinsam versuchten, erklärte eine Mitarbeiterin des
Konsulats, dass sie weder befugt noch gewillt wären, das Formular zu
unterschreiben und somit die Obdachlosigkeit und Gefahr für Leib und
Leben in Bulgarien zu bestätigen. Dieses Formular war aber die Bedingung für die Wohnungslosenhilfe. Solange diese Regelung galt, war der
Zugang zu den Notunterkünften für obdachlose Bulgar*innen also versperrt.
223
�Auch mit einer anderen obdachlosen Person einige Wochen später stießen wir auf dieses Problem. In einem Telefongespräch ließ eine Angestellte des Wohnungsamtes durchblicken, dass ein großes Chaos im Amt
herrschte und sie die Anordnung auch schwierig fände. Diese spezifische Regelung sollte zwar bald wieder passé sein, sie zeigte aber, wie
die Amtsleitung sich immer neue Möglichkeiten einfallen ließ, um das
Unterbringungssystem gegen „Missbrauch“ zu schützen.
Gesamtplan Wohnen statt Unterbringen 2012:
Ausschluss als Schutz
Im Jahr 2012 präsentierte das Sozialreferat einen neuen Gesamtplan
Wohnen statt Unterbringen (Amt für Wohnen und Migration, 2012b) im
Stadtrat, mit dem es Bezug auf den Paradigmenwechsel von 2001 nahm,
auf die neue Krise reagierte und etwa 20 neue Stellen, u.a. für die Beschaffung von neuem Wohnraum und für soziale Arbeit zur Vermeidung
von Wohnungslosigkeit, beantragte. Der neue Gesamtplan stellt die vermehrte „Zuwanderungs-Wohnungslosigkeit“ (ebd.: 45), die „Folge einer
bisher im Ausmaß nicht gekannten europäischen Armutswanderung“
(ebd.: 59) sei, als die größte Herausforderungen in der aktuellen Krise
der Wohnraumpolitik dar. Die Wohnungslosigkeit in München werde
wachsen, wenn die Prognose von weiteren „unkalkulierbaren Wanderungsbewegungen innerhalb von Europa“ (ebd.: 55) zutreffe. Dank der
„in den letzten Jahren entwickelten Instrumente und Angebote“ (ebd.:
51) sei es dem Sozialreferat aber bisher gelungen „die in München entstehende Wohnungslosigkeit weitgehend in den Griff zu bekommen“
(ebd.). Mit den hier erwähnten „Instrumenten“ waren die schon bekannten Dienstanweisungen gemeint:
„Seit Inkrafttreten der 6-Monats-Regelung (Juli 2011) und der städtischen Regelung für EU-Bürgerinnen und Bürger (September 2011)
wurden 701 Personen (Stand 30.6.2012) nicht untergebracht. Nur deshalb ist es dem Sozialreferat gelungen, das Münchner Sofortunterbringungssystem für Wohnungslose an der Grenze des sozialverträglich
Machbaren zu managen.“ (ebd.: 52)
224
�Das Amt für Wohnen und Migration stellt hier den Ausschluss von
701 Personen, die ihre Unterbringung in eine Notunterkunft beantragten, als Schutzmaßnahme dar. Geschützt werde die „Grenze
des sozialverträglich Machbaren“ - was mit diesem Ausdruck gemeint ist, bleibt unklar, vermutlich geht es um die sozialen Standards in den Unterkünften. Es scheint jedenfalls paradox: Indem
Obdachlose auf die Straße geschickt werden, wird Wohnungslosigkeit „in den Griff bekommen“. Erklärbar wird dieses paradoxe
Verständnis aus der Perspektive der biopolitischen Logik des „Leben Machens und Sterben Lassens“ (vgl. Foucault, 1999). Es geht
um die „sozialverträglichen“ Zustände innerhalb des Systems,
nicht außerhalb. Die Grenzen der sozialverträglichen Machbarkeit werden zu den Grenzen des bios, des zu schützenden Lebens.
Diese Grenze zwischen dem „Innen“ und „Außen“, zwischen denen, für die sich die Stadt als zuständig erklärt, und jenen, die sie
nichts angehen, war und ist umkämpft und wird immer wieder
neu gezogen. Mit der Dienstanweisung Unterbringung wohnungsloser Haushalte – Meldefrist sechs Monate (Amt für Wohnen und
Migration, 2010b) und der Dienstanweisung zur Unterbringung von
EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern (Objektbezogene Planung und
Immobilien-Management, 2012) wurde sie anhand von leistungsideologischen Rationalitäten (Arbeit) wie auch nationalstaatlichen Kriterien (Inländer*innen vs. Unionsbürger*innen) und der
restriktiven Auslegung des städtischen Aufenthaltskriteriums
(„gewöhnlicher Aufenthalt“ erst nach sechs Monaten Anmeldung)
gezogen.
Neben ‚Ausschluss als Schutz‘ finden sich in dem Gesamtplan noch zwei weitere, schon bekannte Argumentationen wieder. Zuerst einmal gelte die Vermutung, dass migrantische
Unionsbürger*innen über Wohnraum im ‚Heimatland‘ verfügten
und deswegen nur vorgäben, obdachlos zu sein:
„Aus der Erfahrung des Sozialreferats handelt es sich häufig um Personen in schwierigen Lebenslagen, die auf der Suche nach Arbeit sind,
in ihrer Heimatgemeinde aber über Wohnraum verfügen.“ (ebd.: 51)
Außerdem würde eine Unterbringung diesem Personenkreis eigentlich
gar nicht helfen, denn er habe sowieso keinerlei Perspektiven in München:
225
�„Die Zuwanderinnen und Zuwanderer stammen meist aus den neuen
osteuropäischen EU-Beitrittsländern, gehören teilweise in ihren Heimatländern zu den diskriminierten Minderheiten, werden aufgrund
der extremen Wohnungsmarktsituation dauerhaft keine Chancen auf
dem Münchner Wohnungsmarkt haben. [ ] Auch auf dem Arbeitsmarkt sind aufgrund der in der Regel mangelnden beruflichen Qualifikation und der schlechten oder nicht vorhandenen Deutschkenntnisse
der Zuwanderinnen und Zuwanderer nur geringe Perspektiven zu sehen. [...] Der Zugang zu Sozialleistungen ist diesen Haushalten häufig
verwehrt. Damit würde sich vor allem bei Familien für die Kinder ein
Leben ohne Perspektive abzeichnen.“ (ebd.: 51)
Ein Dach über dem Kopf berge viel eher die Gefahr, dass die Selbsthilfemotivation verloren gehe: „Die Folgen wären langjährige Unterbringungen in beengten Notunterkünften, die häufig zu Hospitalisierung bzw.
einem Verlust von Eigeninitiative sowie Selbsthilfemotivation führt“
(ebd.). Die Aktivierung der Selbsthilfemotivation war aber spätestens
seit dem Paradigmenwechsel Wohnen statt Unterbringen oberstes Ziel
der Münchner Obdachlosenpolitik. In diesen Zitaten wird der paternalistische Blick der Sozialpolitiker*innen und „Manager*innen“ des Wohnungslosensystems auf die obdachlosen Personen überdeutlich: Wer
eine „Perspektive“ in München haben soll und was es überhaupt heißt,
eine „Perspektive“ zu haben, wird entschieden, ohne die Perspektiven
der Obdachlosen selbst mit einzubeziehen. Diese Definitionen, mit denen Ein- und Ausschlüsse einhergehen, richten sich vielmehr nach den
Normen der Arbeitsgesellschaft (vgl. Hirsch, 2015) und des Nationalstaates.
Die Stadt hat verschiedene Argumentationen gefunden, mit denen sie
sich als nicht-zuständig erklärte und die zuvor noch angenommene Verpflichtung zur Unterbringung ablehnte: Sie schloss EU-Migrant*innen
(und auch andere Personen) aus den Unterkünften aus, die keine sogenannte Erwerbstätigeneigenschaft und keinen gewöhnlichen Aufenthalt
nachweisen, keine Anmeldung vorlegen und nicht beweisen konnten,
dass sie über kein Haus im Herkunftsland (bzw. ‚an der Schwarzmeerküste‘) verfügten. Dies geschah zum Schutz der „sozialverträglichen
Machbarkeit“, mit der nicht nur die sozialen Standards gemeint zu sein
scheinen, sondern auch der Schutz der obdachlosen EU-Migrant*innen
226
�selbst vor einem ‚perspektivlosen Leben‘ in der „Endlosschleife“, wie es
der Leiter des Amtes für Wohnen und Migration formuliert hatte.
Eine Frage der Kälte: Kälteschutz als humanitaristisches Ausweichmanöver
Nachdem nun der Anspruch auf Notunterbringung von prekarisierten
Unionsbürgerinnen, die in München obdachlos sind, weitgehend begrenzt und delegitimiert worden war, sah sich die Stadt München einem
Problem gegenüber: Viele „Zuwander*innen“ kehrten nicht, wie prognostiziert, in ihre „Heimat“ zurück. Immer mehr Obdachlose lebten in
München auf der Straße und waren gerade bei kalten Temperaturen in
Lebensgefahr. Im Winter 2011 vereinbarten die Sozialreferentin und der
Leiter des Amtes für Wohnen und Migration ein Treffen, um über einen
gemeinsamen Sprachgebrauch im Ernstfall - also falls eine obdachlose
Person sterbe - zu sprechen, der auch den anderen städtischen Akteuren
für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit bzw. der Presse an die
Hand gegeben werden sollte. Bald darauf entwarfen die Verantwortlichen eine neue Strategie des Umgangs mit Obdachlosigkeit: ein „Erfrierungsschutzprogramm“. Im Februar 2012 erließ der Leiter des Amtes für
Wohnen und Migration eine „Dienstanweisung zur Schlafplatzvergabe
- Handlungsempfehlung Erfrierungsschutz“ (Amt für Wohnen und Migration, 2012a):
„Bei Außentemperaturen von 0° und kälter, [wird] [a]uch Personen,
die nach den o.g. Dienstanweisungen nicht untergebracht würden, [...]
während der Kältezeit ein Schlafplatz zur Verfügung gestellt.“ (ebd.: 1)
Wenn der deutsche Wetterdienst für München Temperaturen unter null
Grad vorhersagte, wurden die Schlafplätze nächteweise (für bis zu drei
Nächte) vergeben und standen von 16 bis 9 Uhr zur Verfügung. Die Vergabe übernahmen die Bahnhofsmission und die ZEW im Wohnungsamt.
Über den folgenden Sommer wurde die Dienstanweisung überarbeitet
und eine Immobilie gesucht, die als Kälteschutzeinrichtung funktionieren könnte. In der Bayernkaserne, einer ehemaligen Bundeswehrkaserne
die auch für Geflüchtetenunterkünfte genutzt wurde, wurden schließlich 213 Plätze „zur Sicherung dieser auf der Straße lebenden Menschen“
227
�(Amt für Wohnen und Migration, 2012c: 1) geschaffen. In der Kältesaison 2012/2013 nahmen 1.764 Personen das Angebot wahr (vgl. Stelle für
Interkulturelle Arbeit, 2014: 15). Etwa 30 % waren rumänischer Nationalität, 22% bulgarischer, 15 % deutscher und jeweils etwa 5 % ungarischer,
italienischer und polnischer Nationalität (ebd.).
Im Herbst 2013 übernahm die Diakonie das Projekt Kälteschutz als Trägerin. Sie leitete nun die Kälteschutzeinrichtung in der Bayernkaserne
und zusätzlich eine ganzjährige Beratungs- und Streetwork-Einrichtung
im Bahnhofsviertel: die Schiller 25 – Migrationsberatung Obdachloser, ein
„Beratungsdienst für den Personenkreis […], der sich in München ohne
Ansprüche auf Unterbringung und ohne Perspektiven auf Wohnungsund Arbeitsmarkt aufhält“ (Amt für Wohnen und Migration, 2012c: 1).
In dem Antrag für das Projekt, dem der Stadtrat am 8. November 2012
zugestimmt hat, erklärt das Amt für Wohnen und Migration, es verfolge
„grundsätzlich die Strategie: niemand muss in München auf der Straße leben. Dennoch gibt es vielfältige Gründe, warum Menschen genau dies tun. In den Kältemonaten sind aber auch diese bereit, einen
Schutzraum aufzusuchen.“ (ebd.: 3)101
Sind wir im falschen Film? Nein, denn der Kälteschutz habe zwei Zielgruppen. Es gehe darum,
„eine bisher so nicht mögliche Kontaktbasis zu den obdachlosen Menschen [zu] schaffen, die in zwei Richtungen wirken soll: zum einen
die Anbindung ‚ortsansässiger‘, anspruchsberechtigter Personen ans
örtliche Hilfenetz mit dem Ziel der dauerhaften Versorgung mit einer
Wohnmöglichkeit, zum anderen die Beratung perspektivloser Zuwanderinnen und Zuwanderer.“ (ebd.: 3)
Beide Zielgruppen definiert sie noch näher:
„Die Armutszuwanderung v.a. aus den osteuropäischen Ländern hat
dazu geführt, dass sich Menschen in München aufhalten, die perspektivisch kaum eine Chance haben, sich selbst auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt zu versorgen. Zudem verfügt der überwiegende Teil der
101
Der Antrag sieht Kosten von 366.859 Euro für das Projekt vor (vgl.
Amt für Wohnen und Migration, 2012c).
228
�Zuwandernden im Heimatland über Wohnmöglichkeiten. Aufgrund
des subsidiären Charakters der Unterbringung in der Wohnungslosenhilfe werden Menschen, die in München keine Bleibe haben, nicht
untergebracht. Viele von ihnen kehren daher zurück in die Heimat,
ein Teil bleibt aber in München. Im Unterschied zu den sogenannten
„ortsansässigen“ Obdachlosen, die aus verschiedenen Gründen eine
Versorgung im Sofortunterbringungssystem der Stadt ablehnen und
„Platte machen“, wäre es für die vorgenannte Gruppe in der Regel besser, wieder in ihr Heimatland zurückzukehren, statt den Winter unter
härtesten Bedingungen hier auf der Straße zu verbringen.“ (ebd.: 4)
Hier sticht neben dem Paternalismus, der zu wissen scheint, was für die
obdachlosen Migrant*innen am besten ist, auch der methodologische
Nationalismus ins Auge: Am besten sei es, in das „Heimatland“ zurückzukehren. Die neu eingerichtete Beratungsstelle für „Menschen ohne
Perspektiven“ Schiller 25 war also primär als Rückkehrberatung gedacht
bzw. übernahm sie
„die Aufgabe der individuellen Information und Beratung, Perspektiven aufzuzeigen und als notwendig erkannte Hilfen hier in München
und im Heimatland darzulegen bzw. zu gewähren, sei es die Verweisung an andere Dienste oder bei fehlender Perspektive die Ausgabe von
Rückfahrscheinen ins Heimatland.“ (ebd.: 4)
Das Projekt soll also „Menschen ohne Perspektive“ über ihre vorhandenen und nicht vorhandenen Perspektiven in München beraten und
helfen, ihre Rückkehr ins „Heimatland“ zu organisieren. Dieser Widerspruch weist darauf hin, dass das Konzept der Einrichtung Schiller 25 implizit auf der Vorannahme aufbaut, dass wohnungslose Migrant*innen
keine Perspektive in München haben. Das Kälteschutzprojekt legte den
Schwerpunkt folgerichtig zum einen auf den Schutz vor dem Erfrieren,
zum anderen auf die Rückkehrhilfe. Diese Strategie bot zwar bei Minusgraden ein Dach über dem Kopf, schrieb aber sozialen Ausschluss und
Prekarisierung fort. Wie sich in dieser kurzen Genealogie der Obdachlosenpolitik gegenüber Unionsbürger*innen bis hierher gezeigt hat, legte
die Stadt München ihre sicherheitsrechtliche Verpflichtung, obdachlose Personen unterzubringen, in Bezug auf Unionsbürger*innen immer
restriktiver aus. Auf fast paradoxe Weise produzierte sie damit genau
229
�die Unterschiede, welche sie ihrer Politik zu Grunde legte. Ihre Politik
verwehrte den „Zuwander*innen“, die angeblich „keine Perspektive“ in
München hatten, den Anspruch auf Wohnraum, trug so zur Verunsicherung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse der EU-Migrant*innen bei
und war an der Produktion ihrer Armut und Obdachlosigkeit zentral beteiligt. Die Armut und „Perspektivlosigkeit“ wurde dann wiederum als
Problemlage, die nur durch die Individuen eigenverantwortlich zu beheben wäre, gedeutet und wiederum als Grundlage dafür genommen, den
Ausschluss zu legitimieren und auf humanitäre Notfallhilfe abzustellen.
Es überraschte mich wenig, dass der Tätigkeitsbericht 2014 der Kälteschutzeinrichtung Schiller 25 (Schiller 25 - Migrationsberatung Wohnungsloser, 2015) mit dem folgenden Zitat, das groß auf der zweiten
Seite des Berichtes prangt, eingeleitet wird: „Keine Macht der Welt wird
je bewirken können, dass eine neue künstliche Klassenordnung die natürliche Verschiedenheit der sozialen Gruppen aufhebt“ (ebd.: 2). Das
Zitat stammt von Heinrich von Treitschke, einem nationalistischen und
antisemitischen Historiker und späteren Reichstagsabgeordneten, der
Ende des 19. Jahrhunderts maßgeblich dazu beigetragen hat, den Antisemitismus salonfähig zu machen.102 Wie kam dieses Zitat in den Jahresbericht der Schiller 25? Ich gehe davon aus, dass den Verfasser*innen des
Berichtes der Hintergrund dieses Zitats, welches auch in Zitatsammlungen im Internet zu finden ist, nicht bewusst war. Aber auch ohne das
Wissen über den historischen Kontext verweist es, indem es von einer
‚natürlichen Verschiedenheit der sozialen Gruppen‘ ausgeht, auf den
Rassismus, welcher durch die städtische (Bio-)Politik, die die Grenzen
des „sozialverträglich Machbaren“ schützen möchte, artikuliert wird.
Runder Tisch Armutszuwanderung: Verfestigungstendenzen vermeiden
Als letztes Fragment in der Genealogie der Münchner Wohnungslosenpolitik gegenüber Unionsbürger*innen gehe ich auf den Bericht des
Runden Tisches Armutszuwanderung (Stelle für interkulturelle Arbeit,
2014) ein, der auf zwei Anträge der Fraktion Die Grünen/rosa liste zurückging: Diese beantragten im Jahr 2012, dass das Integrationskonzept
102
Sein Satz „Die Juden sind unser Unglück“ wurde zum Schlagwort der
Nazi-Zeischrift Stürmer.
230
�für „ZuwanderInnen aus neuen EU-Beitrittsländern“ erweitert werden
sollte (Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste, 2012) und im Jahr 2013,
dass ein Runder Tisch zum Thema ‚Armutszuwanderung‘ eingerichtet
werden sollte (Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/rosa liste &
Stadtratsfraktion SPD, 2013).
In dem Bericht zum Runden Tisch - der interessanterweise von der
Stelle für Interkulturelle Arbeit, die auch das Integrationskonzept geschrieben hatte, federführend verfasst wurde - geht es nicht nur um den
policy-Strang der Obdachlosenhilfe, sondern generell um den Umgang
mit „hilfebedürftigen Zuwander*innen aus den EU-Beitrittsländern“
bzw. um „Armutszuwanderung“. Er zeigt, wie die Problematisierung
der „Armutszuwanderung“ in Zeiten des Integrationsparadigmas die
Aufteilung in „gute“ und „schlechte“ Migrant*innen zugrunde liegt. Auf
der einen Seite betont der Bericht ganz im Sinne des Münchner Integrationskonzepts:
„München ist seit jeher eine Zuwandererstadt, sie will und braucht Zuwanderung. Zuwanderung aus dem Ausland prägt das Stadtbild mit,
gestaltet die vielfältige, offene und tolerante Gesellschaft und trägt zur
prosperierenden Wirtschaftslage bei. München profitiert von Europa
und den binneneuropäischen Wanderungsbewegungen. Stadt und Umland benötigen Zuwanderung, um den z.T. akuten Fachkräftemangel
[ ] zu bewältigen.“ (Stelle für interkulturelle Arbeit, 2014: 1)
Eine solche, für das Wirtschaftswachstum benötigte Zuwanderung stelle die ‚Armutszuwanderung‘ aber eben nicht dar, wie klar wird, wenn
wir weiterlesen:
„Herausforderungen für die Stadtgesellschaft entstehen dort, wo es
Zuwanderinnen und Zuwanderern nicht gelingt, zügig an wichtigen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben: sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit unterhaltssicherndem Einkommen,
Wohnraum, Bildung, Gesundheit, Sprache. Große Schwierigkeiten haben Menschen ohne berufliche Qualifikationen und/oder ohne Sprachkenntnisse. Die Zahl dieser Menschen ist in den letzten Jahren spürbar
gestiegen.“ (ebd.: 2)103
103
Dabei geht es in dem Bericht bezeichnenderweise nur um Bulgar*inenn
und Rumän*innen: „Am offensichtlichsten sind diese Probleme bei Migrantin-
231
�Die Gruppe der ‚Zuwanderer*innen‘, die für die ‚Willkommenskultur‘ des Integrationskonzepts eine Herausforderung darstelle, wurde
zum eigenen Politikfeld abgespalten. Als zentrale Handlungsbereiche dieses Politikbereichs wurde neben „Öffentlicher Raum: Wildes
Campieren“, „Betteln und organisierte Bettelbanden“ sowie „Prostitution“ auch „Wohnen“ ausgemacht (ebd.).
Migrant*innen litten „unter dem akuten Mangel an Wohnraum im
unteren Preissegment“ (ebd.: 15). Wohnraum sei aber „die unerlässliche Voraussetzung, um sich in eine Stadtgesellschaft zu integrieren, eine Arbeit zu finden, die Sprache zu lernen oder eine Schule
zu besuchen“ (ebd.) bzw. „eine wichtige Voraussetzung für eine Zuwanderung mit dauerhafter Perspektive“ (ebd.: 14). Um eine „nicht
gerechtfertigte Inanspruchnahme der bereits völlig überlasteten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zu verhindern“ (ebd.: 15), würden jedoch nur Personen untergebracht, die nachweisen könnten,
dass sie über keinen Wohnraum im Heimatland, dafür aber über eine
Anmeldung in München verfügten und versucht hätten, sich selbst
zu helfen:
„In das Notsystem für Wohnungslose wird nur aufgenommen, wer
unfreiwillig in München wohnungslos geworden ist. Die Unterbringung von Zuwanderinnen und Zuwanderern ist nicht Aufgabe der
Wohnungshilfe und übersteigt sowohl die Verpflichtung als auch die
realen Möglichkeiten der Landeshauptstadt München. Sie könnte
außerdem einen Anreiz darstellen, auf einfachem Niveau kostengünstig oder kostenfrei untergebracht zu werden.“ (ebd.)
Die Autor*innen sehen aber Handlungsbedarf bei dem Aufbau des
Kälteschutzes und der Verknüpfung mit Beratungsangeboten. Besonders zu schützen seien Frauen und Kinder.
nen und Migranten aus Bulgarien und Rumänien. Deswegen befasst sich diese
Vorlage mit Personen aus diesen Staaten. Die Ergebnisse und Vorschläge sind
jedoch auch auf Zuwanderinnen und Zuwanderer anderer Staaten übertragbar,
soweit sie sich in ähnlichen Situationen befinden“ (Stelle für interkulturelle
Arbeit, 2014: 3). Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass alle Angehörigen
dieser Staaten generell zu der abgewerteten Gruppe gehören.
232
�In einer Städtischen Leitlinie zum Umgang mit Armutszuwander*innen
schreibt der Bericht die umkämpfte Politikassemblage bis auf Weiteres fest:
„Grundsätzlich ist jeder Mensch willkommen, der nach München ziehen und sich hier einbringen möchte. Die Menschen haben Zugang
zu den allgemeinen und speziellen Beratungsleistungen der Stadt und
anderer Träger. Dabei wird auf die Eigenverantwortung der Menschen
abgestellt. Über Perspektiven bzw. nicht vorhandene Perspektiven in
München wird offen und klar informiert. Gesetzliche Leistungen erhalten alle, bei denen die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Freiwillige Leistungen werden im Rahmen humanitärer Nothilfe gewährt.
Im Bereich der Eingriffsverwaltung wird gegen ordnungs- oder rechtswidriges Verhalten konsequent vorgegangen. Insgesamt geht es auch
darum, dass unnötige Anreizeffekte vermieden werden müssen. Alle
städtischen Maßnahmen werden vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getragen. Auch bei einem konsequenten Vorgehen wird also jeder
Einzelfall mit Augenmaß behandelt.“ (ebd.: 40)
Neben der „Willkommenskultur“, der Konzentration auf Beratungsangebote, der humanitären Nothilfe, der Einzelfallprüfung und dem ordnungspolitischen Durchgreifen wurde Abschreckung als weiteres Ziel
in die städtische Politik gegenüber EU-interner Migration eingeschrieben. Dies war aber durchaus umkämpft, nicht alle städtischen Akteure
waren einverstanden. So stellt die hier zitierte Fassung der Städtischen
Leitlinie schon einen Kompromiss dar, der in einer heftigen Diskussion
im Stadtrat geschlossen worden war. Wo hier steht, „dass unnötige Anreizeffekte vermieden werden müssen“ (ebd.), galt es in der mir vorliegenden vorherigen Version, „keine Anreize zur Nachahmung zu geben
und Verfestigungstendenzen zu vermeiden“. Die Debatte fand mitten
im Kommunalwahlkampf statt. Die Süddeutsche Zeitung betitelte ihren
Artikel vom 15. Februar 2014 zum Konflikt um die Leitlinie, bei dem die
Sozialreferentin (SPD) nicht gut weggekommen sei, weil sie eine harte Abschreckungspolitik vertreten habe, mit: Eine Frage der Kälte. Ihre
„harte Haltung“ habe die Sozialreferentin im
„Intranet für die Mitarbeiter des Sozialreferats verteidigt: ‚Im letzten
Jahr wurden wir zweimal mit vollbesetzten Reisebussen konfrontiert,
233
�deren Reiseleiter explizit nach unseren Kälteschutzplätzen nachgefragt
haben‘. Das Sozialreferat wolle ‚Menschen in Not ein humanitäres Angebot machen, das vor Gesundheitsschäden schützt, aber wir wollen
kein kostenfreies Wohnheim betreiben‘. In ihrer harten Haltung kann
sie sich durch die Demonstration von Wohnungslosen aus Bulgarien
und der Initiative Zivilcourage bestätigt sehen, die gefordert haben,
den Zugang zu der Notunterkunft des Kälteschutzprogrammes unabhängig von Außentemperaturen Tag und Nacht freizugeben.“ (Loerzer,
2014)
Konflikt um Wohnraum IV: Kundgebung gegen
Null-Grad-Regelung
Ein lauter Sprechchor durchzog die dunklen, winterlich kalten Straßenzüge des Bahnhofsviertels. „Wir wollen Wohnen!“ Auf den Schildern der
Kundgebung stand: „Wir wollen Anmeldung: Ohne Anmeldung, keine
Arbeit!“ - „Wir fordern Decken!“ - „We demand shelter above and below
0°!“ Außerdem gab es auch bulgarisch- und türkischsprachige Schilder.
Im Februar 2014 protestierten etwa 200 Personen vor der Schiller 25, um
Wohnraum für alle und auf dem Weg dorthin die Öffnung der Kälteschutzeinrichtung auch bei Plustemperaturen zu fordern. Zu dieser Demonstration hatten EU-migrantische Arbeiter*innen gemeinsam mit der
Initiative Zivilcourage aufgerufen. Mindestens 100 Polizeibeamt*innen
riegelten das Gebäude ab. Journalist*innen der SZ, des BR und des Merkur waren vor Ort, sicherlich auch, weil vor einer Hausbesetzung gewarnt worden war. „Da Hinweise vorliegen, dass im Zusammenhang
mit der Kundgebung auch rechtswidrige Übergriffe auf die Beratungsstelle Schiller 25 geplant sind“ (Sozialreferat & Evangelisches Hilfswerk,
2014), so die gemeinsame Pressemitteilung des Sozialreferats und des
Evangelischen Hilfswerks, sei diese aus Sicherheitsgründen geschlossen
worden. Die Pressemitteilung kritisiert die Kundgebung gegen die NullGrad-Regelung: „Aktionen dieser Art konterkarieren unsere bislang
erfolgreichen Hilfebemühungen und helfen den betroffenen Menschen
nicht weiter.“ Zudem spricht sie sich vehement gegen die Forderungen
nach einem Schlafplatz auch bei Temperaturen über null Grad aus:
234
�„Diese Forderung konterkariert [...] die Zielsetzung der Münchner
Wohnungslosenhilfe, deren Ziel ‚Wohnen statt Unterbringung‘ ist.
Die Verfestigung perspektivloser Lebensverhältnisse, Ausbeutung und
Schwarzarbeit kann und will das Sozialreferat nicht fördern.“ (ebd.)
Des weiteren rechtfertigt die Pressemitteilung den Ausschluss der EUMigrant*innen aus den regulären Unterkünften mit dem Schutz der lokalen Bevölkerung vor „Verdrängungseffekten“:
„Das Sozialreferat hat die Regelsysteme der Wohnungslosenhilfe und
das humanitäre Kälteschutzprogramm strikt getrennt und damit erreicht, dass es zu keinen Verdrängungseffekten wie in vielen anderen
Städten gekommen ist. Damit wurde verhindert, dass anspruchsberechtigte wohnungslos gewordene Münchnerinnen und Münchner, z.B.
nach einer Wohnungsräumung abgewiesen werden mussten.“ (ebd.)
Nicht nur ‚echte Münchner*innen‘ würden letztendlich geschützt, sondern auch die Betroffenen selbst, diesmal vor Ausbeutung, denn:
„[d]ie Forderung nach einer durchgehenden Öffnung der Kälteschutzräume würde dazu führen, dass die Stadt mittelbar Ausbeutung und
illegale Beschäftigungsverhältnisse, deren Ertrag offenkundig nicht
einmal zur Finanzierung eines Wohnplatzes ausreicht, subventionieren würde.“ (ebd.)
In diesem Konflikt zeigte sich noch einmal deutlich die in den vorangegangenen Jahren entwickelte Exklusionslogik der Kommunalpolitik
und ihres erweiterten Netzwerkes. Es werden zwei sich verschränkende Grenzen gezogen: zum einen zwischen Münchner*innen und NichtMünchner*innen, die tendenziell nationalstaatlichen Kategorien folgt;
zum anderen wird zwischen Menschen „mit Perspektive“ und denjenigen „ohne Perspektive“ unterschieden. Mit einem Verweis auf knappe
Ressourcen wird der Ausschluss der Nicht-Münchner*innen dann mit
dem Wohl der Münchner Obdachlosen gerechtfertigt. Neben dieser biopolitischen Rationalität des „Ausschluss als Schutz“ zeichnete sich eine
paternalistische Aktivierungslogik ab: Der Ausschluss komme den Ausgeschlossenen selbst zu Gute, deren „perspektivlose[n] Lebensverhältnisse“ (ebd.) durch den „Hängemattenstaat“ (vgl. Schröder & Blair, 1999)
235
�nur verfestigt würden. In einer freiwilligen, humanitären Geste biete die
„Weltstadt mit Herz“104 den „perspektivlosen Armutszuwander*innen“
aber ein „europaweit einmalige[s] Beratungsangebot“ (Sozialreferat &
Evangelisches Hilfswerk, 2014) und bewahre sie mit den Kälteschutzräumen vor dem Erfrieren. Diese Politik, so meine These, folgt nicht nur
der rassistischen Vorstellung einer „natürliche[n] Verschiedenheit der
sozialen Gruppen“ (Schiller 25 - Migrationsberatung Wohnungsloser,
2015: 2), sondern hält diese durch die Exklusion der Betroffenen aus der
Münchner Bürgerschaft auch aufrecht.
Der rassistischen Logik der Kommunalpolitik entsprechend erscheinen
die Nutzer*innen des Kälteschutzprogramms nicht nur als „perspektivlos“, vielmehr wird ihnen auch jede Stimme und Handlungsmacht
zur Veränderung ihrer sozialen Verhältnisse abgesprochen. Vor diesem
Hintergrund erstaunt es wenig, dass die selbstorganisierte Demonstration, mit der die EU-Migrant*innen an die Öffentlichkeit traten und
so auf gesellschaftlichen Antagonismen (statt natürlichen Ordnungen)
aufmerksam machten, beim Sozialreferat und dem Evangelischen Hilfswerk auf Empörung trafen. Auch die SZ brachte den Protest noch in direkten Zusammenhang mit den migrationspolitischen Aushandlungen
im Stadtrat (vgl. Loerzer, 2014).
Inwiefern die Kundgebung und die durch sie erreichte öffentliche Aufmerksamkeit dazu beitrugen, dass ab dem Winter 2013/2014 die Kälteschutzeinrichtung von Oktober bis Ende März zwar immer noch tagsüber schloss, aber jeden Tag (unabhängig von der Wettervorhersage)
ihre Türen öffnete, kann nicht nachvollzogen werden.
104
‚Weltstadt mit Herz‘ war bis 2005 der Slogan einer Marketingkampagne der Stadt München.
236
�Multiple Grenzziehungen
In der Analyse der Aushandlungen der Obdachlosenpolitik gegenüber Unionsbürger*innen zwischen den Jahren 2006 und 2014 in
München hat sich gezeigt, wie in „generations of turf wars“ (Sciortino 2004) ein umkämpftes Patchwork an Versuchen des Regierens entstand, das verschiedene Ansätze, Akteure und Institutionen
miteinander verband und dabei zwar keiner einzelnen Logik folgte,
aber die doppelte Grenzziehung, die im letzten Unterkapitel skizziert wurde, schließlich doch zum hegemonialen, wenn auch immer
wieder angegriffenen, Konsens machte. Die Art und Weise, wie die
Kommune hier ihre eigenen Grenzen zog, widerspricht dabei zwar
nicht der These, dass in Kämpfen um urban citizenship das Potenzial
liegt, nationalstaatliche Ausgrenzungen zu überkommen, indem residency statt Nationalität zur Grundlage für Bürgerschaftsrechte wird.
Sie zeigen aber, dass auch Städte ihre Bürgerschaft exklusiv gestalten
können.
Während das Sozialreferat sich im Jahr 2006 – bevor ‚Armutszuwanderung‘ zum ‚Problem‘ wurde – noch verpflichtet sah, auch EU-migrantische Obdachlose unterzubringen, und dazu sogar einen Sondertopf von 100.000 Euro bereitstellte, hatte es sich dieser Verpflichtung
bis 2014 mit der kreativen Erfindung einer Vielzahl an Ausschlusskriterien und Verantwortungsverschiebungen fast gänzlich entledigt. Eckpunkte der Aushandlungen stellten die sicherheitsrechtliche Verpflichtung zur Unterbringung unfreiwillig Obdachloser und
die sozialpolitischen Paradigmen des Integrationskonzepts sowie
des Konzeptes Wohnen statt Unterbringen dar. Hinzu kam die Rede
von der Knappheit der Ressourcen, die einen weiteren Ausbau der
Unterbringungsmöglichkeiten unmöglich machte. Diese wird allein
schon durch den Fakt, dass zwischen dem Jahr 2002 und dem Jahr
2010 knapp 3.000 Plätze im Notunterkunftssystem abgebaut worden
waren, widerlegt (vgl. Amt für Wohnen und Migration, 2010: 13).
Es handelte sich bei der Gestaltung der Obdachlosenpolitik gegenüber Unionsbürger*innen also um politische Entscheidungen, die in
politischen Auseinandersetzungen getroffen wurden. Die kommunalpolitischen Auseinandersetzungen nahmen in diversen Runden
Tischen, in denen Netzwerke geknüpft und Informationen sowie
237
�Analysen zusammengetragen wurden, ihren Anfang und wurden
durch verschiedene Anträge und Diskussionen im Stadtrat und in anderen Zusammensetzungen weitergeführt.
Die dargestellte kommunalpolitische Leitlinie kann auf wenige
Stichworte heruntergebrochen werden: Bekräftigung des nationalstaatlichen Ausschlusses von arbeitssuchenden Unionsbürger*innen
von sozialen Leistungen, aktivierende Sozialarbeit für Münchner
Bürger*innen ‚mit Perspektive‘, Rückkehrberatung und humanitärer
Schutz vor dem Erfrieren für ‚perspektivlose Zuwander*innen‘. Es handelte sich um keinen pauschalen Ausschluss, denn prinzipiell konnten
auch EU-migrantische Arbeiter*innen als Münchner Bürger*innen anerkannt werden. Die bürokratischen Hürden waren allerdings extrem
hoch und wurden von den Praktiken des gate-keeping der street-level
bureaucrats im Amt für Wohnen und Migration noch verstärkt – zumindest war dies meine Erfahrung, wenn ich mit obdachlosen EUMigrant*innen versuchte, ihr Recht auf Unterbringung durchzusetzen.
Die EU-Migrant*innen wurden aus den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen ausgegrenzt – sie wurden weder zu den Runden
Tischen (mit Ausnahme des Runden Tisches bei ver.di) noch zu anderen Gesprächen eingeladen bzw. teilweise explizit ausgeladen (wenn
die Initiative Zivilcourage forderte, auch Arbeiter*innen einzuladen).
Aus der Perspektive der Autonomie der Migration ist aber festzustellen, dass ihre hartnäckigen transnationalen Migrationsprojekte sich
(anders als das Sozialreferat anfangs prognostiziert hatte) nicht abschrecken ließen und die Versuche, sie zu regieren, so vor sich her
trieben. An den aufgeregten Reaktionen auf die zwei in diesem Kapitel
beschriebenen kollektiven Ausdrücke von representational politics (der
‚Sturm auf’s Amt‘ und die Kundgebung gegen die Null-Grad-Regelung) wurde deutlich, dass die kommunalpolitischen Akteure durchaus Respekt vor den Bewegungen der Migration hatten. Die Betonung
der Autonomie der Migration soll aber nicht davon ablenken, dass die
doppelte Grenzziehung der Kommunalpolitik die differenzierte Inklusion der EU-Migrant*innen unter extrem verunsicherten Verhältnissen (re-)produzierte und so eine Zone in der Stadtgesellschaft schuf,
die mit einer weitgehenden sozialen und politischen Entrechtung und
überausbeuterischen Arbeitsverhältnissen verbunden war. Viele der
Personen, die ich im Workers’ Center kennengelernt habe, leben und
238
�arbeiten schon seit Jahren in München und geraten immer wieder in
die Situation der Obdachlosigkeit.
Nachtrag
Im März 2016, zwei Monate vor Abgabe meiner Dissertation, die diesem Buch zugrunde liegt, haben EU-migrantische Arbeiter*innen und
die Initiative Zivilcourage mit dem Kampagnen-Bündnis „Wir wollen
wohnen – Wohnraum für alle“ gefordert, dass die Stadt München unfreiwillig wohnungslosen Menschen ganzjährig und ganztägig eine
menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung stellt und Möglichkeiten schafft, sich trotz Obdachlosigkeit melderechtlich in München zu
registrieren (Initiative Zivilcourage, 2017a). Die Kampagne bestand
aus drei Säulen: Demonstrationen gegen die städtische Politik inklusive Öffentlichkeitsarbeit (vgl. etwa Rahmsdorf, 2016), Unterstützung
von Klagen vor dem Verwaltungsgericht und Zusammenarbeit mit
Kommunalpolitiker*innen. In der Folge ergaben sich weitere Entwicklungen. Die Grünen haben im Stadtrat einen Antrag gestellt, dass die
Stadt das Kälteschutzprogramm auch außerhalb der Kälteschutzperiode
zur Verfügung stellen soll. Das Bayerische Verwaltungsgericht München lehnte den Eilantrag einer obdachlosen Person auf Unterbringung
zwar ab, stellte gleichzeitig aber klar, dass die Zuständigkeit zur Unterbringung bei der Kommune des aktuellen Aufenthaltes liegt und unabhängig vom vorherigen Wohnort ist.105 Die meisten der Nachweise,
die das Wohnungsamt zur Unterbringung verlangte – zum Beispiel den
Arbeitsvertrag, Gehaltsabrechnungen und die Anspruchsklärung beim
Jobcenter – tun also auch nach Auffassung des Verwaltungsgerichts
nichts zur Sache, wenn obdachlose Personen eine Notunterbringung
beantragen. Im Jahr 2017 schloss der Kälteschutz erst Ende April, also
einen Monat später als noch ein Jahr zuvor.
Im Sommer 2017 klagte Hristo Vankov, mit dem ich das erste Mal im
Wohnungsamt eine Notunterbringung beantragt hatte, erfolgreich gegen seine Ausgrenzung aus den städtischen Notquartieren (vgl. Initiative Zivilcourage 2017b). Das Bayerische Verwaltungsgericht München
verpflichtete die Stadt München mit Beschluss vom 09.08.17 dazu, ihm
105
Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom
18.04.2016, M 22 E 16.1517.
239
�eine Notunterkunft zuzuweisen.106 Die Dienstanweisungen des Amtes
für Wohnen und Migration waren also auch aus der Perspektive des Gerichts in vielen Punkten rechtswidrig. Im Sinne des Gerichts durfte das
Wohnungsamt weder die Klärung des Sozialhilfeanspruchs noch den
amtlichen Nachweis aus dem Herkunftsort, dass auch andernorts kein
Wohnraum zur Verfügung steht, als Bedingung für die sofortige Unterbringung von Hristo Vankov stellen. Dieser Sieg traf auf relativ großes
Medienecho: „Mutiger Mann – Obdachloser erkämpft vor Gericht eigene Unterkunft“ titelte die österreichische Zeitung Heute (Redaktion
heute.at, 2017) und auch die SZ (Anlauf, 2017) und weitere Medien berichteten.
Doch für Hristo Vankov kam dieser Erfolg sehr spät – er starb schon
knappe zwei Monate später am 05.10.2017 im Krankenhaus der Stadt
Pazarjik an den Folgen seiner Diabeteserkrankung. Mitte September
war er kurzfristig nach Bulgarien gereist, um dort Dokumente zu besorgen, die hier von ihm für die Verlängerung der Unterbringung verlangt
wurden. Er wurde 57 Jahre alt. Fast 13 Jahre hatte er sich mit prekären
Jobs im Bau- und Reinigungsgewerbe in München durchgeschlagen.
Fast durchgängig lebte er auf der Straße, nur hin und wieder fand er
eine vorübergehende Bleibe. Durchzuhalten war dies offenbar nur, weil
er nicht alleine war, sondern sich durch dieses harte Leben gemeinsam
mit Freund*innen kämpfte, die sich ebenfalls am Rande der Stadtgesellschaft durchschlagen mussten. Doch die Entbehrungen des obdachlosen
Lebens beeinträchtigten seine Gesundheit. Schon länger bereitete ihm
seine Diabetes Beschwerden, regelmäßig musste er deswegen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ohne Krankenversicherung erhielt er aber
keine reguläre, kontinuierliche Behandlung und das entbehrungsreiche
Leben auf der Straße tat das seinige. Hristo Vankov bekam zwar Insulin
von der Kirche und im Winter konnte er in der städtischen Kälteschutzeinrichtung schlafen – mit dieser humanitären Nothilfe schaffte er es
über einige Jahre von Tag zu Tag über die Runden zu kommen. Es reichte aber nicht, um den Teufelskreis – keine Wohnung also keine Arbeit
also keine soziale Absicherung also keine Wohnung – zu durchbrechen.
Mit der Initiative Zivilcourage schrieben wir einen Nachruf, von dem ich
hier einen kleinen Ausschnitt wiedergeben möchte:
106
Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom
09.08.2017, M 22 E 17.3587.
240
�„Der Tod Hristos, der trotz seiner eigenen Not anderen gegenüber immer solidarisch war und bei Protesten für das Recht auf Wohnraum
und soziale Absicherung regelmäßig vorne mit dabei war, macht uns
unsagbar traurig, fassungslos und auch zornig. [...] Wir werden ihn
nicht vergessen und weiter vehement für Wohnraum und ein gutes Leben für Alle eintreten. Wir werden laut werden für und mit den Menschen, die diese Gesellschaft im Schatten ihres Reichtums einfach sterben lässt.“ (Initiative Zivilcourage, 2017c)
241
�Soziale Union oder nationale Souveränität des
Sozialstaats? Aushandlungen am EuGH
Neues Terrain
Dieses Kapitel eröffnet ein neues Terrain. Die Aushandlungen um die
Gestaltung des sozialen Gehalts der Europäischen Union wurden in
den letzten Jahren schwerpunktmäßig als juridische Prozesse am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ausgefochten. Besonders
umstritten war die Frage, inwiefern Nichterwerbstätige, die von ihrer
Freizügigkeit Gebrauch machen, berechtigt sind, soziale Leistungen zu
erhalten. Diese Aushandlungen möchte ich hier umreißen. Für diesen
Sprung weg von den lokalen Auseinandersetzungen in München hin zu
dem erst einmal trocken erscheinenden Rechtsprechungsdiskurs habe
ich mich aus verschiedenen Gründen entschieden. Erstens, weil die
Rechtsprechung des EuGHs die sozialen Rechte von nicht oder nicht-dokumentiert lohnarbeitenden Migrant*innen aus Bulgarien in München
stark beeinflusst haben, indem der Gerichtshof die EU-europäischen
Richtlinien mit geprägt hat. Zweitens, und in Bezug auf die Frage nach
dem Regieren, zeigt sich in diesem Diskurs, wie die Deutung der Migration Nichterwerbstätiger und damit verbunden die juridischen Versuche
des Regierens auf EU-Ebene umkämpft wurden und sich transformiert
haben – wie es gleichsam, und für viele unerwartet, zu einem Siegeszug der Figur ‚Sozialleistungstourismus’ gekommen ist. Drittens ist es
für die Frage nach dem Regieren interessant, inwiefern die Geschehnisse der verschiedenen Ebenen hier ineinander greifen, inwiefern die
eigentlich geltende Rechtsprechung die Gesetzgebung auf Bundesebene
und die lokalen Auseinandersetzungen beeinflusst und vice versa. So
ist die deutsche Gesetzgebung zwar über das EU-Recht und die Rechtsprechung des EuGHs beeinflusst, hat diese aber auch über einige Jahre
in Bezug auf die Ausschlussklausel im SGB II ignoriert. Denn die Frage
nach dem Ausschluss von nichterwerbstätigen Unionsbürger*innen von
sozialen Leistungen betrifft auch die deutsche Ausschlussklausel, mit der
die Bundesregierung Unionsbürger*innen, deren Aufenthaltsrecht sich
alleine aus der Arbeitssuche ergibt, aus dem Hartz IV ausgrenzt und die,
242
�wie im vorherigen Kapitel schon deutlich geworden ist, das Regime der
EU-internen Migration in München stark mitprägte. Viertens, auf politökonomischer Ebene, zeigt sich in den Aushandlungen am EuGH eine
weitere komplexe, spezifische Artikulation des Antagonismus zwischen
migrantischer Arbeit und ihrer Prekarisierung, zwischen Ausbeutung
und Kontrolle – beziehungsweise der Konflikt zwischen verschiedenen
Versuchen ihrer Bearbeitung: die Ebene des nationalen Sozialstaats und
der europäischen Union sowie die jeweils institutionellen Eigenlogiken
dieser Staatsprojekte. Die Frage, welche neuen Formationen aus diesem
Konflikt entstehen, kann als eine zentrale Frage der aktuellen historischen Konjunktur gelten. Schließlich liest sich diese Auseinandersetzung wie ein höchst spannender Krimi, der durch die spezifische juridische Form zwar der Öffentlichkeit und dem allgemeinen Verständnis
entzogen wird, dessen Spannung und Relevanz ich hier aber auch für
nicht-juridische Intellektuelle (und am besten auch Nicht-Intellektuelle)
nachvollziehbar machen möchte.
Meinen Zugang zu diesem Krimi habe ich insbesondere der
Habilitationsarbeit der materialistischen Staatstheoretikerin Sonja Buckel (2013) zu verdanken, auf die ich mich in weiten Teilen dieses Kapitels auch beziehen werde. Sie hat die juridischen Auseinandersetzungen,
bei denen der Zugang von nichterwerbstätigen Unionsbürger*innen
verhandelt wurde, anhand von vierzehn Rechtssachen am EuGH zwischen den Jahren 1998 und 2009 diskursanalytisch und staatstheoretisch untersucht. Nach Buckel lassen sich „die sozialen Rechte der
Unionsbürger*innen […] in ihrer historischen Kontingenz und Ereignishaftigkeit aufzeigen“ (Buckel, 2013: 98). Gerade der Ereignishaftigkeit
und Kontingenz nachzuspüren ist auch das Ziel der ethnografischen Regimeanalyse, die ich hier also um eine Diskursanalyse der Aushandlungen am EuGH erweitere. So möchte ich die Kontinuitäten und Transformationen der Konfliktlinien, Argumente und Strategien zur Frage des
sozialen Europas, wie sie am EuGH zum Tragen kamen, herausarbeiten.
Die Verhandlungen am EuGH sind Teil der Auseinandersetzungen
um den sozialen Gehalt der Europäischen Union und damit gleichzeitig auch um die Europäisierung der staatlichen Souveränität in einem ihrer Kernbereiche. Nicht erst seit den Verhandlungen im Vorfeld des britischen Volksentscheids zum sogenannten Brexit, in denen
der britische Premier David Cameron öffentlichkeitswirksam forderte,
Unionsbürger*innen während der ersten vier Jahre ihres Aufenthalts
243
�von sozialen Leistungen auszuschließen, ist das Thema auf der Tagesordnung. Schon seit der Gründung der damaligen EG wurden Forderungen nach einer „Union der Bürger“107 und einer „sozialen Union“ laut,
die auf den Widerstand von Seiten der konservativen Kräfte, die die
nationale Souveränität bedroht sahen (vgl. Greiser, 2014), und nationalsozialer Kräfte, die gegen die Liberalisierung des Sozialen eintraten, trafen. Wirtschaftsliberale Kräfte standen dem Projekt der sozialen Union
fast überraschend neutral gegenüber, wie Sonja Buckel beschreibt, während die Diagnose eines „sozialen und demokratischen Defizits“ der EU
hegemonial wurde (Buckel, 2014: 162f.). Gerade zu Zeiten der Krise der
EU, wie etwa im Zusammenhang mit dem Scheitern der europäischen
Verfassung im Jahr 2005 in Frankreich, traten auch liberale proeuropäische Stimmen für die Europäisierung der Sozialsysteme und für mehr
Teilhabemöglichkeiten der Bürger in der EU ein, um so die Akzeptanz
der EU zu vergrößern und die europäische Integration zu fördern. Aus
den Turbulenzen der Krise seit dem Jahr 2008, in der die neoliberalen
Ordnungen kurzzeitig ins Wanken gerieten, sind aber austeritäre Bearbeitungsweisen unter der Dominanz Deutschlands und auch der anderen EU-europäischen Kernstaaten gestärkt hervorgegangen. Das Projekt
Sozialunion wird heute eher als Bedrohung wahrgenommen und mit
der Figur ‚Sozialtourismus‘ verknüpft als mit dem Versprechen einer gerechteren, sozialeren europäischen Integration. Das europäische Projekt
konsolidiert sich stärker durch seine Abgrenzung nach Außen als durch
eine soziale Integration im Inneren.
Wenn es nun um die Aushandlungen der sozialen Rechte von nichterwerbstätigen Unionsbürger*innen geht, dann treffen sich diese verschiedenen Rationalitäten und Interessen in der spezifischen Diskursform des
Rechts. Der Fortgang der Aushandlungen ist dabei nicht vorherzusehen,
sondern hängt von der Findigkeit und Imagination sowie den Kräfteverhältnissen und sicherlich auch von dem unberechenbaren Zusammentreffen von Umständen ab. Auch hier sind es nicht zuletzt die ständigen,
107
Das ‚Europa der Bürger*innen‘, verbunden mit einer Kritik an der
marktorientierten Integrationsweise der Europäischen Union und an nationalen Zuordnungen, ist eine linke Idee mit langer Tradition. Neben politischen
Rechten sind es auch soziale Rechte, die in einem transnationalen, europäischen, demokratischen Raum verankert werden sollen, sie stehen aber nicht
unbedingt dezidiert im Mittelpunkt. Es sind vor allem linke Intellektuelle, die
die Idee des ‚Europas der Bürger*innen‘ vertreten. (Vgl. Balibar, 2003; Buckel,
2013: 166)
244
�vorläufigen und kontingenten Reparaturarbeiten, die zu Gestaltung
der Realität führen. Es gibt aber einen rechtlichen und institutionellen
Rahmen, in dem die Aushandlungen stattfinden und der im Folgenden
in Bezug auf die Fragen der Freizügigkeit, der Unionsbürgerschaft und
dem Zugang zu sozialen Rechten umrissen werden soll.
Rechtlicher Rahmen in the making
Die Europäische Union wird im Wesentlichen geregelt von Primärrecht,
wie dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV,
früher auch EWG und EG genannt)108, und von Sekundärrecht, das unter
anderem aus Richtlinien und Verordnungen besteht, die das Primärrecht
auslegen und präzisieren. Diese (den Verträgen sekundären) Regelungen
werden vom Europäischen Parlament und dem Ministerrat beschlossen
und sind Ergebnisse von meist zähen Verhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten. Eine Schieflage zwischen ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten war schon in den Römischen Verträgen, bzw. dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) von 1957
angelegt. Dieser Vorgänger des AEUV und Grundstein der heutigen EU
legte die vier zu verwirklichenden Grundfreiheiten des EWG-Binnenmarktes fest: der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital
und Personen. Der freie Verkehr von Personen wurde für Urlaubsreisende, Unternehmer*innen und Arbeitnehmer*innen verwirklicht. Hier
entstand die Arbeitnehmerfreizügigkeit.
1968 erließ der Rat eine Verordnung, die die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer*innen und ihrer Familien näher regelte.109 Daraufhin
nahm der Europäische Gerichtshof den Ball auf und erarbeitete nach
und nach eine sehr weite Definition des Arbeitnehmerbegriffs, die Teilzeitbeschäftigte, Sexarbeiter*innen, Auszubildende und Fußballspieler
*innen einschloss (vgl. Buckel, 2014: 95). Er bezog sich dabei auf den
Begriff der Grundfreiheit in seiner neoliberalen Auslegung: das Humankapital müsse als Produktionsfaktor effizient verortet werden kön108
Der AEUV wurde 1957 in Rom als Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EWG) geschlossen und 1992 durch den Vertrag von
Maastricht in EG-Vertrag umbenannt. Seinen jetzigen Namen trägt er seit dem
Vertrag von Lissabon von 2009.
109
Verordnung Nr. 1612/68 vom 15.10.1968
245
�nen, dafür sei die Integration in das „sozioökonomische Netzwerk des
Aufnahmemitgliedsstaates“ (Lenaerts/ & Heremans, 2006: 103, zit. n.
Buckel, 2014: 95) nötig. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit darf nicht mit
einer Personenfreizügigkeit verwechselt werden, denn sie galt nur für
das Humankapital, also diejenigen Personen, die nach den Gesetzen als
Erwerbstätige - im Jargon der EU als active persons - gelten. Erst 1990
verabschiedete die EU einige Richtlinien, die die Freizügigkeit auch für
Nicht-Erwerbstätige festlegte: für Rentner*innen, für Studierende und
schließlich auch für diejenigen, die von den anderen Richtlinien nicht erfasst waren.110 Die Letzterwähnte zog jedoch scharfe ökonomische Grenzen. Die Freizügigkeit von Personen ohne Arbeitnehmer*innenstatus
bestand nämlich nur bei Nachweis ausreichender Mittel zum Lebensunterhalt und schloss den Bezug von Sozialhilfeleistungen aus.111 Der
Kampf um die Europäisierung der Sozialsysteme wurde Anfang der
1990er Jahre als so gut wie verloren betrachtet. Hier ist zu beachten,
dass die Richtlinien ein Ergebnis der Aushandlungen zwischen proeuropäischen Kräften und solchen Kräften, die für die nationale Wohlfahrtssouveränität eintreten da sind. Tendenziell sind sie aber stärker von den
Interessen an nationaler Souveränität geprägt als die Urteile des EuGHs,
weil die Mitgliedsstaaten direkt an ihrer Ausformulierung beteiligt sind.
Die Einführung der Unionsbürgerschaft im Jahr 1992 machte dann, auch
wenn sie von den meisten kontemporären Kritiker*innen als nicht sehr
weitreichend beurteilt wurde, den Anfang für einen von vielen unerwarteten Umschwung (vgl. Buckel, 2014: 90). Bei den Aushandlungen
110
RL 90/365/EWG des Rates vom 28.6.1990 über das Aufenthaltsrecht der
aus dem Erwerbslosen geschiedenen Arbeitnehmer und selbstständigen Erwerbstätigen, ABIEG 1990 Nr. L 180: 28; RL 93/96/EWG des Rates vom 29.10.1993
über das Aufenthaltsrecht der Studenten, ABIEG 1993 Nr. L 317: 59; RL 90/364/
EWG des Rates vom 13.7.1990 über das Aufenthaltsrecht, ABIEG 1990 Nr. L a
180: 26.
111
„Die Mitgliedstaaten gewähren den Angehörigen der Mitgliedstaaten, denen das Aufenthaltsrecht nicht aufgrund anderer Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts zuerkannt ist, sowie deren Familienangehörigen […] unter der Bedingung das Aufenthaltsrecht, dass sie für sich und ihre Familienangehörigen über eine Krankenversicherung, die im Aufnahmemitgliedstaat
alle Risiken abdeckt, sowie über ausreichende Existenzmittel verfügen, durch
die sichergestellt ist, dass sie während ihres Aufenthalts nicht die Sozialhilfe
des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen” (Art. 1 Abs. 1 RL
90/364/EWG).
246
�der Verträge von Maastricht brachte Felipe Gonzales, spanischer Ministerpräsident, die Idee der Unionsbürgerschaft ein (vgl. Shore, 2004: 33).
Der neue Status war noch mit keinem neuen Inhalt gefüllt und hatte fast
ausschließlich symbolisch-deklaratorischen Charakter. Unionsbürger*in
zu sein schien nicht mehr oder weniger zu bedeuten, als Bürger*in eines
Mitgliedsstaates zu sein.112 Trotzdem wurde so neben Staatsbürger*innen
und Ausländer*innen eine dritte grundlegende Kategorie geschaffen,
die über die nationalstaatliche Logik hinausgehen sollte und die somit
Anhaltspunkte für Transnationalisierungsprozesse schuf. Und tatsächlich traf der Europäische Gerichtshof in den folgenden Jahren einige
für Furore sorgende Entscheide, in denen er Nichterwerbstätigen sowie Arbeitssuchenden Sozialleistungen zusprach, obwohl sie durch den
Antrag auf Sozialleistungen zeigten, dass sie nicht über ausreichende
Mittel zum Lebensunterhalt verfügen. Um diese Rechtssachen geht es in
diesem Kapitel. Doch erst möchte ich die rechtlichen Koordinaten, auf
die im Folgenden Bezug genommen wird, weiter kurz umreißen.
Die Rechtsprechung bewegte sich in einem Dreieck aus den Artikeln 17,
18 und 12 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EG, heute unter neuer Nummerierung als AEUV bekannt)113 und schuf
verschiedene Möglichkeiten, auch Nichterwerbstätigen staatliche Leistungen zuzusprechen. Beim Artikel 17 EG (Artikel 20 AEUV) handelte es
sich um die in Fußnote 112 zitierte Einführung der Unionsbürgerschaft.
Im zweiten Absatz wird als Recht auch festgesetzt, „sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten“.114 Artikel 18,
der Freizügigkeitsartikel, setzte das Recht, sich als Unionsbürger*in „im
Hoheitsgebiet der Mitgliedsstaaten […] frei zu bewegen und aufzuhalten“ nochmal eigenständig ein, fügt aber auch den Einschub ein: „vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften
112
„Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft
tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht” (Art. 20
Abs. 1 AEUV).
113
Sonja Buckel folgend, benutze auch ich durchgehend die Nummerierung des EG-Vertrages nach Amsterdam und nicht die Nummerierung des Lissabonvertrages, also des Vertrages über die Arbeitsweise der EU (AEUV) und
auch nicht die Nummerierung des EU-Vertrages, die erst seit 2009 gültig ist, um
die relevanten Artikel zu benennen (vgl. Buckel, 2014: Fußnote 13).
114
Art. 17. Abs. 2 EG.
247
�vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen“.115 Für die Rechtsprechung war insbesondere auch das Diskriminierungsverbot des Artikels
12 EG zentral: „Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge
ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen
der Staatsangehörigkeit verboten“. Diese primärrechtlichen Regelungen
machen keine direkten Aussagen zum Recht auf soziale Leistungen, bieten aber die Grundlage für die Frage, wann ein*e Unionsbürger*in durch
den Ausschluss von sozialen Leistungen gegenüber Staatsbürger*innen
diskriminiert oder in ihrem (Grund-)Recht auf Freizügigkeit eingeschränkt werden darf.
Während diese drei Artikel des Primärrechts seit dem Jahr 1993 im
Wortlaut (fast) unverändert geblieben sind, hat sich das Sekundärrecht,
das aus den oben erwähnten Richtlinien zu erwerbstätigen und nichterwerbstätigen Personen besteht, welche den sozialen Gehalt der EU
sozusagen ausbuchstabieren, in verschiedenen Etappen geändert. Teilweise wurde dies, wie wir sehen werden, erst durch die vorangegangene Rechtsprechung des EuGHs notwendig. Die oben erwähnten Richtlinien, die für die Freizügigkeit von Nichterwerbstätigen enge Rahmen
absteckten, wurden im Jahr 2004 von der Richtlinie 2004/38/EG zur Freizügigkeit116 ersetzt, die, wie deutlich werden wird, ebenfalls heiß umkämpft war.
Soziale Union vs. nationale Wohlfahrtssouveränität: Strategien am EuGH
Im Folgenden untersuche ich Klagen nichterwerbstätiger
Unionsbürger*innen, die an nationalen Gerichten gegen eine NichtGewährung oder Rückforderung von sozialen Leistungen durch die jeweiligen staatlichen Ämter protestierten. Der Europäische Gerichtshof
115
„Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen
und aufzuhalten“ (Art. 18 EG).
116
RL 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen,
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,
ABI Nr. L 158/77.
248
�ist eine EU-europäische Instanz, die Judikative, die nationale Gerichte
dabei unterstützt, EU-rechtskonforme Urteile zu treffen. Diese stellen
sogenannte Vorabentscheidungsgesuche an das Gericht und halten das
laufende Verfahren so lange an. Nachdem die nationalen Gerichte ihre
Anfragen an den EuGH stellen, gibt es erst für die Mitgliedsstaaten und
die Kommission die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Dann bereitet
der/die zuständige Generalanwalt oder -anwältin – der/die zuvor eine
hohe Funktion im Gerichtswesen eines Mitgliedsstaates eingenommen
hat – einen Schlussantrag vor. Schließlich wird in einer der Kammern
– oder bei besonders wichtigen Rechtssachen im Plenum des Gerichts
– ein Urteil gefällt. Der EuGH ist dabei weniger direkt an die Interessen
der Mitgliedsstaaten gebunden, als beispielsweise der Ministerrat oder
das Parlament und vertritt tendenziell einen proeuropäischen Standpunkt, wenn es um Fragen der Kompetenz geht. Die Urteile des EuGHs
haben starke Gestaltungsmacht, was unter anderem daran zu sehen ist,
dass immer wieder das Sekundärrecht der EU an sie angepasst wurde.
Seine Richter*innen legen das geltende Recht nicht nur aus, sondern
sind auch kreativ tätig. Immer wieder wird die Frage gestellt, ob er nicht
seine Kompetenz überschreite, wenn er EU-europäisches Recht sehr eigenwillig auslegt. Insgesamt sind die Richter*innen des EuGHs nach
Buckel aber auch nur Diskursteilnehmer*innen unter anderen – nationale Gerichte, Experten der Mitgliedsstaaten und Kommission, Generalanwälte, Medien, juridische Intellektuelle – wenn auch institutionell
privilegierte. Auch sie müssen diskursive Strategien und Kompromisse
finden, damit ihre Beiträge ausreichend Legitimation zugestanden bekommen. Dabei bewegt sich dieser Diskurs in der Rechtsform, die nur
für juridische Intellektuelle zugänglich ist und ihre verselbständigten
Umgangsformen hat (vgl. Buckel, 2013: 72f.).
Während Sonja Buckel die Interessenlagen anhand von „Hegemonieprojekten“ (ebd.: 19) aufschlüsselt, möchte ich mich hier auf den kontingenten Fortlauf der Rechtsprechungsreihe konzentrieren, also darauf,
wie sich die zentralen Konfliktlinien verschoben haben, auf die Brüche
und kreativen Momente, in denen neue Figuren und Argumente geschaffen wurden.
249
�Sala 1998117, Grzelczyk 2001118 und Baumbast
2002119: Unionsbürger*innen diskriminieren verboten?
Der Stein kam ins Rollen im Jahr 1998 (in dem auch die Unionsbürgerschaft eingeführt wurde), mit der erwerbslosen Spanierin Martinez
Sala, die Erziehungsgeld in der BRD beantragt hatte. Das bayerische
Landessozialgericht fragte den EuGH, ob der Bezug von Erziehungsgeld bei Erwerbslosigkeit eingeschränkt werden könne, wenn sich
die Aufenthaltsberechtigung der antragstellenden Person aus ihrer
Arbeitnehmer*inneneigenschaft ergibt. Während die Fragestellung die
Unionsbürgerschaft nicht erwähnte, sondern auf die Arbeitnehmereigenschaft von Frau Sala einging, sollte der EuGH erstmals auf Basis des
neu geschaffenen Status argumentieren. Die Kommission, die spanische
Regierung und Generalanwalt La Pergola vertraten schon hier den „radikalen Weg“ (Hilpold, 2008: 22, zit. n. Buckel, 2013: 99): Nach Inkrafttreten der Unionsbürgerschaft und in Ableitung von Artikel 18 EG (Freizügigkeit) gäbe es ein „generelles und eigenständiges Aufenthaltsrecht
[…], welches sich unmittelbar aus dem Vertrag, also unabhängig von den
Freizügigkeitsrichtlinien“ (Buckel, 2013: 99) ableite. Zusätzlich müssten
Mitgliedsstaaten alle Rechte gewähren, die mit dem Aufenthaltsrecht in
Zusammenhang stehen oder aus ihm ableitbar sind. Als Unionsbürger*in
sei Frau Sala also aufenthaltsberechtigt bzw. freizügig und dürfe nicht
diskriminiert werden, auch wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachginge.
Sie habe damit auch ein Recht auf Erziehungsgeld. Nach dieser Argumentation wären freizügige Unionsbürger*innen Inländer*innen quasi
gleichgestellt. Die Regierungen von Deutschland, Frankreich und dem
Vereinigten Königreich vertraten dem hingegen die Meinung, dass die
Unionsbürgerschaft nichts Neues zu den marktbürgerschaftlichen Rechten, die in den zu diesem Zeitpunkt geltenden Richtlinien festgesetzt
waren, hinzufüge. Der Vertrag könne nicht ohne Rückgriff auf die sekundärrechtlichen Richtlinien ausgelegt werden, welche für das Aufenthaltsrecht grundsätzlich ausreichende eigene finanzielle Mittel verlangten und in den ersten fünf Aufenthaltsjahren keine sozialen Leistungen
117
118
119
250
Rs. C-85/96, Slg. 1998, I-2691.
Rs. C-184/99, Slg. 2001, I-6193.
Rs. C-413/99, Slg. 2002, I-7091.
�für nichterwerbstätige Unionsbürger*innen vorsähen. Es standen sich
also Plädoyers einerseits für „ein primärrechtlich genuin europäisches
Aufenthaltsrecht“ (Buckel, 2013: 102, Hervorhebung im Original) und
andererseits für eine „von den Mitgliedsstaaaten nur sekundärrechtlich
abgesicherte Bewilligung“ (ebd., Hervorhebung im Original) gegenüber.
Der EuGH wich der Überprüfung des Aufenthaltsrechts und damit dem
Bezug auf Artikel 18 EG (Freizügigkeit) dann aber geschickt aus: Eigentlich habe ja niemand angezweifelt, dass Salas Aufenthalt legal war.
„[W]ie auch immer“120 Frau Sala als Unionsbürgerin „das Recht eingeräumt worden [ist], sich in einem anderen Mitgliedsstaat […]
aufzuhalten“121: Aufenthaltsberechtigt könne sie sich auf das Diskriminierungsverbot aufgrund von Nationalität (Art. 12 EG) beziehen und
habe somit Anspruch auf die gleichen sozialen Leistungen wie ein*e
Inländer*in. Auch wenn der EuGH eine direkte Auseinandersetzung mit
den Richtlinien, die ja eigentlich einen Ausschluss vorsahen, umging,
war das Urteil im Ergebnis revolutionär, da es den Richtlinien diametral
entgegenstand und Gleichberechtigung auch in Bezug auf soziale Rechte für Nichterwerbstätige einforderte.
In der Rechtssache des französischen Studierenden Grzelczyk, der
belgisches Existenzminimum beantragte, konsolidierte der EuGH im
Jahr 2001 seine neue Linie. Hier ging es um das Verhältnis der damals
gültigen Studierendenrichtlinie122 mit dem Freizügigkeitsartikel des
EG (Art. 18). Die Generalanwältin vertrat hier den Standpunkt, dass
„[h]öherrangige Ansprüche […] durch eine sekundärrechtliche
Richtlinie nicht beschränkt werden“ (Buckel, 2013: 109) könnten. Der
EuGH stellt zudem fest, dass der Sozialleistungsbezug keinesfalls
automatisch „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“123 zur Folge haben
könne – dies sollte in die neue Richtlinie mit aufgenommen werden –
und spricht von einer „bestimmten[n] finanziellen Solidarität der Angehörigen dieses Staates mit denen der anderen Mitgliedstaaten“.124
Während liberale Kommentator*innen der Grzelczyk-Entscheidung
120
Schlussanträge des Generalanwalts Antonio Mario La Pergola v.
01.07.1997, Rs. C-85/96, Rn. 20.
121
Vgl. Fn. 113.
122
RL 93/96/EWG des Rates vom 29.10.1993 über das Aufenthaltsrecht der
Studenten.
123
Urteil in der Rs. Grzelczyk, C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 39.
124
Urteil in der Rs. Grzelczyk, C-184/99, Slg. 2001, I-6193, Rn. 44, Hervorhebung im Original.
251
�jubelten, dass Unionsbürger*innen nun nicht mehr „bloße Wirtschaftsfaktoren“ seien, warnte die konservative Kritik, die Entscheidung käme einem „Dammbruch“ (Hilpold, 2008: 26) gleich. In dieser
Wortwahl spiegelten sich nationalstaatliche, migrationspolitische
Überlegungen, die in der Rechtsprechungslinie von Anfang an eine
Rolle spielten, allerdings erst einmal nicht hegemonial werden sollten.
In der Rechtssache Baumbast und R. aus dem Jahr 2002, in der es
nicht um soziale Rechte, sondern um das Aufenthaltsrecht von Geschäftsleuten mit drittstaatsangehörigen Ehepartner*innen in den
Vereinigten Königreichen ging, sollte sich das Gericht dann schließlich darauf festnageln lassen, dass dem Freizügigkeitsrecht in Art.
18 EG „unmittelbare Wirkung zukomme“ (Buckel, 2013: 118) und die
Freizügigkeit nicht durch die Richtlinien eingeschränkt werden könne.
Den alles bestimmenden Bezugspunkt des proeuropäischen Argumentationsstranges stellte die Unionsbürgerschaft und damit die
neu geschaffene „Wir-alle-Gruppe“ (Nonhoff, 2006: 263, zit. n. Buckel, 2013: 103) dar, die eine implizite Abgrenzung von der Gruppe
der Drittstaatler*innen beinhaltet:
„Das Auftauchen der sozialen Rechte Nichterwerbstätiger, die über
die Unionsbürgerschaft und nicht mehr über die Grundfreiheiten
begründet werden, evozierte die „politische Imagination“ eines europäischen Allgemeinen.“ (Buckel, 2013: 115)
Konservative Diskursteilnehmer*innen zeigten sich in allen drei Fällen empört. Im Zusammenhang mit der Rechtssache Grzelcyk warnte
Rosemarie Höfler, Autorin des Buches Die Unionsbürgerfreiheit (2009),
dass die Unionsbürgerschaft, die nicht mehr als ein „Mittel zur Schaffung einer gemeinsamen Identität“ hätte sein sollen, sich als „Damoklesschwert für die nationalen sozialen Sicherungssysteme“ entpuppe (Höfler, 2002: 1026, zit. n. Buckel, 2013: 114). Nach dem deutschen
Rechtsprofessor Kay Hailbronner, einem der einflussreichsten Vertreter der National-Konservativen, stehe es dem EuGH nicht zu, über den
Willen der Mitgliedsstaaten hinweg zu agieren und die Restriktionen
der Freizügigkeit in den Richtlinien zeigten,
252
�„dass die Mitgliedsstaaten nicht bereit waren, Fremden den Zugang
zu ihrem Territorium zu gewähren, die, obwohl sie Unionsbürger sind,
eine Last für die öffentlichen Wohlfahrtssysteme werden könnten.“
(Hailbronner, 2004: 2188, zit. n. Buckel, 2013: 100)
In der Warnung vor der „Last für die Wohlfahrtssysteme“ durch die
„Fremden“ zeichnete sich schon die wohl wirkmächtigste Figur des
konservativ-nationalen Diskursstranges ab: der „Sozialtourismus“. Zu
diesem Zeitpunkt konzentrierten sich die Gegner*innen der Europäisierung des Sozialen aber noch auf das methodische Argument, der
EuGH habe seine Kompetenz überschritten: „Die Gemeinschaft hat […]
keine Kompetenz zur Schaffung einer Sozialunion“ (Niemann, 2004:
949). Es sei genau zu prüfen, „ob eine Materie in den sachlichen Anwendungsbereich der EU-Rechts fällt“ (Buckel, 2013: 104) und ob somit der Diskriminierungsverbot gelte oder nicht. Bis auf Weiteres
sollten die konservativ-nationalen Stimmen aber vom EuGH ignoriert
werden. Die Richter*innen argumentierten, dass es gar nicht darauf
ankäme, ob diese spezielle Streitsache – etwa das Erziehungsgeld im
Fall Sala – in den Zuständigkeitsbereich der EU falle, sondern dass es
reiche, dass sich Frau Sala „rechtmäßig im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält“125, um das Diskriminierungsverbot und damit den
„persönlichen Anwendungsbereich der Vertragsbestimmungen über die
Unionsbürgerschaft“126 aufzurufen. Schon hier verfolgte der EuGH also
einen Ansatz mit „erstaunlicher Breite“ (Fries/Shaw, 1998: 550) und widersprach den geltenden Richtlinien auf Grundlage des neu eingeführten Status der Unionsbürgerschaft.
Änderung des Sekundärrechts: die Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG
Der EuGH bewegte sich also trotz massiven Widerstands in Richtung
einer Sozialunion und füllte die Unionsbürgerschaft mit neuem Gehalt. Seine Urteile standen teilweise im Widerspruch zu den geltenden Richtlinien, worauf diese angepasst werden mussten. So ersetzte
die Richtlinie 2004/38/EG zur Freizügigkeit am 29. April 2004 die oben
125
126
253
Urteil in der Rs. Sala, C-85/96, Slg. 1998, I-2691, Rn. 62, 61.
Ebd.
�erwähnten Richtlinien.127 Mit ihr traten verschiedene Änderungen in
Kraft: Am wichtigsten war wohl, dass die Automatik der Freizügigkeit eingeführt wurde. Das Recht auf Aufenthalt gilt grundsätzlich
in den ersten drei Monaten Aufenthalt. Danach ist die Freizügigkeit
nur dann unantastbar, wenn ein Arbeitnehmerstatus vorliegt oder
Unionsbürger*innen „über ausreichende Existenzmittel [verfügen],
so dass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen des
Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen, und […] über
einen umfassenden Krankenversicherungsschutz im Aufnahmemitgliedstaat verfügen“ (Art. 7 Abs.1 b RL 2004/38/EG)128. Diese Einschränkungen dürfen aber nur aufgrund eines konkreten Verdachts durch ein
personalisiertes Rechtsverfahren und unter hohen Hürden umgesetzt
werden. In dieser Regelung wird die vorhergegangene Rechtsprechung direkt aufgenommen, die zum Beispiel im Fall Sala betont hatte, dass ein*e Unionsbürger*in von den Sozialgerichten als freizügig
zu betrachten sei, wenn das Aufenthaltsrecht noch nicht aberkannt
worden ist, auch wenn die Voraussetzungen der Freizügigkeit nicht
mehr erfüllt seien („wie-auch-immer“-Regel). Unionsbürger*innen besitzen das Recht auf Freizügigkeit qua ihres Status, sie müssen es weder beantragen noch verfällt es, wenn die Bedingungen nicht (mehr)
erfüllt sind. Es kann nicht „automatisch“ (Art. 14 Abs. 1 RL 2004/38/
EG) und „systematisch“ (ebd.) aberkannt werden, sondern es besteht
dem hingegen eine „Automatik des Aufenthaltsrechts“ (Fuchs, 2015:
96). Die Juristin Constanze Janda bezeichnete es auch noch im Jahr
2015 als „common sense, dass das Aufenthaltsrecht in einer auf Bewegungsfreiheit gründenden Union so lange vermutet wird, bis der
Aufenthaltsstaat dieses entzieht“ (Janda, 2015: 110). Auch kann „die
Inanspruchnahme von Sozialleistungen nach Art. 14 Abs. 3 RL 2004/38/
EG nicht automatisch die Ausweisung nach sich ziehen“ (Janda, 2015:
110)129. Der Aufenthaltsstaat – bzw. in München die Ausländerbehörde – kann nur aufgrund eines begründeten Verdachts – z.B. wenn das
127
Die Mitgliedsstaaten hatten zwei Jahre Zeit, um die Änderungen umzusetzen.
128
Zusätzlich zu beachten ist Art. 14 Abs. 1 RL 2004/38/EG: „Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen steht das Aufenthaltsrecht nach Artikel
6 zu, solange sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht
unangemessen in Anspruch nehmen.“
129
Art. 14 Abs. 3 RL 2004/38/EG: „Die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen durch einen Unionsbürger oder einen seiner Familienangehörigen
254
�Jobcenter den Bezug von Leistungen meldet – die Freizügigkeit in einem rechtlichen Verfahren prüfen und gegebenenfalls aberkennen.
Bis dahin müssen aber alle Stellen davon ausgehen, dass Freizügigkeit
vorliegt.130 Um den Status von Unionsbürger*innen und die an ihn gekoppelte Freizügigkeit zu verstehen, gilt es, die gewohnte dichotome
Unterscheidung von Staatsbürger*in und Ausländer*in zu überkommen.
Das Freizügigkeitsrecht von Unionsbürger*innen ist weder wie das Aufenthaltsrecht von Staatsbürger*innen unhinterfragbar, stellt aber auch
nicht eine Ausnahmeregelung wie eine Aufenthaltsgenehmigung für
Ausländer*innen dar. Hier wurde also ein vollkommen neuer, transnationaler Status geschaffen. Viele Münchner Akteure hatten diesen neuen
Status, die Automatik der Freizügigkeit, aber auch Anfang der 2010er
Jahre nicht begriffen, wie etwa das Zitat des Leiters des Amtes für Wohnen und Migration zu Beginn des fünften Kapitels gezeigt hat, in dem
er feststellte, dass Unionsbürger*innen nur dann freizügig seien, wenn
sie sich länger als ein halbes Jahr in München aufhielten und einer Erwerbstätigkeit nachgingen.
Daneben änderten sich noch zwei weitere Regelungen: Die neue Richtlinie rückte von dem Grundsatz ab, dass soziale Leistungen für Nichterwerbstätige erst nach fünf Jahren zulässig sind. Mitgliedstaaten durften nichterwerbstätigen Unionsbürger*innen Sozialleistungen nach den
ersten drei Monaten Aufenthalt nicht mehr pauschal verweigern, sondern nur, wenn diese keinen Arbeitnehmerstatus besäßen. Auch hier
wurde die Gesetzgebung an die Rechtsprechung des EuGHs angepasst
(vgl. Buckel, 2013: 124). Schließlich führte die Richtlinie 2004/38/EG das
Daueraufenthaltsrecht ein, das Unionsbürger*innen nach fünfjährigen
rechtmäßigen Aufenthalt automatisch erwerben und das sich kaum
noch von dem Status der ‚eigenen‘ Staatsbürger*innen unterscheidet
im Aufnahmemitgliedstaat darf nicht automatisch zu einer Ausweisung führen.“
Und Art. 24 Abs. 2 RL 2004/38/EG: „Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen steht das Aufenthaltsrecht nach den Artikeln 7, 12 und 13 zu, solange sie
die dort genannten Voraussetzungen erfüllen. In bestimmten Fällen, in denen
begründete Zweifel bestehen, ob der Unionsbürger oder seine Familienangehörigen die Voraussetzungen der Artikel 7, 12 und 13 erfüllen, können die Mitgliedstaaten prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Prüfung wird
nicht systematisch durchgeführt.“
130
Im siebten Kapitel gehe ich näher auf die konkreten Prozesse in der
Ausländerbehörde und im Jobcenter in München ein.
255
�(vgl. Buckel, 2013: 92). Die neuen Regelungen nahmen die vorangegangene Rechtsprechung zwar auf, flachten die vom EuGH eingebrachte
Maxime, dass die Unionsbürgerschaft grundsätzlich mit Freizügigkeit
und sozialen Rechte einhergeht, aber ab. Der EuGH sollte denn auch die
neue Richtlinie immer wieder beiseite lassen und Nichterwerbstätigen
alleine auf Grundlage des Primärrechts soziale Leistungen zusprechen.
Tas/Tas-Hagen 2006131 & Morgan/Bucher 2007132:
Freizügigkeit als Grundfreiheit?
So tauchte in der Rechtssache Tas/Tas-Hagen im Jahr 2006 (vier Jahre
nach dem Urteil in der Rechtssache Baumbast und R.) eine weitere Strategie zur Ausweitung des Diskriminierungsverbots (Art. 12 EG) auf.
Den zwei Niederländer*innen waren Sozialleistungen für zivile Kriegsopfer vom niederländischen Staat versagt worden, da sie ihren Wohnsitz in Spanien hatten. Die Richter*innen legten die Freizügigkeit als
Grundfreiheit aus, die nicht eingeschränkt werden dürfe und stützten
sich dabei alleine auf Art. 18 (Freizügigkeit) des EG. Eine Grundfreiheit
stellt ein neoliberales Diskursfragment dar, wie es in anderen rechtlichen Thematiken vor dem EuGH fest integriert war (vgl. kritisch dazu
Scharpf & Girndt, 2008)133. Die Einschränkung einer solchen Grundfreiheit gelte es, so das Credo des EuGHs, unbedingt zu vermeiden. Da
Grundfreiheiten nicht eingeschränkt werden dürfen, musste nach diesem neuen Weg nicht notwendigerweise auf das Diskriminierungsverbot (Art. 12 EG) abgestellt werden und also auch nicht geprüft werden,
ob die umstrittene Rechtssache in die Kompetenz der Union fiel. Alleine
die Ausübung des gemeinschaftlichen Grundrechts der Freizügigkeit
reiche aus, um den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts zu
eröffnen, „unabhängig ob Leistungen beansprucht werden, für die das
131
Rs. C-192/05, Slg. 2006, I-10451.
132
Verb. Rs. C-11/06 und C. 12/06, Slg. 2007, I-9161.
133
Für den Politikwissenschaftler Fritz Scharf bedrohen die Liberalisierungsprozesse in der EU, die maßgeblich durch den EuGH mit dem Werkzeug
der Grundfreiheiten vorangetrieben würden, den national-sozialen Staat, bzw.
das ‚Sozialniveau‘ in Deutschland. Seine These im Magazin Mitbestimmung
der Hans-Böckler-Stiftung: „Der einzige Weg ist, dem EuGH nicht zu folgen“
(Scharpf & Girndt, 2008). Er bezieht sich dabei vor allem auf Urteile, die gegen
das Streikrecht und die Tariftreue gerichtet waren (vgl. ebd.).
256
�Europarecht nach wie vor nicht zuständig ist“ (Buckel, 2013: 144). Diese
Auslegung wurde auch im Jahr 2007 in der Rechtssache von Rhiannon
Morgan und Iris Bucher wiederholt, die als deutsche Staatsbürgerinnen
Auslands-BAföG beantragt, aber zuvor nicht, wie verlangt, ein Jahr in
der BRD studiert hatten. Artikel 18 EG (Freizügigkeit) wurde so von Artikel 12 EG (Diskriminierungsverbot) nachhaltig „entkoppelt“ (Buckel,
2013: 143). Generalanwalt Colomer sprach gar von einer „Autonomie
der Freizügigkeit“ (ebd.) und verglich die Richter*innen des EuGHs poetisch mit „Künstler[*innen], die mit Hilfe der Hände, des Kopfes und des
Herzens den Bürgern weitere Horizonte eröffnen“134. Das Urteil in der
Rechtssache Sala wirkte in dieser Hinsicht fast schon rückständig (vgl.
Buckel, 2013: 144). Freizügigkeit als Grundfreiheit ginge notwendigerweise mit Gleichberechtigung einher, was auch den Zugang zu sozialen
Leistungen beinhalte: diese Auslegung sollte Norm werden.
Regierensanalytisch lässt sich in der Schaffung der Grundfreiheit Freizügigkeit im Anschluss an Foucault (2004) sehen, wie der EuGH als liberaler Akteur des Regierens Freiheiten produziert. Denn „[d]ie Freiheit ist
innerhalb des Liberalismus nichts Gegebenes, sondern der Liberalismus
‚fabriziert‘ […] die Freiheit“ (Lemke, 1997: 184).
Verhältnismäßig freizügig – Seilziehen vor Gericht
Durch die Umdeutung des Rechts auf Freizügigkeit zu der Grundfreiheit
der Freizügigkeit eröffneten sich die Rationalitäten des Sicherheitsdispositivs, nach denen Freiheit und Sicherheit in einer Art Balanceakt in ein
ausgeglichenes Verhältnis zu setzen seien. Der Begriff des Sicherheitsdispositivs geht auf Michel Foucault (2004) zurück. Thomas Lemke fasst
die Kernproblematik folgendermaßen zusammen:
„Das Problem des Liberalismus besteht also darin, in welchem Maße
die freie Verfolgung der individuellen Interessen eine Gefahr für das
Allgemeininteresse darstellt: Wie hoch sind die ‚Produktionskosten‘ der
Freiheit? Die liberale Freiheit kann daher nicht unbeschränkt gelten,
sondern wird dem Prinzip eines Kalküls unterstellt: Sicherheit.“ (Lemke, 1997: 184)
134
Schlussanträge des Generalanwalts Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer v.
20.03.2007, verb. Rs. c-11/06 und C-12/06, Rn. 1.
257
�Die Produktion von Freiheit geht also mit ihrer Einschränkung einher, um Sicherheit zu gewährleisten (vgl. Bigo, 2002: 398). Gleichzeitig zu dem Siegeszug der Forderung nach einer vom Marktprinzip
losgelösten, die Freizügigkeit mit sozialen Rechten untermauernden
Sozialunion entfernte sich die Auseinandersetzung von der Prüfung
des Aufenthaltsrechts, der Zuständigkeitsfrage und dem Diskriminierungsverbot und verschob sich hin zur Prüfung der sogenannten Verhältnismäßigkeit. Der EuGH räumte einer möglichen Rechtfertigung
von Diskriminierung Raum ein: „Denn nicht jede Diskriminierung
sei rechtswidrig, sondern nur eine solche, die sich nicht rechtfertigen lasse“ (Buckel, 2013: 116)135. Mit der Prüfung der Verhältnismäßigkeit136 wurde der Weg frei gemacht für eine Aushöhlung der
sozialen Rechte, des Unionsbürgerstatus und des Diskriminierungsverbotes. Das Recht auf Freizügigkeit und Gleichbehandlung wurde
als liberale Freiheit begriffen, an Bedingungen geknüpft und damit
im Endeffekt abgeschafft. Eine apolitische, technokratische Rationalität wurde im Diskurs hegemonial, wie sie für heutige Versuche des
Regierens und für das Sicherheitsdispositiv typisch ist: Verschiedene Interessen seien zu vereinbaren, wobei davon ausgegangen wird,
dass unter den vorhandenen Vorzeichen ein Kompromiss möglich
ist. Dass dafür soziale Rechte und die Idee der Sozialunion beschnitten werden müssen, sei unausweichlich. Die Strategien des EuGHs
erinnern in dieser Hinsicht an die Regierensform der governance:
„governance discourse seeks to redefine the political field in terms of
a game of assimilation and integration. It displaces talk of politics as
struggle or conflict. It resonates with ‚end of class‘ and ‚end of history‘
narratives in that it imagines a politics of multilevel collective selfmanagement, a politics without enemies.“ (Walters, 2004: 36)
135
Eine Rechtfertigung gelte dann, wenn „sie auf objektiven, von der
Staatsangehörigkeit unabhängigen Erwägungen beruhte und in einem angemessenen Verhältnis zu einem legitimen Zweck stünde, der mit den nationalen
Rechtsvorschriften verfolgt werde“ (Urteil in der Rs. D’Hoop, 224/98, Slg. 2002,
I-6191, Rn. 36).
136
Der Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeitsprüfung „wird aus dem
‚Wesen der Grundrechte selbst‘ als allgemeiner Freiheitsanspruch der Bürger
abgeleitet, ‚von der öffentlichen Gewalt jeweils nur soweit eingeschränkt‘ zu
werden, ‚als es zum Schutze öffentlicher Interessen unerlässlich ist‘“ (BverfGE
19, 342, 348f.).
258
�Die Verhältnismäßigkeitsprüfung sollte zum wichtigsten Schauplatz der
Auseinandersetzungen werden (vgl. Buckel, 2013: 117). In verschiedenen
Rechtssachen wurden Maßstäbe entwickelt, anhand derer die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall geprüft wurde.
D’Hoop 2002137 & Collins 2004138: Bezug zum Arbeitsmarkt
Um die Bewegungen hin zu einer ‚sozialen Union‘ akzeptabel auch für
diejenigen zu machen, die das Schreckgespenst des Sozialtourismus
beschworen, führte der EuGH schon im Jahr 2002 (vier Jahre vor den
letzten beiden diskutierten Fällen) in der Rechtssache D’Hoop, das Kompromissstrategem der Verhältnismäßigkeit ein, dass „die mitgliedsstaatliche Forderung nach Berücksichtigung ihrer nationalen Sozialsysteme“
(Buckel, 2013: 120) mit einbezog. Die belgische Studierende Marie-Nathalie D‘Hoop war nach ihrem Studium in Frankreich nach Belgien zurückgekehrt, wo sie daraufhin in ihrem Zugang zu Überbrückungsgeld
diskriminiert wurde. Die Bedingung, dass das Studium im Inland abgeschlossen werden sollte, sei nicht zielführend, um sich des „tatsächlichen Zusammenhangs zwischen demjenigen, der Überbrückungsgeld
beantragt und dem betroffenen räumlichen Arbeitsmarkt vergewissern
zu wollen“139. D‘Hoop beweise schon über ihre inländische Staatsbürgerschaft und dadurch, dass ihr Diplom in Belgien anerkannt werde,
einen hohen Bezug zum Arbeitsmarkt (Buckel, 2013: 117).
Auch in der Rechtssache von Brian Francis Collins, in der das Urteil
im März 2004 gesprochen wurde, spielten sich die Aushandlungen vor
allem auf dem Feld der Verhältnismäßigkeitsprüfung ab. Es handelte
sich um einen irischen Unionsbürger, der nach achttägigem Aufenthalt
in den Vereinigten Königreichen Beihilfe zur Arbeitssuche beantragte. Der EuGH argumentierte, dass Collins sich als Arbeitssuchender
rechtmäßig im EU-Gebiet aufhielte und sich deswegen auf das Diskriminierungsverbot beziehen könne. Allerdings müsse die Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Legitim sei die Überprüfung der „tatsächlichen
137
138
139
259
Rs. 224/98, Slg. 2002, I-6191
Rs. C 138/02, Slg. 2004, I-2703
Rs. 224/98, Slg. 2002, I-6191, Rn.38.
�Verbindung zwischen demjenigen, der die Leistungen beantragt, und
dem betroffenen räumlichen Arbeitsmarkt.“140 Ziel sei, so der Generalanwalt, den „so genannte[n] Sozialtourismus“141 zu verhindern. Der Begriff „Sozialtourismus“ tauchte hier zum ersten Mal wortwörtlich auf
(vgl. Buckel, 2013: 122). Zum ersten Mal tauchte auch die Frage auf,
ob eine Wohnsitzerfordernis zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit herangezogen werden könne. Das Gericht stimmte zu. Die Mindestaufenthaltsdauer dürfe aber nur so lange sein, wie die Ämter bräuchten,
um sich zu vergewissern, dass die antragstellende Person tatsächlich
auf Arbeitssuche sei (vgl. Buckel, 2013: 122f.). Aus diesen Überlegungen heraus erklärt sich auch die Regelung in der neuen Richtlinie
2004/38/EG (Art. 2), dass Arbeitssuchende eine tatsächliche Verbindung
zum Arbeitsmarkt nachweisen müssen, damit ihnen die Freizügigkeit
nicht aberkannt wird.
Trojani 2004142: Solidarität für „arme Schlucker“
Auch in der Rechtssache Trojani aus dem Jahr 2004 – das erste Urteil in dieser Reihe, das nach Inkrafttreten der neuen Richtlinie
2004/38/EG gefällt wurde – spielten die Parameter der Verhältnismäßigkeit eine zentrale Rolle. Michel Trojani lebte bei der Heilsarmee
und verdiente dort Unterkunft und Taschengeld. Er besaß eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und hatte das Existenzminimum in
Belgien beantragt (vgl. Buckel, 2013: 125). Da Trojani die ausreichenden Existenzmittel fehlten, sei eine Verneinung des Rechts auf Aufenthalt aber verhältnismäßig, so die Richter*innen. Personen, „die auf
Sozialleistungen angewiesen sind, [sollen] im eigenen Staat aufgefangen
werden“143, so der Generalanwalt. So war der rechtliche Pfad, der freizügigen Unionsbürger*innen die Gleichberechtigung alleine aufgrund
ihrer Freizügigkeit (Artikel 18 EG) eröffnete, verbaut. Allerdings ließen
es die Richter*innen nicht darauf beruhen und griffen überraschend
auf den ersten Weg, dem sie bei Sala gefolgt waren, zurück. Da Trojani
140
Urteil in der Rs. Collins, Rs. C 138/02, Slg. 2004, I-2703, Rn. 67.
141
Schlussanträge des Generalanwalts Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer v.
10.07.2003, Rs. C 138/02, Rn. 75.
142
Rs. C-45g/02, Slg. 2004, I-7573.
143
Schlussanträge des Generalanwalts Leendert A. Geelhoed v. 19.02.2004,
Rs. C-45g/02, Rn. 70
260
�eine Aufenthaltsgenehmigung - „wie auch immer“ - ja schließlich habe
(auch wenn sie ihm bei einer Überprüfung aberkannt werden könne),
könne er sich auf Artikel 12 EG berufen. Hier war wieder zu sehen,
wie die Automatisierung des Aufenthaltsrechts zum Tragen kommt.
Die Richter*innen positionierten sich damit klar für eine Europäisierung der sozialen Rechte auch für ärmere Bürger*innen außerhalb ihres
Nationalstaates, wenn sie sich rechtmäßig im Staatsgebiet aufhielten.
Der Autorität der Verhältnismäßigkeitsprüfung, die die Figur des ‚Sozialtourismus‘ - der „übermäßigen Belastung der Sozialsysteme“ - in sich
trägt, erteilten sie hier eine Absage und stellten sich gegen die Richtlinie 2004/38/EG, die Mitgliedsstaaten ja eben explizit nicht verpflichtet,
Unionsbürger*innen, die keine Arbeitnehmer*innen sind, Leistungen zu
gewähren.
Die Kommentare zu dem Urteil bezogen sich auf der einen Seite emphatisch auf die alternativ-liberale Vorstellungen eines neuen Europas: Der
EuGH leiste mit dem Urteil
„einen weiteren wichtigen Beitrag zur Entkräftung der These, die das
europäische Gemeinschaftsrecht als Bedrohung für die überkommene
Sozialstaatlichkeit in den Mitgliedsstaaten ansieht. In einem ‚Europa
der Bürger‘ ist nämlich auch für einen armen Schlucker wie Michel
Trojani Platz.“ (Kingreen, 2007:74, zit. n. Buckel, 2013: 128)
Die Konservativen dagegen waren empört und argumentierten, der
EuGH habe seine Kompetenzen überschritten: die Unionsbürgerschaft
werde „zum kompetenzrechtlichen Zauberstab für die Verwirklichung
der Vollintegration“ (Hilpold, 2008: 33, zit. n. Buckel, 2013: 126).
Der Ausweg, den die Richter*innen des EuGHs hier wählten, kann aber
nicht darüber hinweg täuschen, dass sie im Sinne der Verhältnismäßigkeit weiter an den Möglichkeiten bauten, die Freizügigkeit einzuschränken, indem sie den Mitgliedstaaten einräumten, bei Abhängigkeit von
Sozialhilfe und fehlenden Existenzmitteln die Freizügigkeit abzuerkennen.
Bidar 2005144 und Förster 2008145: Aufenthaltskri144
145
261
Rs. C-209/03, Slg. 2005, I-2119.
Rs. C-158/07, Slg. 2008, I-0000.
�terium
Die Möglichkeiten, Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot im Namen der Verhältnismäßigkeit zu rechtfertigen, sollten in einem Urteil
vom November 2008 noch weiter bestärkt werden. Hier ging es um einen französischen Staatsbürger namens Dany Bidar, der in den Vereinigten Königreichen ein Darlehen für sein Studium beantragt und dort
zuvor bei seiner Großmutter gelebt und die Schule besucht hatte. Das
Vereinigte Königreich hatte aber eine Regelung eingeführt, nachdem
der/die Antragsteller*in erst nach drei Jahren Aufenthalt Studienbeihilfen erhielte. Der EuGH urteilte wieder radikal proeuropäisch: Das
Diskriminierungsverbot komme alleine aufgrund der Unionsbürgerschaft als grundlegender Status zur Anwendung (Buckel, 2013: 128).
Diese Entscheidung sorgte für besondere Furore, da der Gerichtshof
sich damit sogar noch vor ihrer Implementierungsfrist gegen die gerade ausgehandelte Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG stellte, die besagt, dass Mitgliedsstaaten nicht verpflichtet sind, nichterwerbstätigen
Unionsbürger*innen Sozialhilfe und Studienbeihilfen zu zahlen (vgl.
Artikel 24 Absatz 2 RL 2004/38/EG). Einen offenen Widerspruch umging der EuGH aber wieder geschickt mit einem ‚Bypass‘. Bidar könne sich aufgrund seines rechtmäßigen Aufenthalts unabhängig von
den Einschränkungen der Richtlinie 2004/38/EG auf den primärrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen. Implizit argumentierte der
EuGH aber wieder, dass Sekundärrecht nicht gegen Primärrecht verstoßen dürfe, was von proeuropäischer Seite als „juridischer Aktivismus“
(Damian, Hadjiemmanuil, Monti & Tomkins, 2006) bejubelt wurde: Der
Gerichtshof habe praktisch die in Art. 24 Abs. 2 der neuen Richtlinie
festgehaltenen Ausnahmen eliminiert (vgl. Buckel, 2013:130). Gleichzeitig legten die Richter*innen aber die Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Interesse der nationalen Wohlfahrtssouveränität aus. Es ging
wieder darum, wie nahe der Kläger der Aufnahmegesellschaft sei – je
näher, desto schwieriger sei eine Diskriminierung als verhältnismäßig
zu rechtfertigen. Der Generalanwalt hatte noch argumentiert, dass eine
Wohnsitzerfordernis, quantitativ nach Jahren bemessen, nicht aussagekräftig sei in Bezug auf das tatsächliche Näheverhältnis zum Antragsstaat. Zwar sei die „Integration in das soziale Leben“146 notwendig, diese
sei aber nicht durch eine bloße Wohnsitzerfordernis zu überprüfen. Der
146
262
Rs. C-209/03, Slg. 2005, I-2119, Rn. 61.
�Gerichtshof aber akzeptierte die britische Regelung und folgte damit
zum ersten Mal einem „quantitative[n] Gleichheitsansatz“ - je länger der
Aufenthalt, desto integrierter (Barnard, 2005, zit. n. Buckel, 2013: 131).
Dies wurde von den national-konservativen Diskursteilnehmer*innen
als wichtiger Kompromissschritt gewertet. Das Urteil entzöge den Bedenken in Bezug auf Sozial- und Bildungstourismus den Boden (Buckel,
2013: 131). Sonja Buckel sieht hier den Versuch der „defensiv-hegemonialen nationalen Strategien […] den Rechtsstatus wieder zurückzudrehen
und Unionsbürger*innen zu migrantisieren“ (ebd.: 132). Das im Ergebnis
positive Urteil wurde aber gleichzeitig auch von den proeuropäischen
Diskursteilnehmer*innen gelobt (vgl. Buckel, 2013: 135). Denn der Anspruch auf Leistungen sei nicht mehr an das alte Kriterium der Nationalität gebunden, sondern vermittelt durch die Verbindung zum neuen
Mitgliedsstaat bzw. die „Integration in das soziale Leben“147. Die Rede
war sogar von einer „Denationalisierung der Europäischen Wohlfahrtsstaaten“ (van der Mei, 2005: 207°, zit. n. Buckel, 2013: 134)148.
Das nächste Urteil des EuGHs wurde dann als Notbremse bezeichnet,
als „diskursive[r] Triumph der national orientierten Strategien“ (Buckel, 2013: 151) und stand im Zeichen der einbrechenden Finanzkrise.
Der Gerichtshof gab dem niederländischen Staat Recht, der ein Unterhaltsstipendium von der deutschen Studierenden Jacqueline Förster zurückforderte, weil sie das Kriterium des fünfjährigen ununterbrochenen
Aufenthalts nicht erfüllte. Der EuGH stockte das dreijährige Aufenthaltskriterium, das er bei der Rechtssache Bidar abgesegnet hatte, sogar
auf fünf Jahre auf. Faktisch erkannte er damit das Sekundärrecht (bzw.
Art. 24 Abs. 1 RL 2004/38/EG) als bindend an. Dies traf auf starke Kritik. Viele Studierende hätten schon vor Ablauf dieses Zeitrahmens eine
tatsächliche Verbindung zum Aufnahmestaat entwickelt. Auch käme es
einem grundsätzlichen Ausschluss gleich, da wenige Studierende länger
als fünf Jahre benötigten, um ihr Studium abzuschließen (ebd.: 150). Diese Kritik widersprach der grundlegenden Logik, dass eine Verbindung
zum Aufnahmestaat nachgewiesen werden müsse, aber nicht. Es zeigt
sich hier, wie die Prüfung der Verhältnismäßigkeit dem EuGH die Möglichkeit bietet, beide Diskursseiten zufriedenzustellen. Soziale Rechte
147
Rs. C-209/03, Slg. 2005, I-2119, Rn. 61.
148
Von Denationalisierung wurde auch schon im fünften Kapitel in Hinsicht auf Stadtbürgerschaft gesprochen. Mit der Europäisierung findet sich hier
eine zweite Form der Denationalisierung.
263
�gelten dabei aber nicht (mehr) grundsätzlich, sondern werden konditionalisiert bzw. an Bedingungen gebunden. Die Diskursteilnehmer*innen,
die dieses weitreichende Urteil als „vorläufigen Schlussstrich“ (Papp,
2009: 88, zit. n. Buckel, 2013: 152) unter die proeuropäische Rechtsprechung bejubelten, sollten sich aber täuschen. Denn schon ein halbes
Jahr später sprach der EuGH ein Urteil, dass zwei nichterwerbstätigen
Unionsbürger*innen Anspruch auf Hartz IV zusprach.
Hartz IV für nichterwerbstätige
Unionsbürger*innen?!
Bis hier her mag die Frage aufgekommen sein, in welcher Verbindung
die juridischen Aushandlungen mit den lokalen Auseinandersetzungen
um die Versuche des Regierens von EU-migrantischen Arbeiter*innen
in München stehen. Dies wird im Folgenden klarer werden, denn die
Rechtsprechungslinie mündete in die Frage, ob der Ausschluss von arbeitssuchenden Ausländer*innen von der bundesdeutschen Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) mit dem Europarecht konform
gehe, oder nicht. Dieser Ausschluss, der im Paragraphen 7 des Sozialgesetzbuchs (SGB) II festgeschrieben ist, übte - wie spätestens im Kapitel
zur kommunalen Wohnungslosenpolitik deutlich wurde und insbesondere im siebten Kapitel dieser Arbeit Thema sein wird - einen Einfluss
auf die lokalen Verhältnisse aus, der nicht zu unterschätzen ist.
Vatsouras/Koupatantze 2009149: Wider die deutsche Ausschlussklausel
149
264
Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, I-4585.
�Im Jahr 2009 urteilte der EuGH im Sinne zweier griechischer Staatsbürger gegen die ARGE Nürnberg und gegen den Ausschluss arbeitssuchender Unionsbürger*innen aus dem Hartz IV. Athanasios Vatsouras
und Yosif Koupatantze hatten wenige Monate nach ihrer Einreise eine
Erwerbstätigkeit angenommen und aufstockend zu ihrem geringen Einkommen erfolgreich Hartz IV beantragt. Nach kurzer Zeit (bei einem
der beiden nach weniger als einem Monat) wurden sie arbeitslos, woraufhin ihnen die Leistungen aberkannt wurden. Sie legten Einspruch
ein. Da die deutsche Rechtsprechung in Bezug auf den Ausschluss aus
dem SGB II uneinheitlich war, wendete sich das bayerische Sozialgericht an den Europäischen Gerichtshof mit der Frage: „Ist Art. 24 Abs. 2
der Richtlinie 2004/38/EG [der Ausschluss von nichterwerbstätigen
Unionsbürger*innen von Sozialleistungen] mit Art. 12 EG [Diskriminierungsverbot] in Verbindung mit Art. 39 EG [Freizügigkeit] vereinbar?“150
Der EuGH entschied, dass sowohl arbeitssuchende Unionsbürger*innen
wie auch Leistungen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollten, nicht vom Gleichbehandlungsgebot ausgeschlossen werden dürften. Der Ausschluss von arbeitssuchenden Unionsbürger*innen von der
Grundsicherung für Arbeitssuchende sei auch deswegen nicht mit Unionsrecht vereinbar, weil Hartz IV, nach Einschätzung der Richter*innen,
keine Sozialhilfeleistung im Sinne des Artikels 24 Absatz 2 der Richtlinie
2004/38/EG darstelle, sondern „eine finanzielle Leistung, die […] den Zugang zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedsstaats erleichtern soll“151.
Das Urteil lehnte eine Ausgrenzung von Arbeitssuchenden aber nicht
pauschal ab, sondern die Mitgliedsstaaten dürften legitimerweise überprüfen, ob eine „tatsächliche Verbindung des Arbeitssuchenden mit dem
Arbeitsmarkt dieses Staates festgestellt werde“152, um die Sozialsysteme
vor „den Gefahren des sogenannten ‚Sozialtourismus‘153“ zu schützen,
so der Generalanwalt Colomer. Damit führte der Gerichtshof, der neu150
Urteil Vatsouras/Koupatantze, Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009,
I-4585, Rn. 21, Anmerkungen durch Autorin.
151
Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, I-4585, Rn. 37. Und weiter: „Eine
Voraussetzung wie die in § 7 Abs. 1 SGB II enthaltene, wonach der Betroffene
erwerbsfähig sein muss, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Leistung den
Zugang zur Beschäftigung erleichtern soll“ (Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009,
I-4585, Rn. 43)
152
Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, I-4585, Rn. 38.
153
Schlussanträge des Generalanwalts Damaso Ruiz-Jarabo Colomer v.
12.03.2009, Rs. C-22/08 und C-23/08, Rn. 49.
265
�en Richtlinie folgend, eine neue Kategorie in die Rechtsprechungslinie
ein. Neben der Unterscheidung zwischen Arbeitssuchenden, die den
Arbeitnehmer*innenstatus durch vorangegangene Erwerbstätigkeit
schon erlangt haben und solchen, die noch nicht gearbeitet haben, gibt
es nun noch eine weitere Unterscheidung: die zwischen Arbeitssuchenden mit Aussicht auf Erfolg bei der Arbeitssuche (und damit Verbindung zum Arbeitsmarkt) und jenen ohne Aussicht auf Erfolg. Wenn
Unionsbürger*innen „tatsächliche Verbindungen mit dem Arbeitsmarkt
eines anderen Mitgliedstaats hergestellt haben“, können sie „eine finanzielle Leistung in Anspruch nehmen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt
erleichtern soll“154. Nach diesem Urteil geht der deutsche Ausschluss
von arbeitssuchenden Ausländer*innen aus dem Hartz IV (als Leistung,
die den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern soll), zumindest in seiner
pauschalen Form, mit dem EU-Recht nicht konform. Der EuGH könne
aber nur Leitlinien formulieren. Es sei
„Sache der zuständigen nationalen Behörden und gegebenenfalls der
innerstaatlichen Gerichte, nicht nur das Vorliegen einer tatsächlichen
Verbindung mit dem Arbeitsmarkt festzustellen, sondern auch die
grundlegenden Merkmale dieser Leistung zu prüfen.“155
Dieses Urteil ist das letzte, das Sonja Buckel in ihre Forschung einbezogen hat. Sie kommt nachvollziehbar zu dem Schluss, dass sich die
„proeuropäische[n] Strategien durchsetzen“ und eine „neuartige Perspektive“ formulieren, „die man als ‚europäische soziale Union‘ bezeichnen kann“:
„Das juridische Projekt zielte [...] auf die Schaffung eines europäischen
Allgemeinen: aus linksliberal-alternativer Sicht auf ein ‚Europa der
Bürger‘/‘a people“s Europe‘/‘citoyenneté européenne‘ und aus proeuropäisch-sozialer Perspektive auf eine ‚wahre Sozialunion‘.“ (Buckel,
2013: 166)
Diese diskursiv-rechtlichen Transformationen hin zu einem „Staatsprojekt Europa“ könnten sich aber erst konsolidieren, wenn sie alle Akteure
– auch die nationalen – mit einbezögen. Dies wiederum sei abhängig
154
155
266
Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, I-4585, Rn. 40.
Rs. C-22/08 und C-23/08, Slg. 2009, I-4585, Rn. 41.
�von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen (vgl. ebd.). Wenn Buckel
erklärt, dass die Suchprozesse in Richtung einer „sozialen Union der
Bürger“ bereits begonnen hätten, sollten die kommenden Entwicklungen zeigen, dass diese Prozesse nicht weit kamen. Meiner Meinung nach
unterschätzte Sonja Buckel die Bedeutung der Verhältnismäßigkeitsund individualisierenden Einzelfallprüfung, die zwar einem pauschalen
Ausschluss, aber auch grundlegenden sozialen Rechten entgegenstanden. Die Aushandlungen bewegten sich in Richtung einer entlang von
Nützlichkeitslogiken stratifizierten und bedingten Marktbürgerschaft,
statt den Pfad in Richtung einer Sozialunion der Bürger*innen einzuschlagen.
Änderung des Sekundärrechts: Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
Erst einmal kam die Bundesregierung jedenfalls nicht nur durch dieses
Urteil, sondern auch durch eine neue EU-Verordnung unter Druck, den
Zugang zu Hartz IV auch für nichterwerbstätige Unionsbürger*innen zu
öffnen. Neben der Freizügigkeitsrichtlinie 2004/38/EG stellt heute auch
die Verordnung156 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen
Sicherheit einen wichtigen Bezugspunkt in den Auseinandersetzungen
um die sozialen Rechten von Bürger*innen der EU dar. Sie trat in ihrer
modernisierten Version am 1. Mai 2010 in Kraft und bezog die bis zu
diesem Zeitpunkt ergangene Rechtsprechung des EuGHs, die das vorher
geltende Recht überholt hatte, mit ein. Auch sie enthält ein Diskriminierungsverbot157 (Art. 4), das insbesondere verbietet, „Leistungsansprüche im Wirkungsbereich der VO [Verordnung, Anmerkung der
Autorin] an die inländische Staatsangehörigkeit zu binden“ (Frings,
156
Sowohl bei Verordnungen wie bei Richtlinien handelt es sich um Sekundärrecht. Allerdings sind „Verordnungen Rechtssetzungen mit allgemeiner
Geltung, die in all ihren Teilen verbindlich sind und von den zuständigen Institutionen der Mitgliedsstaaten unmittelbar anzuwenden sind (Art. 288 AEUV).
Richtlinien sind hingegen lediglich hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich (Art. 288 AEUV)“ (Frings, 2012: 15).
157
„Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen, für die diese Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen
dieses Staates“ (VO 883/2004, Art. 4).
267
�2012: 14). In den Wirkungsbereich der Verordnung fallen allerdings
nur Leistungen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt als Ziel haben und
nicht Sozialhilfe, die einfach nur zum Überleben dient. Hartz IV ist
ausdrücklich in den Wirkungsbereich der Verordnung aufgenommen.
Die Verordnung setzt fest, dass Bürgerschaftsrechte für Nichterwerbstätige an den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts gebunden werden,
bzw. dass das lex loci domicilii gilt, wenn das lex loci laboris nicht anwendbar ist. Dies kann als eine Verschiebung von der Marktbürgerschaft hin zum sozialen Gehalt der Unionsbürgerschaft (vgl. Frings,
2012; Van Overmeiren, Eichenhofer & Verschueren, 2013) und ein
Durchbruch in Richtung einer postnationalen Konzeption von Bürgerschaft gedeutet werden.158
EU-Rechtsexpert*innen haben darauf hingewiesen, dass der Ausschluss von nichterwerbstätigen Personen, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland haben, aus dem Hartz IV in Hinsicht auf
die Verordnung rechtswidrig sei (vgl. Van Overmeiren, Eichenhofer
& Verschueren, 2013). Die Bundesregierung ließ sich aber weder von
dem Urteil im Fall Vatsouras/Koupatantze, noch von der Verordnung
883/2004 beeindrucken. Der Paragraph 7 SGB II schließt auch heute
noch Unionsbürger*innen, deren Aufenthaltsrechts sich alleine aus
der Arbeitssuche ergibt, von Hartz IV-Leistungen aus.159 In zwei jüngeren Urteilen zu der Frage, ob nichterwerbstätige Unionsbürger*innen
Anspruch auf Hartz IV haben sollten, legte dann auch der EuGH
eine Kehrtwende ein. Diese Kehrtwende nutzte das Verhältnismäßigkeitsargument in Anbetracht der (angeblichen) Bedrohung durch
‚Sozialtourismus‘ – ging aber noch weiter in Richtung nationaler
Wohlfahrtsouveränität als dies im Lichte der vorangegangenen Urteile
auszumalen gewesen wäre.
158
Es wurde sogar argumentiert, dass die nach dem Wohnsitzprinzip gewährten Leistungen das Aufenthaltsrecht absichern könnten, weil sie als ausreichende Existenzmittel betrachtet werden sollten (vgl. ebd.).
159
Im Jahr 2013 wurde das deutsche Freizügigkeitsgesetz sogar noch verschärft: So können heute Unionsbürger*innen abgeschoben werden, wenn sie
nach sechs Monaten nicht nachweisen können, dass sie mit Aussicht auf Erfolg
Arbeit suchen (mehr dazu im siebten Kapitel).
268
�Dano 2014160 und Alimanovic 2015161: Migrationskontrolle statt soziale Union
Die diskursiven Rahmenbedingungen der Rechtsprechung am EuGH
hatten sich bis zum Jahr 2014, als die Kehrtwende des EuGHs stattfand,
verschärft. Spätestens im Jahr 2013 waren in Deutschland und weiteren
Mitgliedsstaaten, z.B. im Vereinigten Königreich, rechte Moralpaniken
in Bezug auf ‚Armutszuwanderung‘ und ‚social tourism‘ aufgebrandet.
Die Kommentator*innen der neuen Urteile brachten die Umorientierung des EuGHs mit der öffentlichen Rede vom ‚Sozialtourismus‘ in
Zusammenhang und verwiesen teilweise auf die Aufhebung der Freizügigkeitseinschränkungen gegenüber bulgarischen und rumänischen
Staatsbürger*innen sowie auf die Finanzkrise; die Richter*innen, von
der Realität eingeholt, brächen nun mit dem Projekt, anhand der sozialen Rechte Nichterwerbstätiger die Unionsbürgerschaft mit „politischer
Imagination“ anzufüllen (Fuchs, 2015: 95; Janda, 2015b: 108). Der EuGH
sei schließlich „kein Autist, sondern achtet auf das integrationspolitische Umfeld“ (Thym, 2014).
In der ersten Rechtssache Dano ging es um Elisabeta Dano, eine rumänische Frau Anfang zwanzig, die für sich und ihr im Jahr 2009 geborenes
Kind Florin im Januar 2012 Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) beantragt hatte. Nach der Ablehnung durch das Jobcenter Leipzig klagte
sie vor dem Sozialgericht (SG) Leipzig und stützte sich dabei auf das
Urteil in der Rechtssache Vatsouras/Koupatantze. Das SG Leipzig fragte
dann den EuGH nach der Vereinbarkeit von EU-europäischem Primärund Sekundärrecht mit der nationalen Ausschlussklausel, die Arbeitssuchenden den Zugang zu Hartz IV versperrt (Art. 7 SGB II). Frau Dano
lebte bei ihrer Schwester, war im Jahr 2010 letztmalig eingereist und
suchte, im Gegensatz zu Vatsouras und Koupatanze, nicht nach Arbeit.
Einige Diskursteilnehmer*innen betonten zudem, dass sie, auch wenn
sie Arbeit suchen würde, keine Aussicht auf Erfolg hätte, dass sie weder die deutsche Sprache (gut genug) beherrsche, noch einen Schulabschluss hätte.162 In diesem Sinne war sie sowohl nichterwerbstätig und
160
Rs. C-333/13, Sammlung der Rechtsprechung noch nicht veröffentlicht.
161
Rs. C-67/14, Sammlung der Rechtsprechung noch nicht veröffentlicht.
162
Vgl. beispielsweise Schlussanträge des Generalanwalts Melchior Wathelet v. 20.04.2014, Rs. C-333/13, Rn. 128.
269
�nichtarbeitssuchend wie auch nichterwerbsfähig. Sie konnte keinerlei
Bezug zum Arbeitsmarkt vorweisen und passte – als alleinerziehende Mutter!163 in alle Register der unerwünschten ‚bad migrants‘ bzw.
‚Sozialtourist*innen‘, die das nationale Sozialsystem bedrohten. Dies
zeigt auch die folgende Argumentation des Generalanwaltes:
„Im vorliegenden Fall fügt sich meines Erachtens die nationale Regelung, indem sie Personen, die einzig und allein mit dem Ziel nach
Deutschland kommen, Nutzen aus dem Sozialhilfesystem dieses Mitgliedstaats zu ziehen, und sich in keiner Weise darum bemühen, sich
in den Arbeitsmarkt zu integrieren, in den Willen des Unionsgesetzgebers ein. Damit kann verhindert werden, dass die Personen, die von
ihrer Freizügigkeit Gebrauch machen, ohne sich integrieren zu wollen,
eine Belastung für das Sozialhilfesystem werden. [...] Sie erlaubt es mit
anderen Worten, Missbräuche und eine gewisse Form von ‚Sozialtourismus‘ zu verhindern.“164
Ein weiteres zentrales Argument, das im Gegensatz zu dem Urteil in
der Rechtssache Vatsouras/Koupatantze stand, lautete, dass Hartz IV
als Leistungen der Sozialhilfe zu deuten sei, und nur sekundär als Leistung, die den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern soll, und so nicht
unter das Gleichbehandlungsgebot der Verordnung 883/2004 falle.165 Das
163
Auch wenn ich hier nicht weiter darauf eingehen kann, möchte ich
doch darauf hinweisen, dass Frau Dano (wie im übrigen auch die nächste Klägerin Nazifa Alimanovic) als alleinerziehende Mutter eines Kleinkindes hier
durch die Raster der Arbeitsgesellschaft fiel. Es wäre höchst interessant, diese
Dynamiken der differenzierten Inklusion aus feministischer Perspektive auf
Geschlechter- und Reproduktionsverhältnisse und die Entwertung von careArbeit hin zu untersuchen.
164
Schlussanträge des Generalanwalts Melchior Wathelet v. 20.04.2014,
Rs. C-333/13, Rn. 131.
165
Sowohl Gericht wie auch Generalanwalt bezogen sich auf die Rechtssache Brey (Rs. C-140/12, Sammlung der Rechtsprechung noch nicht veröffentlicht) in der einem deutschen Rentnerehepaar in Österreich zwar aufstockende
Rentenzahlungen zugesprochen wurden, ihr Aufenthalt aber als unrechtmäßig
gesehen wurde. In diesem Urteil brach das Gericht nämlich mit der Auffassung,
dass eine öffentliche Leistung nicht gleichzeitig eine „besondere unabhängige
Leistung“ nach der Verordnung 884/2004 und eine „Sozialleistung“ nach der
Richtlinie 2004/38/EG sein konnte. Weil nun beides gleichzeitig möglich war,
konnte der Bezug einer solchen Leistung die Freizügigkeit in Gefahr bringen.
270
�Urteil des EuGHs ging dann auch weiter, als vorab erwartet worden
war. Er entschied nicht, dass im Sinne der Verhältnismäßigkeit individuell geprüft werden müsse, ob eine tatsächliche Verbindung zum Aufnahmestaat bestehe (durch die Prüfung der Aufenthaltsdauer oder des
gewöhnlichen Aufenthalts), sondern legitimierte den Ausschluss aller
nichtarbeitssuchenden und nichterwerbstätigen Unionsbürger*innen
von der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) pauschal.
Unklar blieb aber noch, ob diese Kehrtwende des EuGHs auch
Unionsbürger*innen, die zwar nicht erwerbstätig sind, aber nach Arbeit
suchen, betraf. Diese Frage sollte in der nächsten Rechtssache verhandelt werden, in der es wieder um eine alleinerziehende Mutter ging:
Nazifa Alimanovic und ihre drei Kinder Sonita, Valentina und Valentino, die zwischen 1994 und 1999 in Deutschland zur Welt gekommen
sind. Anders als Frau Dano suchten Frau Alimanovic und ihre Tochter
Sonita nach Arbeit und waren jeweils weniger als ein Jahr in kurzfristigen Arbeitsverhältnissen in Deutschland erwerbstätig gewesen, bevor sie für ein halbes Jahr Hartz IV bezogen. Die Leistungen wurden
nach sechs Monaten vom Jobcenter unter der Begründung aberkannt,
dass sich ihr Aufenthaltsrecht nun alleine aus der Arbeitssuche ergab.
Sie gingen in Berufung und das Bundessozialgericht fragte schließlich
den EuGH, ob der Ausschluss von Arbeitssuchenden, die zuvor schon
erwerbstätig in Deutschland gewesen waren, mit dem EU-Recht konform gehe. Entgegen der Argumentation des Generalanwalts Wathelet,
dass in diesem Fall ein automatischer Ausschluss gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße und den Antragsstellenden erlaubt werden
müsse, „das Bestehen einer solchen tatsächlichen Verbindung mit dem
Aufnahmemitgliedstaat nachzuweisen“166, segneten die Richter*innen
überraschenderweise auch für diese Fallkonstellation den pauschalen
Ausschluss aus dem Hartz IV ab. Eine individuelle Prüfung sei nicht
166
Schlussanträge des Generalanwalts Melchior Wathelet v. 26.03.2015,
Rs. C-67-14, Rn. 110. Ausführlicher dazu in der Pressemitteilung Nr. 35/15 des
EuGHs vom 26.03.2015: „In dieser Hinsicht ist – neben Umständen, die sich aus
dem familiären Kontext ergeben (wie der Schulausbildung der Kinder) – die
effektive und tatsächliche Beschäftigungssuche während eines angemessenen
Zeitraums ein Umstand, der das Bestehen einer solchen Verbindung mit dem
Aufnahmemitgliedstaat belegen kann. Eine frühere Erwerbstätigkeit oder auch
die Tatsache, dass der Betreffende nach Stellung des Antrags auf Sozialleistungen eine neue Arbeit gefunden hat, wäre zu diesem Zweck ebenfalls zu berücksichtigen.“
271
�nötig. In ihrem Urteil folgten sie einer sehr ähnlichen Argumentation
wie im Fall Dano. Viele Expert*innen zeigten sich überrascht über die
restriktiven Urteile, da sie von der Individualisierung des Anspruchs
im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung abrückten und nicht zuletzt dem Urteil zu Vatsouras/Koupatantze diametral entgegen standen.
Dieses Urteil, das den arbeitssuchenden Unionsbürgern Vatsouras und
Koupatantze soziale Leistungen zugesprochen hatte, werde von den
Richter*innen mit keinem Wort erwähnt und sei nun wohl überholt, so
stellt Maximilian Fuchs (2015) lapidar fest.167 Nach der revolutionären
Vorlage der vorhergehenden, proeuropäischen Urteile, in der sich der
EuGH als „Künstler“168 erwiesen und die „Unionsbürgerschaft [zu einer]
Projektionsfläche für ein gutes Leben“ (Thym, 2014) gemacht hatte, folgt
er nun den langjährigen Kritiken von Seiten der Befürworter*innen der
nationalen Wohlfahrtssouveränität. Die Richter*innen ziehen sich auf
ihre Rolle als „Rechtstechniker“ (ebd.), die die Sekundärrichtlinien auslegen und somit den Rahmen der Marktbürgerschaft im Interesse der
nationalen Wohlfahrtssouveränität festzurren, zurück.169
Der EuGH ersetzte die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Sozialhilfebezugs im individuellen Fall durch eine pauschale Prüfung
des Aufenthaltsrechts. Janda argumentierte in Bezug auf Dano,
die Richter*innen hätten übersehen, dass es in der Verordnung
auf die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nicht ankomme, sondern
167
Zu diesem Aufsehen erregenden Urteil kam das Gericht in drei Schritten: „In einem Dreischritt wird unmissverständlich festgelegt, dass Unionsbürger, die nicht arbeiten und auch keine Arbeit suchen, über ausreichende
Existenzmittel verfügen müssen und in Abwesenheit derselben über kein Freizügigkeitsrecht verfügen, mangels dessen auch eine Gleichbehandlung ausscheidet.“ (Thym, 2014)
168
Schlussanträge des Generalanwalts Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer v.
20.03.2007, verb. Rs. c-11/06 und C-12/06, Rn. 1
169
Der EuGH kehrte seine bisherige Auslegung des Verhältnisses von
Primär- und Sekundärecht um: Statt die Freizügigkeit als Grundfreiheit auszulegen oder das Diskriminierungsverbot an den Grundstatus der Unionsbürgerschaft zu knüpfen und so eine sekundärrechtliche Einschränkung des Primärrechts zu verbieten (oder nur nach strenger Verhältnismäßigkeitsprüfung zu
erlauben), sieht er die Richtlinie 2004/38/EG und die Verordnung als Sekundärrecht nun als bindende Anweisungen, wie die Verträge auszulegen seien. Nach
dieser Feststellung beziehen sich die Richter*innen nur noch auf das Sekundärrecht und nicht mehr auf die primären Verträge der EU.
272
�dass die Grundlage für den Anspruch von Nichterwerbstätigen
auf soziale Leistungen vielmehr der individuell zu prüfende
„gewöhnlichen Aufenthalt“ sei. Sie begrüßte das eindeutige Ergebnis im Fall Dano zwar, da es „nunmehr eine sachliche Diskussion um den Leistungszugang tatsächlich arbeitssuchender
Unionsbürger“ ( Janda, 2015b: 112) ermögliche. Sie argumentierte
aber, dass die Regelung des „gewöhnlichen Aufenthalts“ schon
alleine ausgereicht hätte, um „Sozialtourismus“ zu verhindern,
da Personen, die der individuellen Prüfung nicht stand hielten,
„gezwungen [werden], in ihren Herkunftsstaat zurückzukehren,
wenn sie existenzsichernder Leistungen bedürfen“ (ebd.: 111).
Die Richter*innen brechen nicht nur mit dem Dogma der Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall, sondern auch mit
der Automatik der Freizügigkeit, dem Grundsatz der Vermutung
der Freizügigkeit auf alleiniger Grundlage des Unionsbürgerschaftsstatus (ebd. 110). Bisher mussten alle Behörden grundsätzlich davon ausgehen, dass Unionsbürger*innen freizügig
waren und somit ein Aufenthaltsrecht besaßen, bis die Ausländerbehörde aufgrund eines begründeten Verdachts nach individueller Prüfung das Recht auf Freizügigkeit aberkannte. Nun
argumentieren die Richter*innen: „Nur wenn der Aufenthalt
nach den Vorgaben der [EU-Freizügigkeits-]Richtlinie rechtmäßig sei, könne der Anspruch auf Gleichbehandlung, mithin auf Zahlung von Sozialleistungen bestehen“ ( Janda 2014a).
Nichterwerbstätige, die nicht über ausreichend Existenzmittel verfügten, seien aber nicht freizügig, denn die Richtlinie
2004/38/EG verlange ausreichend Existenzmittel (für eine Aufenthaltsrecht von über drei Monaten), „so dass sie während
ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen“ (Art. 7 Abs.1 b RL
2004/38/EG). Die daraus resultierende Ungleichbehandlung zwischen Inländer*innen und Unionsbürger*innen, die die Bedingungen der Freizügigkeit nicht erfüllten, sei eine „unvermeidliche
Folge der Richtlinie 2004/38“170171. Der EuGH war hier der Meinung, dass
170
Rs. Dano, C-333/13, Sammlung der Rechtsprechung noch nicht veröffentlicht, Rn. 77.
171
„Eine solche potenzielle Ungleichbehandlung beruht nämlich auf dem
Verhältnis, das der Unionsgesetzgeber in Art. 7 dieser Richtlinie zwischen dem
273
�die aufenthaltsrechtlichen Regelungen der Richtlinie 2004/38/EG auch
das koordinierende Sozialrecht der Verordnung einschränke. Es ging
davon aus, dass Unionsbürger*innen und ihre Familienangehörigen
grundsätzlich nur unter den Bedingungen als freizügig zu betrachten
sind, dass sie entweder erwerbstätig oder – bei Nichterwerbstätigkeit
– über ausreichend Existenzmittel oder Aussicht auf Arbeit verfügten.
In der Rechtssache Alimanovic dehnt er dies auf Arbeitssuchende generell aus. Ob Freizügigkeit bestehe, sei demnach von den Jobcentern172
zu prüfen, um über den Zugang zu sozialen Leistungen entscheiden zu
können. Die Urteile in den Rechtssachen Dano und Alimanovic waren
damit Teil eines Prozesses, der dem Status der Unionsbürgerschaft mit
der Automatik der Freizügigkeit sein entscheidendes Merkmal nimmt,
das Konzept der Freizügigkeit durch seine Konditionalisierung um 180
Grad dreht und somit, nach Buckel, Unionsbürger*innen „migrantisiert“ (Buckel, 2013: 132). Die Juristin Anuscheh Farahat wirft dann
auch die Frage auf, „ob die unionsbürgerschaftliche Freizügigkeit zu
einem Privileg gut situierter Unionsbürger wird“ (Farahat, 2014). Die
Urteile folgen radikal der neuen Grenzlinie entlang des Kriteriums der
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, wie sie in dem Vorgängerurteilen ausgelegt wurde. Der Jurist Daniel Thym bringt dies folgendermaßen auf den Punkt:
„Eine Absage erteilte der Gerichtshof einzig einer bundesstaatlichen
Sozialbürgerschaft mit einem umfassenden Gleichheitsversprechen
für wirtschaftlich Inaktive. Dies reaktiviert zugleich die klassische
Lesart einer ‚Marktbürgerschaft‘, die im Kern die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit betrifft. Hierzu passt eine Reihe jüngerer
Urteile, in denen der Gerichtshof zwischen ‚guten‘ und ‚schlechten‘
Bürgern unterscheidet. Insofern bleibt die Unionsbürgerschaft eine
Erfordernis ausreichender Existenzmittel als Voraussetzung für den Aufenthalt
und dem Bestreben, keine Belastung für die Sozialhilfesysteme der Mitgliedstaaten herbeizuführen, geschaffen hat.“ (Rs. Dano, C-333/13, Sammlung der
Rechtsprechung noch nicht veröffentlicht, Rn. 77.)
172
Das Jobcenter prüft zwar die aufenthaltsrechtlichen Bedingungen,
entscheidet aber nur über den Sozialleistungsbezug und nicht über die Aberkennung der Freizügigkeit. Über diese und gegebenenfalls die Abschiebung
entscheidet die Ausländerbehörde. Hier gilt auch noch ein Zeitraum von sechs
Monaten, in dem Unionsbürger*innen keinen Anspruch auf Leistungen haben,
aber die Freizügigkeit noch nicht aberkannt werden darf.
274
�unvollständige Bürgerschaft, die nicht alle Statusinhaber schützt.“
(Thym, 2014)
Dies lässt ihn in einem anderen Text zu der These greifen, dass aus
Unionsbürger*innen nun illegale Migrant*innen werden:
„By denying an application of the non-discrimination guarantees to citizens without residence rights, the Court effectively established a class
of ‚illegal migrants‘ living unlawfully in other Member States without
equal treatment guarantees; citizens who are economically inactive
automatically lose their residence rights.“ (Thym, 2015)
Weil sie für die Prüfung des Aufenthaltsrechts zuständig sind,
werden die Sozialbehörden zu der neuen Grenzpolizei Europas,
wie Claudius Voigt in einem Seminar zu den sozialen Rechten von
Unionsbürger*innen schon 2013 bemerkte. In unzähligen „Grenzsituationen“ (Lebuhn, 2012) managen sie sich verschränkende
Grenzziehungen, die in den Fällen Dano und Alimanovic zwischen
erwerbstätigen Marktbürger*innen und deutschen Bürger*innen
auf der einen und nichterwerbstätigen Ausländer*innen auf der
anderen Seite gezogen wurden. Die Urteile gegen die alleinerziehenden Mütter Dano und Alimanovic (und ihre Kinder) sind so als
migrationspolitischer Einsatz zu erklären: Sie verfolgen das Ziel,
Armutszuwanderung zum Wohle der nationalen (oder auch produktiv-vielfältigen) Gesellschaft zu bekämpfen. Hierauf verweist
auch das folgende Statement des Generalanwalts Wathelet in der
Rechtsache Dano, der vor der Gefahr einer „Massenzuwanderung“
warnt, „die eine unangemessene Inanspruchnahme der nationalen
Systeme der sozialen Sicherheit nach sich ziehen könnte“.173
Resümée: Der kurze Sommer der Sozialunion.
Oder: Wie die Nation vor ‚Sozialtourismus‘ geschützt wurde
173
Schlussanträge des Generalanwalts Melchior Wathelet v. 20.04.2014,
Rs. C-333/13, Rn. 91.
275
�Die Analyse der Rechtsprechungslinie von Sala im Jahr 1998 bis Alimanovic im Jahr 2015 hat Einblick darin gegeben, wie sich innerhalb von
wenigen Jahren nicht nur die Rechtsprechung und Gesetzgebung, sondern auch die Koordinaten des Diskurses und die Kräfteverhältnisse geändert haben. Zumindest in den ersten Jahren haben die Richter*innen
des EuGHs den noch leeren Status der Unionsbürgerschaft imaginativ
mit Inhalt gefüllt. So konnten sie weitgehende Akzeptanz dafür etablieren, dass die Unionsbürgerschaft als grundlegender Status ohne weitere
Bedingungen die Freizügigkeit und das Diskriminierungsverbot eröffnete und auch Nicht-Erwerbstätige Anspruch auf soziale Leistungen
haben konnten. Am weitesten gingen wohl die Urteile zu Trojani und
Vatsouras/Koupatantze, die zeigen, dass die Kräfte in Richtung einer sozialen Union immer wieder so stark waren, dass auch „arme Schlucker
wie Michel Trojani“ (Kingreen, 2007: 74, zit. n. Buckel, 2013: 128) ein
Existenzminimum gesichert bekamen.
Während das Projekt der sozialen Union vor dem EuGH erst scheinbar siegte (so auch Sonja Buckels These), weil der Sozialleistungsbezug
für nichterwerbstätige Unionsbürger*innen nicht mehr pauschal ausgeschlossen war, entstand aus der Kompromissfigur der Prüfung der
‚Verhältnismäßigkeit‘ ein fein abgestimmtes Instrument der Aussiebung
und Kontrolle. Um die Sicherheit der nationalen Sozialsysteme zu gewährleisten wurde die Grundfreiheit der Freizügigkeit an Bedingungen
geknüpft, wie etwa die ‚soziale Integration‘ in die ‚Aufnahmegesellschaft‘ oder die ‚tatsächliche Verbindung zum Arbeitsmarkt‘, die im Einzelfall individuell geprüft werden sollten. Hier bildete sich ein Kompromiss zwischen den proeuropäischen Projekten der sozialen Union sowie
der Liberalisierung des europäischen Raumes einerseits und der Wirkmacht des Nationalprotektionismus andererseits. Statt eine pauschale
Unterscheidung zwischen In- und Ausländer*innen zu treffen, wurde
ein soziales Netz geknüpft, das Erwerbstätige und Arbeitssuchende mit
Aussicht auf Erfolg nach individueller Prüfung auffing, während Nichterwerbstätige und ‚schlechte‘ Arbeitssuchende durch die Maschen fallen gelassen wurden, um die nationalen Sozialsysteme zu schützen.174
174
Anspruch auf Hartz IV besteht weiterhin bei unverschuldetem Arbeitsplatzverlust nach über einem Jahr Arbeitsverhältnis, wenn ein anderer
Aufenthaltsgrund als die Arbeitssuche besteht und bei Daueraufenthaltsrecht
nach mehr als fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Deutschland. EUBürger*innen, die weniger als ein Jahr in Deutschland gearbeitet haben und
276
�Dieser kreative Kompromiss zwischen dem pauschalen Ausschlussprinzip des alten keynesianischen Sozialstaatsmodells und der Europäisierung des Sozialen griff auf die leistungsideologischen Koordinaten zu,
die das Aktivierungsparadigma des workfare absteckten, welches genau
zu dieser Zeit in EU-Europa auf dem Vormarsch war (vgl. Schröder &
Blair, 1999).
„Die Schwelle noch tolerierbarer sozialer Verletzlichkeit“ (Lorey, 2012:
88), von der Isabel Lorey in ihrer Theorie der Prekarisierung als biopolitischer Gouvernementalität spricht, ist hier besonders für die angeblichen
nichterwerbsfähigen Armutszuwander*innen sehr weit unten angelegt.
Die biopolitische Gouvernementalität der Prekarisierung, so Lorey, minimiere Absicherung soweit wie möglich bei gleichzeitiger Maximierung der Prekarität (siehe Kapitel 2). Besonders durch die Konzentration
auf die individuelle Prüfung, wie gut die Kläger*innen in die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt integriert seien, ist im analysierten Rechtsdiskurs
auch „die strukturelle Verstrickung zwischen der Regierung eines Staats
und den Techniken der Selbstregulierung in modernen okzidentalen
Gesellschaften“ (ebd.: 39) zu erkennen, die typisch für gouvernementale Regierenstechnologien ist. Die Rechtssprechungslinie, in der die
nationalstaatlichen Ausschlusskriterien abgeschwächt und die Grenzpraktiken vielmehr (auch im Zuge der Transformation des Sozialstaates
zu einem aktivierenden Workfare-Staat) auf die Prüfung individueller
Integrationsleistungen verschoben werden, kann mit Isabel Lorey so als
Teil des „Normalisierungsprozess“ der Prekarisierung – und somit der
Verschärfung von Ausbeutungsverhältnissen – gesehen werden,
„in dem [...] das existenzielle Prekärsein sich nicht mehr gänzlich durch
die Konstruktion bedrohlicher Anderer verschieben und als Prekarität
abwehren lässt; es artikuliert sich vielmehr in der individualisierten
gouvernementalen Prekarisierung der neoliberal Normalisierten.” (Lorey 2012, 28)
Die Urteile zu Dano und Alimanovic sollten dann aber ganz pauschale
Ausschlusslinien ziehen, was auf die Erstarkung nationalprotektionistischer Kräfte in einem EU-Europa der austeritären Krisenpolitik hinweist. So wurde in den letzten beiden Rechtssachen in den Jahren 2014
und 2015 sowohl die Automatisierung der Freizügigkeit als Grundfreiheit
unfreiwillig arbeitslos geworden sind, können für sechs Monate Hartz IV beziehen.
277
�wie auch die Individualisierung der Prüfung der Verhältnismäßigkeit
im Einzelfall zurückgenommen und durch einen pauschalen Ausschluss
von bürgerschaftlichen Rechten anhand von aufenthaltsrechtlichen
Kriterien ersetzt. Doch insofern, als die aufenthaltsrechtlichen Kriterien der EU-Freizügigkeit der Verwertungslogik folgen (Stichwort
Arbeitnehmer*innenstatus und Erwerbsfähigkeit), ist auch dies nicht
allein als Rückzug zum Prinzip des national-sozialen Staates zu begreifen, sondern vielmehr als migrationspolitische Versicherheitlichung des
workfare.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Diskursfigur des ‚Sozialtourismus‘.
Im nächsten Kapitel werde ich darauf eingehen, wie die Warnungen
vor der „Bedrohung der Sozialsysteme“ in Deutschland im Jahr 2013 mit
einer Moralpanik einherging, die soziale Ungleichheit rassifizierte und
„Armutszuwanderung“ als „Bedrohung des sozialen Friedens“ in den
Städten stilisierte. Der gegen die Figur der „Armutszuwanderung“ und
der „Einwanderung in die Sozialsysteme“ gerichtete Rassismus trieb die
Versicherheitlichung des Regimes der EU-Migration voran, förderte
die Verknüpfung des nationalprotektionistischen Ausschlusses mit der
aktivierenden Logik des workfare und hatte den (internen) Ausschluss
bzw. die differenzierte Inklusion der Nichterwerbsfähigen bzw. Nichterwerbstätigen zum Effekt.
Nachtrag: Die Grenzen der Freizügigkeit und der
selbstorganisierte Arbeitsmarkt in München
Im November 2014 erschien in der SZ ein Artikel zum EuGH-Urteil in
Sachen Dano mit dem Titel Grenzen der Freizügigkeit (Preuss & Janisch,
2014), auf den ich beim morgendlichen Durchblättern der Zeitung sofort aufmerksam wurde, weil er von einem Foto illustriert war, auf dem
ich einen Infotisch der Initiative Zivilcourage erkannte: Drei befreundete
EU-migrantische Arbeiter, Christian und ich sitzen mit dem Rücken zu
einem Schaufenster an einem Tisch und schauen in ein Notizbuch. Vor
dem Tisch steht eine Person mit gefalteten Händen, deren Kopf nicht
zu sehen ist. Im Hintergrund ist eine Ampel zu erkennen. Das Bild ist
untertitelt mit den Worten: „Am Anfang steht die Jobsuche: Nur wer
einmal Arbeit hatte, kann Hartz IV beantragen - Rumänen und Bulgaren
in München“. Das Bild soll wohl die intertextuell bekannte Figur des
278
�‚Tagelöhnermarktes‘ und damit die Arbeitssuche darstellen. Ansonsten nimmt der Artikel allerdings keinen Bezug auf das Foto oder auf
München. Er beginnt damit, dass der Sprecher der Jobcenterleiter*innen
in Deutschland seine Erleichterung über das Urteil ausdrückt. Ein Entscheid in Richtung Einzelfallprüfung hätte den „Jobcentern enorme Arbeit bereitet und viel Streit und Gerichtsverfahren nach sich gezogen“
(ebd.). Er wolle „nicht alle abfertigen“ (ebd.), schließlich sei er auch
Leiter der Offenbacher Integrationsbehörde. Es sei nur so, „dass es etwas viel geworden sei“ (ebd.). Auch brächten viele „weder Ausbildung
noch Deutschkenntnisse mit“ und hätten so „kaum Chancen auf einen
Job“ (ebd.). Erst durch die Erweiterung der EU um Rumänien und Bulgarien sei der „Grundkonflikt […] virulent geworden“ (ebd.), denn mit
dem Gefälle im Einkommen sei „[d]er Sog der reichen Länder“ (ebd.)
gewachsen. Die Autoren des Artikels werten das Urteil dann auch als
„befriedendes Signal“ (ebd.), denn wäre der EuGH im Gegenteil zu dem
Schluss gekommen, „der Bezug von Sozialleistungen gehöre zum unabdingbaren Recht eines jeden Unionsbürgers auf ein menschenwürdiges
Dasein – es wäre eine Revolution gewesen“ (ebd.).
279
�Workfare verschärft - Zwischen Aktivierung
und Ausschluss
Der soziale Frieden ist bedroht – Vom Städtetagspapier zur Verschärfung des Freizügigkeitsgesetzes
Am 22. Januar 2013 veröffentlichte der Deutsche Städtetag ein Positionspapier zu den Fragen der Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien, das die sogenannte Armutszuwanderungsdebatte befeuern sollte.
Die ‚Armutszuwanderung‘ beherrschte die Schlagzeilen der deutschen
Medien in den Jahren 2013 und 2014. Was war der Inhalt des Papiers,
welches diesen Sturm maßgeblich mit entfachte? Der Städtetag, dessen
Vorsitz zu diesem Zeitpunkt der Münchner Oberbürgermeister innehatte, problematisierte die „Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien“
und forderte, in die Versicherheitlichung der Migration (vgl. Kapitel
4) einstimmend: „Der Bund muss anerkennen, dass die soziale Balance
und der soziale Friede in den Städten in höchstem Maße gefährdet sind“
(Deutscher Städtetag, 2013: 6). Die sogenannte Osterweiterung der EU175
um Bulgarien und Rumänien stellte für den Städtetag einen Fehler dar
- eine falsche Entscheidung, in die die Städte nicht eingebunden waren,
aber deren Konsequenzen sie nun ausbaden müssten. Zu Schwierigkeiten käme es nicht bei „der Zuwanderung von qualifizierten EU-Bürgerinnen und Bürgern“, so betonte das Papier, sondern mit dem „Zuzug
der Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die in den neuen Beitritts175
Jozsef Böröcz schlägt in seinen Analysen der EU als koloniales und
orientalistisches Projekt vor, auch den Begriff der ‚Osterweiterung‘ als Teil dieses Projekts zu untersuchen: „Enlargement implies a process of simple augmentation, reducing a daunting amount of social, cultural, moral and administrative complexitiy, involving concerted, sustained action by some very powerful
European states aiming to redraw the continent’s geopolitical order, to a quasitechnical operation. Given that in such idiomatic expressions as Eastern Europe, the term Eastern means either inferior or non-europe, it is quite plausible
to consider, furthemore, the possibility that the name ‚eastern enlargement‘
ends up as an orientalizing tool when applied as the marker of the current redivision of Europe“ (Böröcz, 2001: 6).
280
�staaten teilweise unter prekärsten Bedingungen leben“ (ebd.: 2). Zu den
in den deutschen Städten „sichtbaren Problemkonstellationen“ (ebd.: 4)
gehörten „verwahrloste Immobilien“ (ebd.), Obdachlosigkeit (ebd.), fehlende Krankenversicherung (ebd.: 3), Schlepperei176, sowie „Dumpinglöhne […], Prostitution […] und Bettelei“ (ebd.). Die soziale Ungleichheit in deutschen Städten führten die Verfasser*innen des Papiers auf
Diskriminierung im Herkunftsland zurück. Bei den Zuwanderer*innen,
die Probleme verursachten, so legten sie nahe, handele es sich meist um
Roma, die auch schon im Herkunftsland „unter prekärsten Bedingungen“ (ebd.: 2) leben. Diese würden „ethnische Diskriminierungen, teilweise offene rassistisch motivierte Gewalt [erfahren, und seien] nach
wie vor von weiten Teilen gesellschaftlicher Teilhabe praktisch ausgeschlossen“ (ebd.: 2). Die Exklusion in den Herkunftsländern führe nicht
nur zur Auswanderung der Betroffenen, sondern auch zur Unterwanderung der sozialen Standards in den betroffenen deutschen Kommunen: Dass die Armutszuwander*innen sich „im Zielland mit schlechten
Wohnverhältnissen zufrieden“ gäben, liege etwa an den „miserablen
Wohnverhältnissen im Herkunftsland“ (ebd.: 3). Es seien solche „sozialisationsbedingten Erfahrungshorizonte“, die eine „Integration erheblich
erschweren“ (ebd.). Neue Integrationskonzepte müssten entwickelt werden, so forderte der Städtetag, denn die bisherigen würden sich, „bei der
hier angesprochenen Klientel wenig bewähren“ (ebd.: 5). Neben Sprachkenntnissen müssten auch „europagesellschaftliche ‚Standards‘“ (ebd.:
8) vermittelt werden, denn „Integration beginnt bei den Armutszuwander/innen nicht erst bei Bildung und Fußfassen auf dem Arbeitsmarkt“
(ebd.). Indem die Verfasser*innen die Verantwortung für die angebliche
Devianz der ‚Armutszuwander*innen‘ auf die „zurückgebliebenen“ Balkanstaaten schoben (die eben noch nicht reif für die EU wären), machten sie die dort Diskriminierten, die hier die soziale Sicherheit bedrohten, selbst zu Opfern und ethnisierten die Armut und Ungleichheit der
EU-Migrant*innen sozusagen sekundär. Das Positionspapier schloss
dabei implizit aus, dass ein Grund für die soziale Ungleichheit zum einen die (nicht zuletzt von Deutschland vorangetriebenen) neoliberalen
Restrukturierungsprozesse in den Herkunftsländern sein könnte. Es
176
Als ‚Schlepper‘ werden in dem Papier Personen bezeichnet, die „gegen
ein hohes Entgelt die Vorbereitung der Kindergeldanträge sowie die Vorbereitung des Gewerbezulassungsverfahrens oder die Vermittlung von Wohnraum
zu Wuchermieten“ vornehmen (Deutscher Städtetag, 2013: 3).
281
�blieb so außen vor, dass sozial-ökonomische Probleme in den postsozialistischen EU-Beitrittsstaaten sich zwar sicherlich mit Rassismus gegen
Roma verschränkten, aber doch zum großen Teil Effekte der von der EU
durchgesetzten Liberalisierungs- und Austeritätspolitik177 blieben. Kritischen Wissenschaftler*innen zufolge gehört die Ungleichheit in der Bevölkerung Bulgariens etwa zu den „continuous effects of a peculiar and
detrimental mixture of capital accumulation, dispossession and overexploitation that came with western capital after 1989“ (Apostolova, 2014).
Zum anderen blendet das Papier aus, dass das Problem auch in Deutschland Rassismus sein könnte. Gleichzeitig spielen die Verfasser*innen
selbst ganz plakativ auf der Klaviatur des Rassismus, indem es vor allem
gegen Roma gerichtete Stereotype wie ‚Bildungsferne‘ und ‚Wohnunfähigkeit‘ aufruft und die Minderheit der Roma auch direkt als Problem
bezeichnet.178
Der Städtetag stellte eine breite Palette an Forderungen: Die EU und
die Herkunftsstaaten sollten Diskriminierung und soziale Ungleichheit
in den Herkunftsstaaten bekämpfen. Der Bund solle neue Integrationsmaßnahmen entwickeln, Mittel für Notfallhilfe bereitstellen und vor allem Abwehrinstrumente auf nationalstaatlicher Ebene implementieren.
Ziel seien „nachhaltige Maßnahmen zur Abwendung einer Zuwanderungswelle und der anschließend zu erwartenden Verschärfungen der
Probleme in den Städten“ bzw. die „Unterbindung der Armutszuwanderung“ (Deutscher Städtetag, 2013: 6).
Die grundlegende Aussage des Papiers, dass die ‚soziale Sicherheit‘ in
den Städten in Folge der ‚Armutszuwanderung‘ in Gefahr sei, sollte in
der sich anschließenden Armutszuwanderungsdebatte kaum in Frage
177
Der Politikwissenschaftler Huub van Baar forscht dazu, wie die Europäisierung der Repräsentation der Roma dazu führt, dass die Politikebenen
gewechselt werden (vgl. Van Baar, 2015).
178
Der Antiziganismusexperte Markus End zieht Parallelen zwischen
dem rassistischen, antiziganistischen Diskurs der 1990er Jahre und der sogenannten ‚Armutszuwanderungsdebatte‘, indem er einen Artikel aus dem Spiegel von 1990 zitiert: „Im von Roma besonders angesteuerten Ruhrgebiet beriefen die Oberbürgermeister der Revierstädte demonstrativ eine Krisensitzung
ein. In einem dramatischen Hilferuf (‚Die Städte sind am Ende‘) verlangten sie
von Bonn den sofortigen Stopp des Roma-Trecks. Neun Oberstadtdirektoren
aus Nordrhein-Westfalen sehen den ‚sozialen Frieden in unseren Städten gefährdet‘“ („Asyl in Deutschland? ‚Alle hassen die Zigeuner‘“, 1990: 35, zit. n.
End, 2014: 21).
282
�gestellt werden. Die Stellungnahme wurde vielmehr als berechtigter
‚Hilfeschrei‘ angesehen, welcher auf vom Bund lang vernachlässigte
Probleme hindeutete. Die Reaktionen beschränkten sich nicht auf einen
Medienhype. Die restriktive Kehrtwende des EuGHs, welche sich in den
Urteilen in den Rechtssachen Dano und Alimanovic ausdrückte (siehe
Kapitel 6), wurde von ihren Kommentator*innen auf die Problematisierung von EU-interner Migration in der europäischen Öffentlichkeit
– auch in Deutschland – zurück geführt. In Deutschland griffen verschiedene Politiker*innen das Thema auf. Begünstigt wurde dies durch
den zeitgleich stattfindenden Wahlkampf zur Bundestagswahl 2013. Das
populistische Säbelgerassel der CSU von Wildbad-Kreuth und ihr Slogan „Wer betrügt, fliegt“ sollte dabei prägend werden (vgl. S. Friedrich,
2014). Auch der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich trat mit
markigen Sprüchen – wie z.B. „Wir zahlen nicht zweimal“ (H.-P. Friedrich, 2013)179 – an die Öffentlichkeit und forderte Wiedereinreisesperren,
um die Freizügigkeit von „Sozialbetrügern“ einschränken zu können
(vgl. H.-P. Friedrich, 2013). Für die politischen Akteure auf Bundesebene
geriet durch die Armutszuwanderung nicht nur die ‚soziale Sicherheit‘
in den Städten in Gefahr, sondern im Zentrum der Bedrohung stand
das deutsche Sozialsystem. Durch die Verteidigung des Sozialsystems,
so die Botschaft, sollte (auch) die soziale Sicherheit in den Städten gewahrt werden. Friedrichs Intervention bei den Treffen der europäischen
Innenminister*innen führte im März und Dezember 2013 dann mit dazu,
dass der Beitritt Bulgariens in den Schengenraum verhindert wurde.180
179
Die Forderung, dass „Sozialbetrüger aus anderen EU-Ländern […] mit
einer Wiedereinreisesperre belegt werden“ können, stellte Friedrich auch in
einem gemeinsamen Schreiben mit den niederländischen, österreichischen und
britischen Innenminister*innen (Mikl-Leitner, Friedrich, Teeven & May, 2013;
vgl. auch „Sozialleistungen: Friedrich mobilisiert EU gegen Armutszuwanderung“, 2013).
180
Vgl. „Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens - Friedrich kündigt
deutsches Veto an“, 2013; „Veto in Brüssel - Deutschland verhindert SchengenBeitritt von Bulgarien und Rumänien“, 2013. Die Regelungen der Freizügigkeit
werden oft mit den Schengener Abkommen in einen Topf geworfen, dabei handelt es sich um völlig unterschiedliche Dinge. Bei den Schengener Abkommen
ging es um die Abschaffung der Kontrollen an den EU-europäischen Binnengrenzen. Bulgarien wurde Anfang 2013 der Beitritt zur Schengenzone versagt.
Das hatte für bulgarische Staatsbürger*innen, die in andere EU-Staaten reisen
wollen, aber nur zur Konsequenz, dass sie weiterhin beim Grenzübertritt ihren
283
�Außerdem stieß das Papier des Städtetages mit seinen Schilderungen
und Forderungen einen Prozess an, der zu einer Verschärfung des
deutschen Freizügigkeitsgesetzes/EU führte.
Entlang einer Reihe von bundespolitischen Sitzungen verschiedener Gremien und deren Veröffentlichungen können die Problemvorstellungen und Lösungsstrategien, die sich schließlich in der
Gesetzesänderung vom November 2014 sedimentierten, nachverfolgt und direkt auf das Papier des Städtetages zurückgeführt werden: In Reaktion auf die öffentlichkeitswirksame Intervention des
Städtetages gründeten der Bund und die Länder zuerst einmal die
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Armutswanderung aus Osteuropa. Diese veröffentlichte am 11. Oktober 2013 einen Bericht, der
direkt auf den Städtetag Bezug nahm (vgl. Freie und Hansestadt
Hamburg, 2013). Auch der Koalitionsvertrag der neuen CDU, CSU
und SPD-Bundesregierung vom 17. Dezember 2013 gab die Problemdarstellung des Städtetages wieder und setzte das Ziel,
„im nationalen Recht und im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben durch Änderungen [zu] erreichen, dass Anreize für Migration in die sozialen Sicherungssysteme verringert werden.“ (CDU,
CSU & SPD, 2013: 108)
Im März 2014 veröffentlichten dann die Staatssekretär*innen einen Bericht zu „Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten“, dem Gespräche mit verschiedenen
Expert*innen und Kommunen, inklusive München, voran gegangen
waren und der sich ebenfalls in eine Reihe mit den letztgenannten
Papieren stellte (vgl. Bundesministerium des Inneren & Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2013). Der Bericht stellte fest: „Es
kann nur darum gehen, Fälle von betrügerischer oder missbräuchlicher Inanspruchnahme der Freizügigkeit zu verhindern“ (ebd.: 6)
und erarbeitete „Maßnahmen zur Missbrauchsbekämpfung“ (ebd.:
97f.).
Reisepass oder ihren Personalausweis vorzeigen müssen. Der Nachweis ihrer
Unionsbürgerschaft alleine reicht für den Grenzübertritt, es besteht keine Visumspflicht oder die Pflicht eines weiteren Nachweises der Freizügigkeit.
284
�Auch wenn der Paritätische Wohlfahrtsverband (vgl. Voigt, 2014) und
der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sich in einer Anhörung des
Bundestagsausschusses (vgl. Deutscher Bundestag, 2014b) gegen den
Gesetzesentwurf der Bundesregierung (Deutscher Bundestag, 2014a)
aussprachen, da er gegen das EU-Recht verstieße und weder praktikabel noch sinnvoll sei, auch der Fachbereich Europa des Deutschen
Bundestages (2014) „Zweifel an der Vereinbarkeit […] mit dem Unionsrecht“ anmeldete und die oppositionellen Bundestagsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen (2014) und Die Linke (2014) Gegenanträge stellten,
stimmten Bundestag (am 5.11.2014) und Bundesrat (am 28.11.2014)181 der
Verschärfung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften
(vgl. Deutscher Bundestag, 2014a) schließlich zu und entsprachen damit weitgehend den Forderungen des Deutschen Städtetages. Sie verabschiedeten u.a. folgende Änderungen (vgl. ebd.):
•
•
•
•
Wiedereinreisesperren können nicht nur bei erheblichen Straftaten,
sondern auch dann verhängt werden, wenn Unionsbürger*innen
wiederholt vortäuschen, dass die Voraussetzungen des Rechts auf
Einreise und Aufenthalt vorliegen.
Arbeitssuchenden, die keine tatsächliche Aussicht auf Erfolg bei der
Arbeitssuche nachweisen können, kann nach über sechs Monaten
Aufenthalt die Freizügigkeit aberkannt werden.
Für den Kindergeldantrag muss die Steuer-ID angegeben werden.
Das Erschleichen von Aufenthaltspapieren wird zur Straftat.
Es erstaunt dann auch wenig, dass sowohl die Bundesregierung wie
auch der Städtetag die im letzten Kapitel dargestellte Rechtsprechung
des EuGHs und besonders das Urteil im Fall Vatsouras/Koupatantze von
2009, das den Ausschluss von nichterwerbstätigen Unionsbürger*innen
aus dem Hartz IV für EU-rechtswidrig erklärt hatte, ignorierten. Das
181
Die Grünen im Bundesrat ließen ihre Zustimmung zu den Verschärfungen des Freizügigkeitsgesetzes/EU durch einen Kuhhandel erkaufen, der
EU-Migrant*innen gegen Asylbewerber*innen ausspielte. Der Preis war eine
Finanzspritze von einer Milliarde Euro ‚für Flüchtlinge‘ an die Länder und
Kommunen und Änderungen im Asylbewerbergesetz (u.a. die Erhöhung der
Leistungen), die zuvor vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben worden waren (vgl. Apostolova, 2014; „Länder erhalten eine Milliarde Euro für Flüchtlinge
- Bundesrat billigt Asylbewerbergesetz“, 2014).
285
�restriktive Urteil in der Rechtssache Alimanovic (2015) war zum Zeitpunkt des Gesetzgebungsprozesses noch nicht gesprochen; das ebenfalls restriktive Urteil im Fall Dano, das den Ausschluss von arbeitssuchenden Unionsbürger*innen von Hartz IV aber noch nicht pauschal
absegnete, fiel am 11. November 2014 – nur zwei Wochen bevor der
Bundesrat die Gesetzesänderung endgültig verabschiedete.
In diesem kurzen Abriss wurde deutlich, wie die Problematisierung
der „Armutszuwanderung“ und der „Migration in die sozialen Sicherungssysteme“ (CDU, CSU & SPD, 2013: 108) soziale Verhältnisse auf
rechtspopulistische Art und Weise ethnisierte und versicherheitlichte
und mit einer Verschärfungen des EU-Freizügigkeitsgesetzes Hand in
Hand ging. Die angebliche Bedrohung des ‚sozialen Friedens‘ in den
Städten wurde dabei gleichgesetzt mit der angeblichen Bedrohung der
sozialen Sicherungssysteme im national-sozialen Staat. Als empirischer
Befund lagen der Skandalisierung sicherlich Armut, (Über-)Ausbeutung und extrem prekäre Wohnverhältnisse von EU-Migrant*innen in
Deutschland zugrunde. Statt die prekarisierten EU-Migrant*innen aber
als Teil der städtischen Bevölkerung und ihre Armut als Problem zu begreifen, wurden sie als ‚Armutszuwander*innen‘ rassifiziert und selbst
zum Problem erklärt, das zu bekämpfen sei. Die Städte hätten durchaus
auch andere Möglichkeiten gehabt, der Armut ihrer Einwohner*innen
zu begegnen – z.B. hätten sie fordern können, den Ausschluss arbeitssuchender Ausländer*innen vom Hartz IV aufzuheben und damit gerade zu dem Zeitpunkt, als das Projekt der „Sozialen Union“ mit dem
EuGH-Urteil in Sachen Vatsouras/Koupatantze gerade auf dem Höhepunkt seiner Kräfte war, durchaus Anschlussmöglichkeiten in den EUeuropäischen Kräfteverhältnissen gefunden.
Das sozialpolitische Paradigma der Aktivierung kam sowohl im Städtetagspapier wie auch im Gesetzgebungsprozess kaum zum Tragen bzw.
fand es in der ‚Armutszuwanderung‘ sein Anderes. Das Ziel der Aktivierung tauchte eventuell noch in der Forderung nach eigenen Integrationskursen auf, da bei dem „angesprochenen Klientel“ „Integration nicht erst bei der Arbeit“ anfange (vgl. Deutscher Städtetag, 2013:
8). Ansonsten wurden die ‚Armutszuwander*innen‘ als hoffnungslos
markiert. Auch die Gesetzesänderung fokussierte nicht auf ‚Potenziale‘
der Migrant*innen, sondern darauf, Betrug zu bekämpfen und – in den
Worten des Koalitionsvertrages – „Anreize für Migration in die sozialen
Sicherungssysteme“ (CDU, CSU & SPD, 2013: 108) zu verringern. Der
286
�national-staatliche Ausschluss wurde der neoliberalen Aktivierung gegenüber also als Lösung des Problems ‚Armutszuwanderung‘ bzw. ‚Sozialleistungsbetrug‘ bevorzugt. Die Einschränkung der Freizügigkeit und
der sozialen Rechte von EU-Migrant*innen diente der Migrationskontrolle und renationalisierte die europäischen Verhältnisse. Es handelt
sich aber um keinen einfachen rollback zum alten Sozialstaat, sondern
die Widersprüche zwischen dem national-sozialen Staat und der Europäisierung wurden hier insofern produktiv, als die Freizügigkeit mit
der Konditionalisierung bzw. Ökonomisierung der sozialen Rechte kombiniert wurde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, den bis hierher
erwähnten Stellungnahmen genau zuzuhören und ihre Aussagen nicht
als reine Lippenbekenntnisse abzutun, wenn sie sich für Freizügigkeit
positionieren, indem sie betonen, dass es nicht um eine „Abschottung
Deutschlands vor Zuwanderung“ (Deutscher Städtetag, 2013: 1) gehe,
dass „die Akzeptanz für die Freizügigkeit erhalten“ (CDU, CSU & SPD,
2013: 108) werden solle und dass „die Freizügigkeit in der EU […] eine
der wichtigsten Errungenschaften des europäischen Einigungsprozesses
und einer der sichtbarsten Vorzüge Europas für die Bürgerinnen und
Bürger“ (Deutscher Bundestag, 2014: 1) sei. Im Sinne des postliberalen
Rassismus wurde zwischen den guten und den schlechten Migrant*innen
unterschieden – zwischen denjenigen, die im Sinne einer Marktbürgerschaft willkommen sind und die ihre Freizügigkeit rechtmäßig ausüben,
und den ‚Armutszuwander*innen‘ bzw. ‚Sozialbetrüger*innen‘. Faktisch
hat diese Politik den Ausschluss der Subproletarier*innen zum Effekt
bzw. die weitere Prekarisierung der von Armut betroffenen Personen
ohne (dokumentierte) Arbeit, der im Zuge der austeritären Restrukturierung der europäischen Peripherie von ihren Reproduktionsmöglichkeiten enteigneten Arbeiter*innen. Es handelt sich dabei weniger um
einen territorialen, als vielmehr um einen sozialen Ausschluss, denn die
Betroffenen der Abschreckungspolitik halten sich schon längst nicht
mehr in der territorialen Peripherie auf, sondern sind in die Zentren
migriert. In transnationalen Verhältnissen hat der nationale Ausschluss
auch innerhalb des nationalen Territoriums soziale Spaltungen, Ungleichheiten und differenziert-inkludierte Zonen der extremen Prekarisierung und Entrechtung zur Folge. Die differenziert Inkludierten werden dann wiederum als das zu bekämpfende Außen rassifiziert. Dieser
zirkuläre Prozess entspringt dem Konflikt zwischen Europäisierung und
(Re-)Nationalisierung und findet seine Fluchtlinie in der neoliberalen,
287
�postrassistischen Unterscheidung zwischen den nützlichen, erwerbsfähigen Marktbürger*innen und den Anderen.
Es mag scheinen, dass ich mich über die Diskussionen zum EuGH, zum
Städtetagspapier, zum bundesweiten Mediendiskurs und zu den bundesdeutschen Gesetzgebungsprozessen relativ weit von den konkreten Auseinandersetzungen in München entfernt habe. Ich denke aber
gezeigt zu haben, dass die verschiedenen Ebenen ineinandergreifen
und nicht voneinander zu trennen sind.182 Die lokalen Auseinandersetzungen im Regime der EU-Migration sind nicht zu verstehen, ohne die
EU-europäische und nationale Ebene sowie transversale Prozesse mit
einzubeziehen. Dabei handelt es sich weder um stringente top-down,
noch um unidirektionale bottom-up Dynamiken und auch in ihrer
Temporalität sind die verschiedenen Prozesse nicht direkt aufeinander
zu beziehen. Aus einer solchen Perspektive gilt es nun, zu der Frage
zurück zu kommen, wie sich die Regelungen zur EU-Freizügigkeit und
zu sozialen Leistungen sowie die dahinter stehenden Rationalitäten
der (Re-)Nationalisierung, Europäisierung und des Postrassismus sich
in den lokalen Praktiken, Strategien und Kämpfen verknüpft haben.
Auch in diesem Kapitel geht es mir wieder darum, nachzuvollziehen,
wie die transversalen Verhältnisse in den von mir mitverfolgten Auseinandersetzungen ganz konkret ausgehandelt wurden. Wie wurde
der Zugang der EU-migrantischen Arbeiter*innen, mit denen ich im
Workers’ Center zusammenarbeitete, zu sozialen Leistungen ausgehandelt? Was passierte, wenn EU-Migrant*innen in München Hartz IV
beantragten? Wie reagierte das Jobcenter – und welche Rolle spielte
die Ausländerbehörde zwischen aktivierendem und nationalem Sozialstaat in EU-Europa?
Die Münchner Ausländerbehörde als Aktivierungsinstanz
Eines Tages im Frühjahr 2012 (also sowohl vor den EuGH-Urteilen
Dano und Alimanovic wie auch vor dem Städtetagspapier, der sogenannten Armutszuwanderungsdebatte und der Verschärfung des EUFreizügigkeitsgesetzes) kam Stefan Asenov in das Workers’ Center und
182
Zur Verstrickung von Lokalem, Globalem und verschiedenen Ebenen
vgl. Glick Schiller & Caglar, 2011; Law & Urry, 2004; Varsanyi, 2008.
288
�zeigte mir einen Brief der Ausländerbehörde, der an seinen sechsjährigen Sohn adressiert war:
„da Sie nach Aktenlage Ihren Lebensunterhalt nicht ohne den Bezug
von öffentlichen Leistungen sicherstellen können, genießen Sie kein
Freizügigkeitsrecht/EU nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, da
Sie gemeinsam mit Ihren Eltern Leistungen nach dem SGB II beziehen.
Die Ausländerbehörde München beabsichtigt daher einen Bescheid zu
erlassen, in dem fest gestellt wird, dass Sie das Recht auf Einreise und
Aufenthalt (FreizügG/EG) verloren haben. [...] Die Ausländerbehörde
wird Ihnen eine Frist zur Ausreise setzen und Sie bei nicht fristgerechter Ausreise aus dem Bundesgebiet in Ihr Heimatland oder in ein anderes Land, das zu Ihrer Aufnahme verpflichtet ist abschieben.“
Zwar gab es vor der endgültigen Entscheidung noch Gelegenheit, sich
zu den beabsichtigten Maßnahmen zu äußern. Trotzdem erschrak ich
sehr, als ich den Brief las. Als ich Stefan Asenov den Inhalt des Briefs
übersetzte, war er verzweifelt. Wie die Klägerinnen im zweiten Kapitel
kam Stefan Asenov aus der Stadt Pazarjik in Bulgarien. Dort verdiente
er den Lebensunterhalt seiner Familie damit, dass er Hochzeiten und
andere Familienfeste mit Foto und Film dokumentierte. In den 1990er
Jahren schlossen aber verschiedene Fabriken in und um Pazarjik. Dort,
wo vorher die Fabriken standen, standen nun teilweise große Einkaufsmärkte von nach Bulgarien expandierten deutschen Unternehmen:
Kaufland, Penny und Lidl, so erzählte er. Viele seiner Kund*innen, die
zuvor in den Fabriken gearbeitet hatten, verloren ihre Arbeit und er
selbst bekam keine Aufträge mehr. Während Stefan Asenovs Familie
erst noch in Pazarjik blieb, kam er im Jahr 2001 (also etwa sechs Jahre
vor dem EU-Beitritt Bulgariens) nach München und lernte seinen zukünftigen Arbeitgeber in einem Café im Bahnhofsviertel kennen. Für
diesen arbeitete er acht Jahre, die ersten sechs ohne Papiere. Er putzte
in Supermärkten: Kaufland, REWE, Edeka. Halb belustigt, halb erzürnt
betonte er, dass dies teils die selben Märkte waren, die ihre Produkte
nun dort verkauften, wo seine ehemaligen Kund*innen zuvor industriell
Gemüsekonserven und andere Waren produziert hatten. Als Bulgarien
im Jahr 2007 der EU beitrat und Bulgar*innen als Unionsbürger*innen
nun leichter eine Arbeitsgenehmigung beantragen konnten, beantragte
auch Stefan Asenovs Arbeitgeber eine Arbeitserlaubnis für ihn. Obwohl
289
�Stefan Asenov Vollzeit arbeitete, verdiente er nur etwa 1300 Euro im
Monat. Mit seiner vierköpfigen Familie gehört er zu den sogenannten
arbeitenden Armen, den working poor in Deutschland. Inzwischen war
auch Stefan Asenovs Familie nachgekommen. Weil sie keine eigene
Wohnung fanden, wohnte die Familie zur Untermiete (ohne schriftlichen Mietvertrag) in einem Zimmer in der Wohnung einer entfernten
Verwandten. Doch Mitte 2012, Bozhurka Asenova war gerade hochschwanger, wurden sie obdachlos. Sein langjähriger Arbeitgeber hatte
ihm drei Monate keinen Lohn mehr gezahlt und deswegen hatten sie
ihre Miete nicht mehr zahlen können. Stefan Asenov kündigte und fand
eine neue Arbeit. Diese verlor er dann aber schnell wieder, weil er keine
Adresse vorweisen konnte und außerdem ständig erschöpft war aufgrund der Obdachlosigkeit.
Eines Dienstags kamen Bozhurka Asenova und Stefan Asenov dann zum
ersten Mal in das Workers’ Center der Initiative Zivilcourage. Wir machten uns gemeinsam auf den umständlichen und konfliktreichen Weg, ihr
Recht auf ein Existenzminimum vom Staat und von der Stadt einzufordern - zum Wohnungsamt, dem Jobcenter und der Ausländerbehörde.
Obwohl die Familie, weil Stefan Asenov dokumentiert gearbeitet hatte
und sie mehr als sechs Monate polizeilich gemeldet gewesen waren, anspruchsberechtigt war183, mussten wir viele Widerstände überwinden.
Nach einigen Monaten aufwendiger und mühseliger Auseinanderset183
Die Personen, von deren Kämpfen ich in dieser Arbeit berichte, waren
alle schon einige Zeit in München und hatten (dokumentiert) gearbeitet. In das
Workers’ Center kamen aber auch viele Personen, deren Situation sich anders
gestaltete, die z.B. erst wenige Monate oder Wochen in München waren, nicht
oder undokumentiert arbeiteten und keine Anmeldung hatten. Diese Personen
konnten wir beispielsweise dabei unterstützen, vorenthaltene Löhne einzufordern oder Schulden in Raten abzuzahlen, aber meistens versuchten wir erst
gar nicht, soziale Leistungen oder eine Notunterkunft zu beantragen, weil –
ob nach den internen Regelungen der Ämter oder nach der bundesdeutschen
Gesetzgebung – kein Anspruch bestand. Wir organisierten aber immer wieder
gemeinsam politische Proteste und Kampagnen, um diese Rechte einzufordern.
Mit der Auswahl der Kämpfe von Personen, die nach den postrassistischen
Maßstäben zu den ‚nicht ganz so schlechten Migrant*innen‘ gehörten – weil sie
arbeiteten, ‚fleißig waren‘, ihre Papiere beisammen hatten – möchte ich keinesfalls eben diese normativen Kriterien des ‚guten Arbeiters‘ reproduzieren. Es
ist aber interessant, wie die Ausschlüsse sich auf unsere Unterstützungspraxis
im Workers’ Center so auswirkten, dass ich ihnen auch in dieser Arbeit bis zu
einem gewissen Grade folge.
290
�zungen mit dem Jobcenter und dem Wohnungsamt (die ich nur teilweise
mit ausgefochten habe) dachten wir als Unterstützer*innen der Familie
von der Initiative Zivilcourage schon, wir hätten alles versucht,
und wollten aufgeben. Doch dann gingen Bozhurka Asenova und
Stefan Asenov noch einmal in das Wohnungsamt. Als sie eine erneute Absage erhielten, protestierten sie und drohten, nicht wieder zu gehen, bevor sie ein Dach über dem Kopf bekämen. Sie
hatten Erfolg. Nun wohnte die inzwischen fünfköpfige Familie
in einer städtischen Notunterkunft und erhielt aufstockend Hartz
IV. Doch dann kam der Brief der Ausländerbehörde. Alles, was sie
erkämpft hatten, sahen sie nun in Gefahr. Nach so vielen Jahren
in München sollten sie abgeschoben werden?
Ich stelle das Städtetagspapier, den Gesetzesänderungsprozess
und die Auseinandersetzungen der Familie Asenov nicht gegeneinander, um die Problemdarstellung der Städtevertreter*innen Lügen zu strafen und den bundesdeutschen Gesetzgeber*innen Unmenschlichkeit vorzuwerfen. Es geht mir vielmehr darum, einen
genauen Blick auf die produktiven Verschränkungen der Alltagskämpfe, Rationalitäten und Technologien des Regierens zwischen
den verschiedenen Ebenen zu werfen. Wie kam es zu dem Brief
der Ausländerbehörde, welche Rationalität steckte dahinter? Welche Effekte hatte er? In welche lokalen Regime war er eingebettet?
Die Möglichkeit der Ausländerbehörde, unter gewissen Umständen die Freizügigkeit abzuerkennen, hatte wie ein Damoklesschwert über unseren Kämpfen um soziale Leistungen für
Unionsbürger*innen gehangen. Wir wussten, dass die Jobcenter
der Ausländerbehörde den Bezug von sozialen Leistungen meldeten und dass diese dann tätig werden konnte. Der Brief an den
Sohn der Asenovs war der erste mir bekannte Fall, in dem die
Ausländerbehörde eine Aufenthaltsbeendigung einleitete.
Ich rief die zuständige Sachbearbeiterin in der Ausländerbehörde
an. Wie vermutet erklärte diese, dass nicht nur an das sechsjährige Kind, sondern an alle Familienmitglieder solche Briefe abgeschickt worden seien. Als ich fragte, was sie nun tun könnten,
erklärte sie, Stefan Asenov müsse eben arbeiten. Als ich sagte,
er arbeite ja und erhalte aufstockend Leistungen, was sie denn
mit „arbeiten“ meine, antwortete sie, er solle 40 Stunden arbeiten:
291
�„Wie jeder normale Mensch“. Da ich noch keine Erfahrung in dieser Sache hatte, fragte ich auf einer bundesweiten Mailingliste
zu Themen der EU-Migration nach helfenden Informationen und
schickte einen Scan des Briefs anonymisiert mit. Aus Berlin kam
Antwort:
„Dieser Bescheid (von welcher Behörde? leider fehlt der Absender usw.!)
ist offensichtlich rechtswidrig und ein politischer Skandal, der (meiner Meinung nach mitsamt Kopfbogen und Name des Sachbearbeiters
usw.) öffentlich gemacht werden sollte! ... Es reicht für das Freizügigkeitsrecht, wenn ein Ehepartner mindestens 6 - 10 Std/Woche arbeitet
für mind. 200 bis 300 Euro oder (unter den Voraussetzungen des § 2 Abs
3 FreizügG/EU) gearbeitet hat.“
Wir atmeten vorsichtig auf. Ich machte mich an eine gründliche rechtliche Recherche und schrieb eine Email an die zuständige Stelle der
Ausländerbehörde, in der ich sie auf ihren Fehler aufmerksam machte:
Der Sozialleistungsbezug habe nichts mit der Aufenthaltserlaubnis zu
tun, solange eine Person den Arbeitnehmerstatus besitze. Der Abteilungsleiter rief mich zurück und gab mir Recht, dass der Bezug von Sozialhilfe allein nicht zur Aberkennung der Freizügigkeit führen könne.
Er nahm die Drohung für die Familie Asenov zurück und versprach,
das Schreiben in Zukunft zu ändern. In den nächsten Jahren sollten
mir noch öfters Briefe von Sachbearbeiter*innen der Ausländerbehörde begegnen, in denen sie Unionsbürger*innen, die Hartz IV bezogen,
die Abschiebung bzw. den Verlust der Freizügigkeit androhten – meist
in rechtlich korrektem Wortlaut. Die Betroffenen mussten sich in der
Folge schnell eine (weitere) Arbeit suchen und viele verzichteten im
Anschluss aus Angst vor Konsequenzen auf die Zahlungen des Jobcenters. Auch Stefan Asenov hatte sich, um auf der sicheren Seite zu sein,
inzwischen noch einen zweiten Job im Reinigungsgewerbe gesucht
und arbeitete jetzt mindestens 60 Stunden die Woche. Trotzdem lag
die Familie immer noch unter der Mindesteinkommensgrenze und bezog weiterhin Hartz IV. Hier bestätigte sich die Kritik, dass der Zwang
zur Arbeit Jobs im Niedriglohnsektor fördert, die nicht zum Überleben
reichen (vgl. Dickinson, 2016; Fox Piven, 1998; Peck, 2001).
Bei einem späteren Treffen erklärte mir der Abteilungsleiter der Ausländerbehörde, welche Rationalität hinter dem Brief gesteckt habe: Seine
292
�Behörde wolle die Personen nicht außer Landes befördern, sondern integrieren. Es lohne sich ausländerrechtlich gar nicht, die Ausweisung
einzuleiten, da sie gleich wieder einreisen könnten. Nur die Fünfjahresfrist fange von vorne an, das lohne sich eventuell.184 Die Intervention
der Ausländerbehörde sei hingegen als „Initialzündung zur gelungenen
Integration“ gedacht. Ziel sei, dass die Betroffenen sich Arbeit suchten,
denn Integration gelinge nur über Arbeit.185 Zu dieser Logik passte auch
die Aussage der Sachbearbeiter*in, Stefan Asenov müsse eben, „wie
jeder normale Mensch, 40 Stunden in der Woche arbeiten.“ Sie konstruierten eine gesellschaftliche Norm der (Vollzeit-)Lohnarbeit, wie sie
typische für die heutige Arbeitsgesellschaft ist, in der immer mehr Menschen dieser Norm aber nicht gerecht werden (vgl. Hirsch, 2015).
Der Brief verweist auch darauf, dass Prozesse des policy making eben
nicht top-down strukturiert sind, sondern lokale street-level bureaucrats
und Kommunalpolitiker*innen ihre Strategien in relativer Autonomie
gestalten. Neue Vorgaben können sie dabei entweder ignorieren, besonders schnell aufnehmen oder umgestalten – sei es aus dezidiertem Widerstand zu den höherinstanzlichen Regelungen, aus Unwissenheit oder
aus Versehen. Zu diesem Schluss kommen auch verschiedene Studien
zu street-level bureaucracy, wie etwa die ethnografische Forschung der
Kulturanthropologin Sharon Elizabeth Wright (2013) zu einem Jobcentre
in Schottland oder auch die in Kapitel 5 schon erwähnte Studie zu den
Reaktionen der städtischen Verwaltung auf Familien mit beschränktem
Zugang zu sozialen Leistungen in Berlin und Madrid (vgl. Price & Spencer, 2014).
Die Mitarbeiter*innen der Ausländerbehörde München haben in ihrer eigenwilligen Umsetzung des Freizügigkeitsgesetzes die nationalstaatliche
184
Zu einem ähnlichen Schluss kam das KVR auch offiziell im Bericht
Runder Tisch Armutszuwanderung von 2014: „Derartige Bescheide entfalten –
sofern die Betroffenen freiwillig ausreisen – keine Wiedereinreisesperre, d.h.
nach erfolgter Ausreise ist eine erneute Einreise und ein Aufenthalt zumindest
für drei Monate jederzeit möglich. Dennoch kann durch diese Bescheide zumindest das Entstehen eines Daueraufenthaltsrechts verhindert werden“ (Stelle für Interkulturelle Arbeit, 2014: 6).
185
Dazu reproduzierte er eine Zeitungsmeldung, derzufolge vor kurzem der gesamte Münchner S-Bahnverkehr gestoppt worden sei, weil
Unionsbürger*innen illegal ein Haus zwischen den Gleisen bewohnt hatten
und von der Polizei geräumt werden mussten. Mit diesem Bild kontrastierte er
die gelungene Integration, die sein Amt fördere.
293
�Exklusionslogik jedenfalls zum einen verschärft, indem sie die Freizügigkeit alleine vom Sozialhilfebezug abhängig machten und den Arbeitnehmerstatus dabei ignorierten. Gleichzeitig haben sie die Ausschlusslogik dieser Regelung, die zur Bekämpfung von Sozialtourismus dienen
soll, zu einer aktivierenden Inklusionspolitik umgedeutet. Sie bekämpfen den ‚Sozialhilfebetrug‘ so im positiven, integrativen und paternalistischen Sinne durch Aktivierung, statt im negativen und exklusiven
Sinne durch Ausschluss, wobei die Aktivierung paradoxerweise durch
die Androhung des Ausschlusses erfolgen soll. So machen sie Sinn aus
dem Widerspruch in der Gesetzgebung, die zwar eine Aberkennung des
Aufenthaltsrechts, aber keine Wiedereinreisesperren (wie sie Außenminister Friedrich in nationalstaatlicher Rationalität im Frühjahr 2013 folgerichtig fordern sollte) vorsieht. Eine Abschiebung brächte nichts, weil
die Abgeschobenen ja gleich wiederkommen könnten. Die Androhung
der Abschiebung könne aber den ‚Sozialhilfebetrug‘ durch den Zwang
zur Arbeit bekämpfen. Sie gehen so über den Punkt, an dem sich der europäisierte Status der Freizügigkeit mit der nationalen Exklusionslogik
bricht, kreativ hinaus. Die Ausländerbehörde, traditionell die Vollstreckungsbehörde der nationalen Exklusionslogik, wird hier zur Aktivierungsinstanz, zum Akteur im workfare-Regime.
Bis hierher bin ich an verschiedensten Stellen auf Artikulationen des
‚Workfarism‘ (Peck, 2001), z.B. die mit workfare verbundenen Rationalitäten und Regierenstechnologien der Aktivierung getroffen und habe
diese nachverfolgt. Einige davon waren eher unvermutet: Elemente der
Wohnungslosenpolitik der Stadt München etwa oder eben die Strategien der Ausländerbehörde. Einige Male kam die Logik der Aktivierung
durch ihr Außen, die ‚Nicht-Aktivierbaren‘ und in den Aushandlungen
der Linie zwischen diesem ‚Innen‘ und ‚Außen‘ in der Arbeitsgesellschaft, zum Tragen. Sie artikulierte sich in den Aushandlungen um die
Deutung des ‚Tagelöhnermarktes‘ und bei den sicherheitspolitischen
Maßnahmen im Bahnhofsviertel, aber auch in der Wohnungslosenpolitik, in der obdachlosen Personen nur dann ein Anspruch auf eine Notunterkunft eingeräumt wurde, wenn sie ‚eine Perspektive in München‘ hatten, während der Aufenthaltsstatus oder die Staatsbürger*innenschaft
nur indirekt eine Rolle spielte. Die workfare-Rationalität der Aktivierung hat sich dabei immer wieder mit dem Staatsrassismus der nationalsozialen Exklusionsweise, humanitärer Moral und teilweise mit linken
Forderungen nach grundlegenden sozialen Rechten verschränkt. Wie
294
�sieht es aber im Herzstück der deutschen Ausprägung des Workfarism,
dem Jobcenter aus?
Das Münchner Jobcenter als Grenzbehörde
Die Gründung der Jobcenter wurde in den Hartz-Reformen im Jahr 2004
beschlossen. Die Jobcenter sollten die mit der weitgehenden Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld neu geschaffene und
im Sozialgesetzbuch II verrechtlichte „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ administrativ umsetzen. Die Hartz-Reformen gingen aus der
Neuorientierung der Sozialdemokrat*innen um die Jahrtausendwende
als Teil der Agenda 2010 hervor. Dem gingen wiederum Kritiken am
keynesianischen Wohlfahrtsstaat als paternalistisch, extrem bürokratisch, bevormundend und als soziale Hängematte voraus. Er verstärke
die ‚Antriebslosigkeit‘ und ‚Faulheit‘ der Armen, belaste die Wirtschaft
und blähe den Staat unnötig auf. Der damalige britische Premierminister Tony Blair und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, beide
Sozialdemokraten, hatten in einer gemeinsamen Veröffentlichung, die
wegweisend sein sollte, schon im Jahr 1999 die Devise, „das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung
um[zu]wandeln“ (Schröder & Blair, 1999) zur Aufgabe der sozialdemokratischen neuen Mitte ausgerufen. Die Umstrukturierung des deutschen Sozialhilfesystems lag dabei ganz im Trend des Workfarism (Peck,
2001), wie er in den USA unter dem Schlagwort „Work first“ durch Bill
Clinton, und in Großbritannien eben durch Blair umgesetzt wurde. Diese Programme verbinden den Bezug von sozialen Leistungen mit dem
Zwang zur Lohnarbeit und rekonfigurieren das alte Wohlfahrtssystem.
„Where welfare stood for passive income support, workfare stands for
active labour inclusion. And where welfare constructed is [sic] subjects
as claimants, workfare reconstitutes them as jobseekers.“ (Peck, 2003:
76)
Workfarism ist im Rahmen der Arbeitsgesellschaft (vgl. Hirsch, 2015) zu
verstehen, in der Lohnarbeit zum Dreh- und Angelpunkt der Moralvorstellungen, der Subjektivierungen und eben auch der Technologien des
Regierens wird. Arbeitslosigkeit liegt in der Schuld der Einzelnen, statt
295
�als systemischer Teil der Marktwirtschaft begriffen zu werden. Deshalb
ist die Aktivierung der Einzelnen, ihre Erziehung zu marktwirtschaftlichem Verhalten, zur Optimierung ihrer Erwerbsfähigkeit, das Ziel der
workfare-Programme. Die sozialdemokratische neue Mitte erfordere so
auch „einen modernen Ansatz des Regierens – Der Staat soll nicht rudern, sondern steuern, weniger kontrollieren als herausfordern“ (Schröder & Blair, 1999).
Zum 1. Januar 2005 wurden für erwerbsfähige Personen, die länger
als ein Jahr erwerbslos sind, das Arbeitslosengeld und die Sozialhilfe
zur Grundsicherung für Arbeitssuchende – auch Alg II oder Hartz IV
genannt – zusammengelegt. Die Umsetzung wurde in die Hände der
Jobcenter gelegt und auf den einfachen Slogan gebracht: Fördern und
Fordern. Hinter dieser
„Formel [...] verbirgt sich die programmatische Idee, die Erwerbslosigkeit sei vor allem dadurch zu bekämpfen, dass man bei der Eigenverantwortung und Beschäftigungsfähigkeit des Erwerbslosen ansetzt.“
(Scherschel & Booth, 2012)
Die Aufgabe der Jobcenter ist die Aktivierung der Erwerbslosen zur erfolgreichen Jobsuche, statt die bloße Sicherstellung ihres Existenzminimums. Wer alle Bedingungen erfüllt, bekommt den Regelsatz, der auf
dem niedrigen Niveau der Sozialhilfe angesiedelt wurde, Kosten für Unterkunft und Heizung und bei gewissen Mehrbedarfen gegebenenfalls
Sonderleistungen. Zum Fördern gehören Qualifizierungsprogramme
und Ein-Euro-Jobs. Individualisierte Ziele werden in sogenannten Wiedereingliederungsvereinbarungen, die die Verantwortung den Arbeitssuchenden zuschieben, festgehalten. Wenn die Leistungsbeziehenden
sich in diesem Prozess nicht (ausreichend) engagieren, wenn sie etwa
Termine nicht wahrnehmen oder Jobangebote ablehnen, dann drohen
Sanktionen, die bis zur hundertprozentigen Reduzierung der Leistungen
reichen können. Der Druck hinter der staatlichen Forderung, einen Job
– egal welchen – anzunehmen, steigt – „workfarism seeks to push the
poor into the labour market“ (Peck, 2003: 78).
Durch die Produktion eines spezifischen Angebots an Arbeitskraft sollte
diese Reform auch in den Arbeitsmarkt eingreifen und Hand in Hand
gehen mit den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010, die contingent
jobs, wie den Niedriglohnsektor, förderten. „Der Arbeitsmarkt braucht
296
�einen Sektor mit niedrigen Löhnen, um gering Qualifizierten Arbeitsplätze verfügbar zu machen“ (Schröder & Blair, 1999), deswegen gelte es, „Arbeitgeber durch den gezielten Einsatz von Subventionen für
geringfügige Beschäftigung [… zu …] ermutigen, ‚Einstiegsjobs‘ in den
Arbeitsmarkt anzubieten“ (ebd.), so hatten es Schröder und Blair schon
im Jahr 1999 vorgeschlagen. Jamie Peck merkt kritisch an, dass auf diese
Weise die Löhne in eine staatlich geförderte Abwärtsspirale getrieben
wurden:
„In contrast to the welfarist dynamic, in which the establishment of a
‚floor‘ of welfare standards effectively set (and raised) standards at the
bottom of the labor market, the workfarist dynamic pulls in the opposite direction, drawing down conditions in the lowest reaches of the
labor market, as uncommodified shelters from wagelabor are closed off
and as former welfare recipients are compelled to accept whatever the
market makes available to them locally.“ (Peck, 2003: 82)
In der Bundesrepublik sind es vor allem die Jobcenter aber auch andere
Behörden, die die Politik des workfare bzw. des aktivierenden Sozialstaats ausführen. Zu der spezifischen Schnittstelle von Aktivierungs-,
Prekarisierungs- und Migrationspolitiken in lokalen Behörden und Regimen gibt es meines Wissens nach noch keine Forschungen.186 Auch
186
Zum wissenschaftlichen Kontext: Im Bereich der Soziologie haben
sich Debatten zu Aktivierung (vgl. etwa Lessenich, 2013; Eversberg, 2015) und
Prekarisierung (vgl. Castel & Dörre, 2009) entwickelt, die aber selten beide Entwicklungen miteinander in Verbindung setzen und außerdem das Thema Migration tendenziell ausblenden, wie auch in der Einleitung zu dem Sammelband
Neue Prekarität zu lesen ist (Scherschel, Streckeisen & Krenn, 2012). Kulturanthropologische Arbeiten zum Jobcenter in Deutschland gibt es bisher kaum.
Eine Ausnahme bildet Katrin Lehnerts (2009) diskursanalytische Magisterarbeit zur Figur des ‚Sozialschmarotzers‘. Es gibt zwar fachspezifische Arbeiten,
die sich um verwandte Themen, wie etwa die Prekarisierung von Arbeits- und
Lebensverhältnissen (vgl. Götz, Huber & Kleiner, 2010; Götz, Lehnert, Lemberger & Schondelmayer, 2010; Götz & Lemberger, 2009; Seifert, Götz & Huber,
2007) drehen, sie fokussieren aber eher auf den Wandel in den Arbeitsverhältnissen und den Umgang von Lohnabhängigen mit ihm. Im englischsprachigen
Raum gibt es dagegen bereits einige kulturanthropologische Forschungen zu
Institutionen des workfare. So etwa die Dissertation der Sozialwissenschaftlerin Sharon Elizabeth Wright, die die sozialen Prozesse herausarbeitet, in denen die gesetzlichen Vorgaben in einem Jobcentre in Schottland sowohl von
297
�ich kann diese Forschungslücke hier nur in kleinem Maßstab füllen. Für
meine Forschungsfrage nach den Versuchen des Regierens von EU-interner Migration in München, stellt das Jobcenter nur eine unter vielen
Komponenten dar – aber eine bedeutende.
Perspektiven aus dem Jobcenter München
Im Rahmen des städtischen Fachaustausches Südliches Bahnhofsviertel,
der den ‚Tagelöhnermarkt‘ zum Thema hatte, lernte ich Anfang 2013
den Leiter eines Münchner Jobcenters, der auch die Geschäftsführung
der Münchner Jobcenter in Bezug auf das Thema Migration vertrat,
kennen. Als ich ihn um ein Interview bat, reagierte er erst überrascht.
„Bulgar*innen“ seien eigentlich kein spezifisches Thema für ihn. Denn
wenn Personen zum Rechtskreis SGB II gehörten, wäre es eigentlich
egal, ob sie Migrationshintergrund hätten, oder nicht. Und wenn sie
nicht zum Rechtskreis gehörten, dann hätte er ja auch nicht mit ihnen
zu tun. Ziel des Jobcenters sei es, so erklärte Herr Müller mir, als wir im
April 2013 dann doch mit Kaffee und Aufnahmegerät bei ihm im Büro
saßen, die anspruchsberechtigten Klient*innen in Arbeit zu vermitteln.
Der Migrationshintergrund sei da eigentlich nicht ausschlaggebend.
„Migrationshintergrund als solches, das wird ja in den Medien immer
als etwas Negatives dargestellt. Die Erfahrung machen wir hier nicht.
[...] Wenn ich jetzt einen Bulgaren nehme, der zum Rechtskreis SGB
II gehört und der kann gut Deutsch, dann ist die Tatsache, dass er aus
Bulgarien kommt, belanglos. Den kriegen wir auch irgendwo unter.“
Zum Rechtskreis SGB II gehören erwerbsfähige Deutsche, die in
den letzten 24 Monaten weniger als ein Jahr gearbeitet haben und
deren Einkommen und Vermögen unter den Richtwerten liegt.
Auch Drittstaatler*innen können unter bestimmten Umständen
Sachbearbeiter*innen wie von Klient*innen ausgehandelt wurden, durch die
also policy in der Praxis entstand (vgl. Wright, 2013). In ihrer Untersuchung,
wie sich foodstamp-Programme in New York transformiert haben, kommt die
Anthropologin Maggie Dickinson zu dem Ergebnis: „This conservative, paternalistic welfare regime commodifies labor, creates new patterns of stratification among the urban poor, and redraws the terms of economic citizenship“
(Dickinson, 2016: 270).
298
�– dazu gehört ein gefestigter Aufenthaltsstatus – Anspruch auf
Hartz IV haben. Unionsbürger*innen, die (oder deren Familienangehörigen) weniger als ein Jahr dokumentiert gearbeitet haben
und weniger als fünf Jahre rechtmäßigen Aufenthalt nachweisen
können, haben nur Anspruch, wenn sie arbeiten. Dann gehören sie
zu den sogenannten Aufstocker*innen, deren geringe Löhne von
sozialen Leistungen aufgestockt und damit subventioniert werden.
Unionsbürger*innen, die weniger als ein Jahr gearbeitet haben, haben für sechs Monate Anspruch auf Hartz IV.
Bei anspruchsberechtigten Arbeitssuchenden kämen eigentlich nur
dann Probleme auf, so der Jobcenterleiter, wenn Qualifikationen
fehlten, und das gelte genauso für Deutsche wie für Migrant*innen:
„ ... und wenn man jetzt mal deutsche Jugendliche nimmt, zum
Beispiel, wenn die keinen Hauptschulabschluss haben, die sitzen
in dem selben Dilemma, auch wenn sie keinen Migrationshintergrund haben.“
Ein Problem für die Integration in den Arbeitsmarkt stellten mangelnde Sprachkenntnissen dar, darauf sei das Jobcenter aber nicht
spezialisiert. Deswegen habe er eine Kooperationsvereinbarung getroffen, die dem Jobcenter Arbeit spart:
„ ... dass wir unsere Zuwanderer zwischen 15 und 25 dem Jugendmigrationsdienst weiterleiten. Die prüfen, muss er noch einen
Integrationskurs machen und kümmern sich um die Zuleitung
zum Integrationskurs. Und wir kriegen den Kunden erst wieder
zurück, wenn er beim Integrationskurs war. Das heißt, wir haben einen Teil der Tätigkeit, die wir sonst selber machen müssten,
ausgelagert.“
Im Laufe des Interviews wunderte sich Herr Müller aber dann doch,
„wieso der vermehrte Zuzug von Bulgaren und Rumänen sich nicht
im SGB II widerspiegelt“, wieso also relativ viele leistungsberechtigte EU-Migrant*innen keine Leistungen bezögen.187 Auch hier sah er die
187
Laut Bundesagentur für Arbeit erhielten zum 31. August 2013 816 Bulgarinnen und Bulgaren sowie 634 Rumäninnen und Rumänen Leistungen nach
dem SGB II vom Jobcenter München. Insgesamt betrug die Zahl der leistungs-
299
�fehlenden Sprachkenntnisse auf Seiten der potenziellen ‚Kund*innen‘ als
mögliche Erklärung: „Das stellen wir bei Ausländergruppen fest, wenn
die Sprachkenntnisse nicht da sind, dass da ein Informationsproblem da
ist. Also wie erfahren sie von den Angeboten, die es gibt.“ Gleichzeitig
sei es aber nicht Aufgabe des Jobcenters, für „die verschiedenen Nationalitäten eine Extrawurst zu braten“, denn „die Grundstrategie ist,
dass die Angebote, die wir insgesamt haben, ja allen offen stehen“. Auch
wenn Herr Müller zugab, dass die Sachbearbeiter*innen aufgrund von
sehr hohen Fallzahlen nicht immer ihrer erweiterten Beratungspflicht
nachkämen, bestand das Problem aus Sicht von Herrn Müller nicht
in zu wenig Unterstützung oder in der Einsprachigkeit der Behörden,
sondern in den mangelnden Sprachkenntnisse der Kund*innen.188 Insgesamt hatte ich nach dem Interview den Eindruck, dass die anfängliche Überraschung des migrationspolitischen Sprechers der Münchner
Jobcenter zu einem migrationsspezifischen Thema angefragt zu werden,
seine Taktik, migrationsrelevanten Fragen und Aufgaben eher aus dem
Weg zu gehen, widerspiegelte.
Dies führt mich zu der Frage, welche Erfahrungen wir als Initiative Zivilcourage im Rahmen der Unterstützung von antragstellenden oder
leistungsbeziehenden EU-Migrant*innen in Konflikten mit den Münchner Jobcentern gemacht haben.
Hartz IV beantragen
In der Arbeit der Initiative war uns bis etwa 2013 gar nicht bewusst, dass
viele der Personen, die wir unterstützten, tatsächlich einen Anspruch
berechtigten Personen knapp 74.000. (Vgl. Stelle für Interkulturelle Arbeit,
2014)
188
Grundsätzlich könne das Jobcenter Dolmetscher*innen stellen, in der
Praxis würden die Kund*innen aber immer gefragt, ob sie selber eine Person
mitbringen könnten, die beim Übersetzen helfe. Wenn sie verneinten, könne
ein*e Dolmetscher*in bestellt werden, so der Jobcenterleiter. Aus seiner Sicht
stellte das erhöhte Arbeitspensum von 130 Fällen pro Sachbearbeiter*in ein
weiteres Problem dar, das es den Mitarbeiter*innen erschwere, ihrer erweiterten Beratungspflicht nachzukommen.
300
�auf Hartz IV hatten – dies wurde nicht nachgefragt und unsere Tätigkeiten richteten sich nach den Anfragen und Konflikten, die aufkamen.
Wir selbst verbanden Hartz IV wohl zu dieser Zeit noch so sehr mit dem
Inländerstatus, dass wir gar nicht auf die Idee kamen, dass ausländische
Staatsbürger*innen einen Anspruch haben könnten. Zudem lebten viele
der Personen, mit denen wir arbeiteten, in so prekären Verhältnissen,
dass sie die für einen solchen Anspruch nötigen Papiere nicht vorweisen konnten. So hatten viele keine Anmeldung, für die ein schriftlicher Mietvertrag nötig gewesen wäre. Bevor die Einschränkungen der
Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit Ende 2013 aufgehoben wurden, hatten auch noch weniger Arbeiter*innen schriftliche Arbeitsverträge. Als
wir herausfanden, dass viele der Personen, mit denen wir zusammenarbeiteten, Anspruch auf Hartz IV hatten, sahen wir hier eine Chance auf
bessere Lebensverhältnisse. Schnell wurde es eine unserer regelmäßigen Tätigkeiten im Workers’ Center, Hartz IV Anträge und Wiederbewilligungsanträge auszufüllen, sowie Telefonate mit Sachbearbeiter*innen
des Jobcenters zu führen. Wenn eine Person Anspruch hatte (etwa weil
sie arbeitete oder mehr als fünf Jahre Aufenthalt nachweisen konnte)
und Leistungen beantragen wollte, dann konnten wir den Anspruch für
gewöhnlich auch durchsetzen. Dies bedeutete, den Antrag auszufüllen,
viele Papiere zu besorgen und diese fristgerecht abzugeben. Wenn der
Antrag zunächst abgelehnt wurde – was immer wieder geschah – schaltete sich ein mit der Initiative Zivilcourage zusammenarbeitender Jurist
ein. Nicht wenige Personen und Familien konnten so aus der extremsten
Unsicherheit und Armut heraustreten. Krisensituationen, wie sie etwa
durch Krankheit, Schwangerschaft, Jobwechsel, Lohnbetrug und Arbeitslosigkeit auftraten, wurden durch die Leistungen aufgefangen. Mit
der Bestätigung des Jobcenters, für die Kosten von Unterkunft und Heizung aufzukommen, war es auch einfacher, eine Wohnung zu finden.
Doch um zu der Frage zurückzukommen: Wieso spiegelte sich die Zuwanderung nicht in den Jobcentern wieder? Gab es Hürden, die es erschwerten, Hartz IV zu beantragen? Die Gründe waren offensichtlich
vielfältig. Viele Anspruchsberechtigte, die ich auf ihren Anspruch hinwies, wollten gar keine Sozialleistungen beantragen. So hätten einige
der Frauen aus dem zweiten Kapitel, die unter der Einkommensgrenze
verdienten, Anspruch auf aufstockende Leistungen gehabt, lehnten mein
Angebot aber ab, sie beim Beantragen zu unterstützen, denn sie wollten
mit dem Jobcenter nichts zu tun haben, sondern ihren Lebensunterhalt
301
�mit den eigenen Händen verdienen. Eine von ihnen zeigte mir, als sie
dies erklärte, mit Stolz ihre Hände, denen die schwere Arbeit als Reinigungskraft deutlich anzusehen waren. Als ich versuchte, sie zu überzeugen, dass sie so vielleicht sogar eine eigene Wohnung finden könne
und dass sie, die jetzt Ende 50 sei, ja auch immer älter werde, sagte sie
mir: „Vielleicht im nächsten Monat…“ Aber auch im nächsten und im
übernächsten Monat wollte sie keine Leistungen beantragen. Für mich
werden hier die verschiedenen Dimensionen der Subjektivierung in der
Arbeitsgesellschaft deutlich: Auf der einen Seite stellen das Beharren
auf Eigenständigkeit und der Arbeitsethos genau das Ziel der Politiken,
die Arbeitslosigkeit und den Bezug von sozialen Leistungen als moralische Verfehlung des Einzelnen markieren, dar.189 Auf der anderen Seite
ist die Weigerung, sich in die Abhängigkeit vom (workfare-)Staat zu
begeben, oder überhaupt nur in Kontakt mit staatlichen Akteuren zu
kommen, eine Form des Widerstands, eine Bewegung des escape und
des Entgehens (vgl. Lorey, 2011; Papadopoulos, Stephenson & Tsianos,
2008). Hier zeigt sich, wie nah Unterwerfung und Entunterwerfung in
Subjektivierungsprozessen zusammenliegen (vgl. Foucault 1988; 1994),
oder nach dem Hamburger Forschungsteam von Marianne Pieper, Efthimia Panagiotidis und Vassilis Tsianos:
„Subjektivierungsprozesse im Kontext von Prekarität implizieren eine
doppelte Dynamik: die einer Flexibilisierung ‚von oben‘ und die der
Dynamik von ‚Selbstverhältnissen‘ oder ‚Technologien des Selbst‘ einer
produktiven Subjektivierung, die sich zugleich in einer Immanenzbeziehung mit der Macht befindet und – als Fluchtlinie – über diese hinausweist.“ (Pieper, Panagiotidis & Tsianos, 2009)
Gleichzeitig gab es, wie gesagt, auch viele Arbeiter*innen, die Hartz IV
beantragen wollten. Für fast alle EU-migrantischen Arbeiter*innen, die
in das Workers’ Center kamen, stellte es aber ein Ding der Unmöglichkeit
dar, einen Antrag auf Leistungen nach SGB-II (Hartz IV) selbstständig
auszufüllen. Eigentlich haben die Sachbearbeiter*innen in den Jobcentern eine erweiterte Beratungspflicht, unter der sie beim Ausfüllen, nötigenfalls auch mit Dolmetscher*innen, helfen müssen. Die wenigsten
189
Auch im Realsozialismus, in dem die Frauen aufgewachsen waren,
spielte die Subjektivierung als ‚gute Arbeiter*innen‘ eine zentrale Rolle.
302
�kommen dem aber nach, was auch der Jobcenterleiter bestätigte und mit
den hohen Fallzahlen begründete.
Meinen Erfahrungen im Kontext des Workers’ Centers nach sind die
Jobcenter nicht auf die mehrsprachigen gesellschaftlichen Realitäten
eingestellt. Die Anträge sind in bürokratischem Deutsch gehalten und
waren auch für mich, als ich mich das erste Mal mit einem Antrag auseinandersetzte, in mehreren Details unverständlich. Zwar gibt es die
Ausfüllungsanleitungen in verschiedenen Sprachen, aber die Anträge
nur auf Deutsch.
Auch mehrsprachige Sachbearbeiter*innen sind angewiesen, mit ihren Klient*innen Deutsch zu sprechen und alle Bescheide und Briefe
werden in deutscher Sprache verschickt, Formulare auf Deutsch ausgefüllt, denn die Amtssprache im Jobcenter, wie in anderen Behörden in
Deutschland, ist Deutsch. Für Personen, die kein Deutsch sprechen oder
mit dem Amtsdeutsch nicht vertraut sind, stellt dies eine Hürde dar, die
sie nur mit Unterstützung überwinden können.
Eine weitere Hürde stellen die vielen Papiere dar, die verlangt werden:
Kontoauszüge der letzten drei Monate, Mietvertrag, Informationen zu
den Arbeitsverhältnissen der letzten Jahre, vom Arbeitgeber ausgefüllte
Arbeitsbestätigung, Nachweise über Vermögen und einige mehr. Welche Schwierigkeiten dies in den prekarisierten Lebens- und Arbeitsverhältnissen der EU-migrantischen Arbeiter*innen hervorruft, wurde
im zweiten Kapitel schon deutlich, als es um die Beantragung von Gerichtskostenhilfe ging.
Auch der im dritten Kapitel und in Bezug auf das Wohnungsamt im
fünften Kapitel beschriebene Generalverdacht schlug uns in der Kommunikation mit den Sachbearbeiter*innen der Jobcenter regelmäßig
entgegen: Die Person müsse doch ein Einkommen haben, von was solle
sie denn sonst leben? Es könnten ja nicht alle kommen, wieso gingen sie
nicht nach Bulgarien zurück, wenn sie hier nicht klarkämen? So erklärte mir eine Sachbearbeiterin eines Tages am Telefon, als ich mich nach
dem Stand des Antrags von Familie Asenov erkundigte.
Oft waren die Probleme, die wir im Workers’ Center zu lösen versuchten, auch zu brennend, um ihnen mit der langwierigen Beantragung
von Hartz IV zu begegnen. Um eine längerfristige Lösung wie Hartz
IV anzugehen, hatten wir dann oft keine Kapazitäten mehr. Wenn ich
vorschlug, Leistungen nach SGB II zu beantragen, sagte ich dazu immer,
dass dies eine sehr langsame Sache sei (bzw. sagte ich ‚cok yavaș bir șey‘
303
�auf Türkisch), die bis zu drei Monaten oder mehr dauern könne, bis das
Geld käme. Es gelte, viele Papiere zu besorgen und dann regelmäßig
zum Jobcenter zu gehen und schließlich wahrscheinlich einen Integrationskurs zu besuchen. Möglicherweise melde sich dann die Ausländerbehörde (‚yabancilar polisi‘, Fremdenpolizei auf Türkisch), woraufhin sie
mit dem Brief der Ausländerbehörde so schnell wie möglich in das Workers’ Center kommen sollten. Immer wieder entschieden sich berechtigte Personen dann auch aufgrund dieser Komplikationen dagegen, die
Leistungen zu beantragen.
Bis hierher ging es um das Jobcenter in Bezug auf Leistungsberechtigte.
Spielten Personen, die nicht zum ‚Rechtskreis SGB II‘ gehörten, wirklich
keine Rolle für das Jobcenter, so wie es Herr Müller in seinem obigen Zitat behauptet hat? Ich möchte hier argumentieren, dass sie in der Figur
der ‚Sozialhilfebetrüger*innen‘ und in den Überlegungen und Praktiken
zur Bekämpfung von ‚Sozialhilfemissbrauch‘ eine zentrale Rolle auch
innerhalb des Jobcenters spielen.
Sozialhilfemissbrauch bekämpfen
Als ich den Jobcenterleiter fragte, ob seiner Meinung nach alle
Unionsbürger*innen freien Zugang zu Sozialleistungen in Deutschland
haben sollten, lachte er auf und meinte, das halte er für schwierig, denn
das große Problem bei der Globalisierung sei das wirtschaftliche Gefälle, das zwischen den Ländern herrsche. Die Schwierigkeit läge darin,
so glaube er, „den Sozialleistungsmissbrauch einzudämmen“, weil „[e]s
kann ja niemand ein Interesse daran haben, dass ich ein Sozialhilfesystem aus den Angeln nehme. Weil ja dann auch die darunter leiden, für
die es da ist“.
Sozialhilfemissbrauch zu bekämpfen, sah er als eine der wichtigsten
Aufgaben des Jobcenters an. So sprach er sich beispielsweise dafür aus,
mehr Mitarbeiter*innen einzustellen, um aufgrund eines zu hohen Fallaufkommens unbemerkt erschlichene Leistungen einzusparen, was die
entstehenden Kosten für mehr Personal wieder decken würde. In der
Frage der mangelnden Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge hatte
er sich hingegen nicht für mehr Personal ausgesprochen. Mit diesem
Fokus auf Verfolgung und dem Misstrauen, dass das Verhältnis zu
den ‚Kund*innen‘ prägte, entsprach er damit ganz dem Credo der
Hartz-Reform. Doch was definierte er als Sozialleistungsmissbrauch
304
�und wieso sprach er von ihm so explizit in Zusammenhang mit
Unionsbürger*innen? Wer sind die, „für die es da ist“ und für wen ist
das Sozialhilfesystem nicht da?
Als ich ihn fragte, was er unter Sozialleistungsmissbrauch verstehe,
antwortete er:
„Zum Beispiel mit dem Ziel nach Deutschland zu kommen, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Weil es sie zum Beispiel im
Heimatland nicht gibt. Da muss ich noch gar nichts ... ähm ... jetzt
hier irgendeine Straftat begehen. Weil im engeren Sinne ist ja Sozialhilfemissbrauch, wenn sie Angaben verschweigen und sie eigentlich gar keinen Anspruch hätten und sie die Leistungen trotzdem
erschleichen – wider besseren Wissens. Aber im weiteren Sinne ist
es für mich auch eine Form von Sozialhilfemissbrauch, wenn ich
nach Deutschland komme mit dem Ziel, sie in Anspruch zu nehmen. Weil es mir dann einfach besser geht wie daheim. Also wenn
jemand nach Deutschland kommt, mit dem Ziel zu arbeiten und
wenn jemand sich selber unterhalten kann, ist das ja o.k. so. Aber
wenn er ganz genau weiß, dass er das nicht kann, finde ich das
schon problematisch.“
Der Jobcenterleiter problematisiert nicht Migration per se. Mit
denjenigen Migrant*innen, die sich selbst ernähren können, hat er
kein Problem. Eine Bedrohung stellten diejenigen dar, die gar nicht
nach Arbeit suchen möchten, sondern alleine mit dem Ziel kommen, Sozialleistungen zu beziehen. Sein Verdacht ging aber noch
weiter. Da für Unionsbürger*innen allein Erwerbstätigkeit den Zugang zu Hartz IV ermöglichte, wurde ihm selbst die Arbeitssuche
– der Logik des Generalverdachts folgend – zum Betrugsversuch:
„…und da war ja die Frage mit den in Anführungszeichen modernen Tagelöhnern, da war mein Eindruck, dass sie das machen, um
den Schritt ins SGB II machen zu können“, so erklärte er. Hier beißt
sich die Katze in den Schwanz: Migrant*innen sollen arbeiten, aber
gerade die Arbeit – bzw. die prekäre Arbeit und Arbeitssuche im
Fall der ‚Tagelöhner‘ – weist für den Sprecher des Jobcenters darauf
hin, dass die ‚Tagelöhner*innen‘ eigentlich nur Leistungen missbrauchen möchten.
305
�Sozialhilfe zu beziehen ist für Migrant*innen nach dieser Logik – unabhängig davon, ob sie sich den Anspruch erschleichen
oder regelgerecht wahrnehmen – illegitim. Die Kategorie des
Missbrauchs folgt hier den nationalen Grenzen zwischen In- und
Ausländer*innen. Der Kontrast zwischen den Erwartungen, die der
Jobcenterleiter an in- und ausländische Subjekte stellt, wurde noch
klarer, als er später, als es nicht mehr um Migration ging, sagte,
dass das Jobcenter für die Menschen zuständig sei, „die ihr Leben
nicht so gut in die Hand nehmen können“, denn „das ist ja auch
eine Funktion der Sozialleistungssysteme, auch solchen Menschen
eine Existenzgrundlage zu verschaffen, die sie sonst nicht hätten“.
Migrant*innen müssen sich dagegen selbst ernähren – oder eben
wieder gehen. Im Endeffekt denkt er in Bezug auf Ausländer*innen
die Logik des workfare stringent zu Ende: Nur diejenigen werden als Teil der Gesellschaft (und des Sozialleistungssystems)
aufgenommen, die arbeiten (und auch das kann, wie bei den
‚Tagelöhner*innen‘, verdächtig wirken). Für Unionsbürger*innen
wird der Zwang zur Arbeit nicht nur durch Sanktionen durchgesetzt, sondern ist Grundlage des Anspruchs auf Leistungen. Arbeit
wird zur Grundlage des Rechts auf ein Existenzminimum – keine Arbeit, kein Existenzminimum. In der pauschalen Bindung des
Existenzminimums an den Zwang zur Arbeit wird workfare und
die Aktivierungslogik radikalisiert und das Sozialstaatsprinzip verletzt.
Im Lichte der Transformationen von Welfare zu Workfare überrascht es dann eher, dass er sich als Leiter des Jobcenters auch für
diejenigen Inländer*innen zuständig fühlt, „die ihr Leben nicht so
gut in die Hand nehmen können“, denn hier kommt das alte, keynesianische welfare-Regime zum Tragen, in dem das Existenzminimum derer gesichert werden sollte, die arbeitslos sind, auch wenn
sie wenig Nützlichkeitspotenzial hatten – solange sie zur nationalstaatlichen (sowie heteronormativen und männlichen) Gemeinschaft gehörten.
Der Ausschluss von arbeitssuchenden bzw. ohne-Aussicht-aufErfolg-arbeitssuchenden Unionsbürger*innen aus den Zonen der
Gesellschaft, für die sich der Sozialstaat zuständig fühlt, wurde im
306
�Paragraphen 77 (Abs. 1 S. 2 Nr. 2) des SGB II zum Gesetz gemacht.190 Neben den Hürden, die auch Leistungsberechtigten den Zugang zu Hartz
IV erschweren, war es sicherlich dieser Paragraph, der eine wichtige Rolle dabei spielte, dass so wenig Bulgar*innen und Rumän*innen
Leistungen bezogen. Anträge von Personen, die nicht arbeiteten, nicht
gerade eine Arbeit unfreiwillig verloren hatten und weniger als fünf
Jahre rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland nachweisen konnten,
wurden – wenn sie überhaupt einen Antrag stellen – entweder schon
im Eingangsbereich des Jobcenters oder von den Sachbearbeiter*innen
abgelehnt.
Die Frage, inwiefern der Ausschluss von arbeitssuchenden
Ausländer*innen aus dem Hartz IV extreme Armut in München befördert, stellte auch die Fraktion der Grünen und der rosa liste im
Münchner Stadtrat im Jahr 2006, wie im Kapitel zur Wohnungslosenpolitik dargestellt (vgl. Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste, 2006).
Der Ausschluss, so die Prognose des Sozialreferats, würde nicht zu
mehr Armut in München, sondern zu Abschreckung führen. Diese Position folgte der nationalstaatlichen These, dass Migration durch den
Ausschluss aus den national-sozialen Sicherungssystemen verhindert
werden könne. Alleine schon die hartnäckige Existenz des selbstorganisierten Arbeitsmarkts und die Tatsache, dass das Thema ‚Armutszuwanderung‘ einige Jahre später zu einem hot topic auch in der Münchner Kommunalpolitik wurde, sollte diese These aber widerlegen. Vor
die Herausforderung, dass die Migration von Unionsbürger*innen
190
Das Bundessozialgericht hat im Jahr 2010 entschieden, dass der Leistungsausschluss von Unionsbürger*innen, die sich zum Zwecke der Arbeitssuche in Deutschland befinden, für Staatsbürger*innen von Vertragsstaaten des
Europäischen Fürsorgeabkommens (EFA) keine Anwendung finden darf (BSG
v. 19.10.10 - B 14 AS 23/10R). Daraufhin setzte die Bundesregierung das EFA, das
seit 1953 gegolten hatte, im Jahr 2011 außer Kraft. Um gegen diese weitere Stufe
im Abbau der sozialen Rechte von Unionsbürger*innen einzutreten, gründete
sich in Berlin das Netzwerk gegen den deutschen EFA-Vorbehalt (vgl. http://
efainfo.blogsport.de). Auch rechtlich blieb der Ausschluss umstritten. Für die
meisten Unionsbürger*innen, mit denen die Initiative Zivilcourage zusammen
arbeitete, spielten die Auseinandersetzungen um das EFA aber keine Rolle, da
für sie als bulgarische Staatsbürger*innen das Fürsorgeabkommen nie gegolten
hatte. Vertragsstaaten des EFA sind Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Türkei und Großbritannien.
307
�doch nicht so einfach zu regulieren war, gestellt, verknüpften verschiedenste Akteure des Regierens Aufenthaltsrecht und Sozialrecht
noch fester. In diesem Zusammenhang wurde die Androhung der Abschiebung zur „Initialzündung zur gelungenen Integration“ und der
migrationspolitische Sprecher des Jobcenters erklärte es zur wichtigsten Aufgabe der Sachbearbeiter*innen des Jobcenters, Sozialhilfebetrug (auch von leistungsberechtigten Ausländer*innen) zu bekämpfen.
Die hier aufgezeigten Verschränkungen von Aufenthalts- und Sozialpolitiken sind also nicht nur eine radikale Schlussfolgerung aus den
Glaubenssätzen des workfare, sondern sie machen auch aus der Perspektive des Nationalprotektionismus Sinn, indem die nationale und
städtische Bevölkerung vor der ‚Bedrohung der Sozialsysteme‘, die auch
eine Bedrohung des ‚sozialen Friedens‘ darstelle, geschützt wird.
Über Aktivierung und Ausschluss hinaus
Dieses Kapitel ist von dem Positionspapier des Städtetages vom Januar 2013 ausgegangen, das urbane soziale Ungleichheit im Kontext
der EU-Migration rassifizierte und skandalisierte und damit sowohl
die sogenannte ‚Armutszuwanderungsdebatte‘ in den Medien, wie
auch die Verschärfung des deutschen Freizügigkeitsgesetzes anstieß.
Nicht die Armut der EU-Migrant*innen wurde problematisiert, sondern die sogenannten ‚Armutszuwander*innen‘ selbst wurden als
Problem und Bedrohung für den ‚sozialen Frieden‘ in den Städten
und auch für das deutsche Sozialsystem markiert. Dann bin ich darauf eingegangen, wie das Jobcenter und die Ausländerbehörde auf
EU-Migrant*innen reagiert haben. Ihre Praktiken, Rationalitäten und
Strategien gingen kreativ mit dem Widerspruch zwischen nationalstaatlicher Exklusion und EU-europäischer Freizügigkeit (und der
Autonomie der Migration) um, indem sie den Fluchtlinien des workfare folgten. Die Ausländerbehörde wurde zur Aktivierungsinstanz
und das Jobcenter zur (internen) Grenzbehörde.191
191
Auch Claudius Voigt hat schon darauf hingewiesen, dass das Sozialrecht in Deutschland immer mehr zum migrationspolitischen Instrumentarium
wird mit dem Ziel, ‚gute‘ von ‚schlechten‘ Migrant*innen zu unterscheiden.
„Die soziale und physische Exklusion der einen geht mit der möglichst umfas-
308
�Diese empirischen Beobachtungen entsprechen den Analysen
des postliberalen Rassismus, der zwischen guten und schlechten
Migrant*innen anhand von liberalen Normen unterscheidet. Vassilis
Tsianos und Marianne Pieper sprechen von einer Flexibilisierung der
rassistischen Grenzziehungen im Rahmen von Bürgerschaftspolitiken:
„Es gilt, die rassistischen Praktiken nicht nur über binäre Differenzierung und Prozesse der Exklusion zu bestimmen, sondern primär
über neuartige Prozesse einer limitierten Inklusion bzw. einer egalitären Exklusion, d.h. über Politiken einer reversiblen Staatsbürgerschaft postnationaler Subjekte.“ (Tsianos & Pieper, 2011: 118)
Und auch Étienne Balibar hat auf die Individualisierung und Ökonomisierung der Vorstellungen von ‚Innen‘ und ‚Außen‘ bzw. auf die
Verschränkung von neoliberal-kapitalistischen und rassistischen
Dynamiken hingewiesen:
„[W]o auf der einen Seite die Nation oder der politische Nationalismus
steht, der sich auf die Vorstellung einer ‚essenziellen Gemeinschaft‘
und deren einzigartigen Schicksal gründet, und auf der anderen Seite
der auf Konkurrenz beruhende Markt, der - im Unterschied zur Nation - weder einen inneren noch einen äußeren ‚Feind‘ zu haben und
niemand auszuschließen scheint, der aber eine allgemeine individuelle
Selektion institutionalisiert, deren untere Grenze die soziale Eliminierung der ‚Unfähigen‘ und ‚Unnützen‘ darstellt.“ (Balibar, 2008: 23)
An dem Migrationsprojekt und den Kämpfen der Familie Asenov,
die in Konflikt mit Ausländerbehörde, Jobcenter und auch Wohnungsamt getreten sind, zeigt sich jedenfalls, dass die Versuche des
Regierens ihre Lebensverhältnisse weiter prekarisiert und ihre Obdachlosigkeit und Armut perpetuiert haben. Sie waren zwar nicht
‚wirklich‘ in Gefahr, abgeschoben oder inhaftiert zu werden, aber
durchaus kurz davor, durch alle städtischen und staatlichen Sicherungsnetze zu fallen – was auch einem ‚sozialen Tod‘ gleichkommt.
Ihr Schritt aus der akuten Krise lässt sich nicht auf die Androhung
senden Unterwerfung der anderen unter die ökonomische Verwertung einher“,
so Voigt (2016) am 12. Mai 2016 in der Wochenzeitung Jungle World.
309
�der Abschiebung als angeblich integrationsfördernde Maßnahme
oder auf den Ausschluss von Arbeitssuchenden aus dem Hartz IV,
mit dem Armutszuwanderung bekämpft werden soll, zurückführen,
sondern auf die Hartnäckigkeit und Kämpfe der Familie Asenov, ihre
Koalition mit der Initiative Zivilcourage und auf das Recht auf soziale Leistungen, das zumindest für erwerbstätige Unionsbürger*innen
(noch) gilt. Gleichzeitig zeigte sich die Wirkmacht des Zwangs zur
Arbeit, die dazu führte, dass Stefan Asenov zwischenzeitlich über 60
Stunden die Woche im Niedriglohnbereich arbeitete.
310
�311
�„What sort of crisis is this?“192
In den sieben Kapiteln dieses Buches bin ich der Frage nachgegangen,
wie EU-interne Migration in München regiert wird und wie die Versuche des Regierens ausgehandelt werden. Die ethnografische Regimeanalyse als kulturanthropologische Herangehensweise hat es erlaubt,
verschiedene Orte und Handlungsebenen der Auseinandersetzungen
einzubeziehen und mit radikal-sozialkonstruktivistischer Aufmerksamkeit nachzuspüren, zu welchen Brüchen, Widersprüchen und unerwarteten Produktivitäten es in den Aushandlungsfeldern gekommen ist.
Aus einer positionierten und selbstreflexiven Perspektive der Kämpfe
und mit Konflikt als Methode habe ich mich in die konkreten Auseinandersetzungen der EU-Migrant*innen mit Arbeitgeber*innen, auf den
Ämtern, mit Polizei und Geschäftsleuten eingebracht. Ausgehend von
den Konfliktlinien, die sich in diesen Auseinandersetzungen aufgetan
haben, habe ich darüber hinaus verschiedene Veröffentlichungen, die in
den Aushandlungsfeldern eine Rolle gespielt haben, in die Analyse mit
einbezogen – wie etwa Papiere aus dem Stadtrat, den Rechtsprechungsdiskurs am EuGH oder Medienberichte.
Ausgegangen bin ich vom selbstorganisierten Arbeitsmarkt im Münchner Bahnhofsviertel (Einleitung) und von den Arbeitskämpfen sowie
dem Migrationsprojekt einer Gruppe von EU-Migrantinnen (Kapitel 3).
Die soziale Formation des selbstorganisierten Arbeitsmarkts war Treffpunkt von Arbeiter*innen, von denen die meisten (zumindest die ältere Generation) im Zuge der postsozialistischen Transformationen ihre
Lohnarbeit (meist ungelernte Arbeiten in Fabriken) und Existenzgrundlage in Bulgarien verloren hatten und auf der Suche nach einem besseren Leben nach München kamen. Der selbstorganisierte Arbeitsmarkt
kann gleichzeitig als Ausbeutungstechnologie und als widerständige
kollektive Praxis analysiert werden und wurde der Stadt München als
‚Tagelöhnermarkt‘ zum Problem – zu einem Teilproblem des neuen Politikfeldes ‚Armutszuwanderung‘.
Die Entdeckung des ‚Tagelöhnermarkts‘ trug dazu bei, dass in der
Stadt München die Auseinandersetzungen dazu begannen, wie die
Stadt auf die EU-interne Migration reagieren bzw. wie sie sie regieren
solle. Zuerst einmal sahen sich die stadtpolitischen Akteure mit der
192
312
Clarke, 2012: 44; Hall 2012: 56
�Situation konfrontiert, dass es sich hier um Personen handelte, die weder Inländer*innen, noch Ausländer*innen (aus Staaten, die nicht zur EU
gehören) waren, sondern einer dritten Kategorie angehörten: Sie waren
Unionsbürger*innen und somit freizügig. Sie konnten sich in München
und auf den Münchner Straßen aufhalten, hatten aber nicht dieselben
Rechte wie deutsche Bürger*innen. Der Bund hatte im Jahr 2006 vorgesehen, arbeitssuchende Ausländer*innen von der Grundsicherung für
Arbeitssuchende und damit faktisch vom Recht auf ein Existenzminimum gesetzlich auszuschließen. Auch wenn dieser Ausschluss auf EUEbene stark umkämpft war, schloss sich die Stadt ihm fraglos an. Wie
sollten aber die städtischen Institutionen mit diesen subproletarischen,
freizügigen, von Hartz IV ausgeschlossenen ‚EU-Ausländer*innen‘ umgehen? Diese Frage wurde heiß umkämpft. Auf der einen Seite stand
die pauschale Kategorisierung der Menschen, die in München leben, als
Münchner*innen – wie es EU-Migrant*innen und die Initiative Zivilcourage forderten. Dies kann auch als Forderung nach einer postnationalen urban citizenship (vgl. Bauböck, 2003; Lebuhn, 2013) gelesen werden.
Auf der anderen Seite stand die rassistische Skandalisierung der ‚Tagelöhner‘ als Fremdkörper, als Bedrohung für ein „humanes und zivilisiertes Leben und Arbeitsumfeld“, wie es die Petition von Geschäftsleuten
im Bahnhofsviertel im August 2013 ausdrückte. Rassismus und Nationalprotektionismus artikulierten sich auch in den staatlichen Institutionen, sei es bei den street level bureaucrats oder in höheren Rängen.
In diese Richtung ging spätestens ab dem Jahr 2013 (nach dem Wegfall
der Einschränkungen der Freizügigkeit für rumänische und bulgarische
Arbeitnehmer*innen) auch der mediale Diskurs im Zuge der lokal wie
auch bundesweit Wellen schlagenden ‚Armutszuwanderungsdebatte’.
Das im siebten Kapitel analysierte Städtetagspapier (Deutscher Städtetag, 2013) hatte diese Debatte mit losgetreten. Die genannten Diskursbeiträge betrachteten EU-Migration als Bedrohung für den sogenannten
‚sozialen Frieden‘ in der BRD bzw. den Städten und rassifizierten und
versicherheitlichten in diesem Zuge soziale Ungleichheiten. Ganz offene Formen des antimigrantischen und antiziganistischen Rassismus
verschränkten sich dabei in einer Assemblage des Rassismus (wie sie
auch anhand des medialen Diskurs zum ‚Tagelöhnermarkt‘ im vierten
Kapitel analysiert wird), mit postliberalen Spielarten des Rassismus,
die scheinbar liberale und vernünftige Argumente und eine universelle, selektierende und individualisierende Rationalität einbrachten, die
313
�Vielfalt affirmierte, aber zwischen guten und schlechten Migrant*innen
unterschied. Hier verschmolzen rassistische und klassistische Zuschreibungen zur Figur der ‚Armutszuwanderung‘, die der ‚arbeitenden Bevölkerung‘ und den ‚Steuerzahlern‘ aber auch ‚unseren Obdachlosen‘
gegenübergestellt wurde. Diese diskursiven Formationen artikulierten
sich in spezifischen Ein- und Ausschlüssen, die wiederum Lebensrealitäten (ko-)produzierten, in denen sich Rassismus und Klassenverhältnisse untrennbar miteinander verschränkten.
Konkret konnte ich diese Dynamiken auf der kommunalen Ebene
beobachten. Auch im städtischen Regime wurde nach und nach die
Überzeugung hegemonial, dass es sich bei den neuen urbanen Entwicklungen um das Problem der ‚Armutszuwanderung‘ handelte. Die
hegemoniale Problematisierung folgte weder dem pauschalen Einschluss, noch dem pauschalen Ausschluss, sondern fragte vielmehr:
Wer gehört zur Münchner Bürgerschaft? Welche Bedingungen müssen
Migrant*innen erfüllen, um dazuzugehören? Wie mit den unerwünschten ‚Zuwander*innen‘ umgehen, nun da die migrationspolitische Technologie der Außengrenzen (zumindest für Unionsbürger*innen) weggefallen war und da die Menschen das Recht hatten, auf dem Gehweg
zu stehen, und eigentlich auch das Recht, bei Obdachlosigkeit in einer
Notunterkunft untergebracht zu werden?
Anhand der politics of security am ‚Tagelöhnermarkt‘ (Kapitel 5) und insbesondere der Münchner Wohnungslosenpolitik (Kapitel 6) konnte ich
herausarbeiten, wie umstritten diese Fragen waren. Das Patchwork der
verschiedenen Ansätze, Akteure, Institutionen, Argumentationen und
Problematisierungen veränderte sich in kontingenten Aushandlungsprozessen immer wieder. Es folgte dabei keiner einzelnen Logik, insgesamt
haben sich aber doch zwei ineinander verschränkte Selektionsmechanismen sedimentiert: Zum einen die nationalstaatlichen Grenzziehungen (es gab eine extra Dienstanweisung für Unionsbürger*innen); zum
anderen wurde zwischen Menschen ‚mit Perspektive‘ und jenen ‚ohne
Perspektive‘ unterschieden. Jene Personen, die keine Münchner*innen
sein und „keine Perspektive“ in München haben sollten, wurden gänzlich ausgeschlossen, beziehungsweise in einer humanitären Geste durch
das Kälteschutzprogramm im Winter vor dem Erfrieren geschützt. Diese Prozesse gingen Hand in Hand mit der Transformation des nationalsozialen Wohlfahrtsstaates, dessen Aufgabe zunächst die Absicherung
eines gesellschaftlichen sozialen Mindeststandards (für Bürger*innen)
314
�gewesen war, der sich nun aber zu den Sozialtechnologien des workfare
hin veränderte, die die Individuen in ihren Potenzialen aktivieren sollten. ‚Integrationshilfen‘ für Menschen, die ‚keine Perspektive haben‘,
machen in dieser Logik des Aktivierungsimperativs keinen Sinn.
Eine solche multiple, flexible Grenzziehung zeichnete sich auch in den
Aushandlungen am EuGH ab (Kapitel 6). Auch hier konnte ich mit einem Fokus auf die Brüche und Komplexität dieser Prozesse zeigen,
dass diese Entwicklung nicht von vornherein feststand. So setzte sich
zwischenzeitlich der Standpunkt durch, dass auch nichterwerbstätige
Unionsbürger*innen unter Umständen Anspruch auf soziale Leistungen
haben können; somit wurde die Marktbürgerschaft (Bürgerschaftsrechte
und Freizügigkeit nur für Erwerbstätige und Vermögende) hin zu einer
sozialeren Unionsbürgerschaft reformiert. Die neue Grenzziehung gab
die Logik des Marktes aber letztlich nicht auf, sondern verfeinerte sie,
indem sie nur denjenigen einen Anspruch einräumte, die erwerbsfähig
waren bzw. eine ‚tatsächliche Verbindung zum Arbeitsmarkt‘ nachweisen konnten (wobei es auch zu Entscheidungen für soziale Leistungen für
Personen kam, die diese Konditionen nicht erfüllten). Dies stellte einen
Kompromiss zwischen dem Nationalprotektionismus und der sozialen
Union/Europäisierung auf dem Feld der Verhältnismäßigkeitsprüfung
dar, der Rechte nicht grundlegend gewährte, sondern an Bedingungen
knüpfte. Mit dem Erstarken der nationalprotektionistischen Bewegungen und der rassistischen Skandalisierung von ‚Armutszuwanderung‘
um das Jahr 2013 herum änderten sich die Kräfteverhältnisse wiederum
und die Europäisierungsansätze des Sozialrechts wurde zumindest im
Fall von Hartz IV zurückgedreht (Rechtsachen Dano und Alimanovic),
indem der deutschen Ausschlussklausel (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II)
Recht gegeben wurde.
Anhand von Konflikten und Interviews mit Akteuren der Jobcenter
und der Ausländerbehörde in München konnte ich in einem weiteren
Aushandlungsfeld des fragmentierten, multiskalaren Regimes der EUinternen Migration darstellen, wie die wechselseitige Beziehung zwischen Freizügigkeit und Sozialrecht produktiv wurde (Kapitel 7). Auch
das Jobcenter und die Ausländerbehörde gingen kreativ mit dem Widerspruch von Freizügigkeit und Nationalprotektionismus um: das Jobcenter wurde zur Grenzbehörde und die Ausländerbehörde zur Aktivierungsinstanz, wie an der Androhung der Abschiebung deutlich wurde,
die nach Aussage des stellvertretenden Leiters der Ausländerbehörde
315
�als „Initialzündung zur gelungenen Integration“ gedacht war. Die „Migrationssteuerung wird […] immer mehr von den Ausländerbehörden an
die Sozialleistungsträger ausgelagert“, so auch der Experte für die sozialrechtliche Situation von Unionsbürger*innen in Deutschland Claudius Voigt (2016): „die Verweigerung des Zugangs zum Existenzminimum
ersetzt in Deutschland die Grenzkontrollen und wird zugleich zu einem
zentralen Instrument der Verhaltenskontrolle“.
Die in diesem Zusammenhang entstehenden Technologien des Regierens können mit Isabel Lorey (2012) als gouvernementale Prekarisierung
analysiert werden, die die Aktivierung der Individuen zum Ziel hat und
sowohl mit der Herabsetzung sozialer Absicherung wie auch mit der
„Kategorisierung von ‚Überflüssigen‘“ (Lorey, 2012: 94) einhergeht. Die
Überflüssigen - die „bad diversity“ im Sinne von Alana Lentin und Gavin
Titley (2011) - werden zum Objekt von Abschreckungs- und Ausschlussmaßnahmen, wenn der Münchner Stadtrat explizit „unnötige Anreizeffekte“ (Stelle für interkulturelle Arbeit, 2014: 40) vermeiden will, die
Bundesregierung „Anreize für Migration in die sozialen Sicherungssysteme“ (CDU, CSU & SPD, 2013: 108) verringern möchte und die Sozialbehörden ihre Aufgabe darin sehen, das Aufenthaltsgesetz durchzusetzen
(vgl. Kapitel 5 und 7).
In entscheidenden Punkten geht das Regime der EU-internen Migration über das Moment der liberalen Marktorientierung und der Potenzialorientierung hinaus. Kennzeichnend dafür war die Entstehung der
Figuren des ‚Sozialtourismus‘ und der ‚Armutszuwanderung‘, mit denen die neuen Entwicklungen in der urbanen Gesellschaft migrantisiert
und versicherheitlicht wurden. Diese Diskurse folgten einer Assemblage an rassistischen Rationalitäten und forderten autoritäre Antworten
auf die Krise. Die Figur der Bedrohung und die Versicherheitlichung
der EU-internen Migration machten es möglich, nicht die Probleme der
EU-Migrant*innen in München, sondern die ‚Armutszuwanderung‘ als
Problem zu betrachten und auch nicht von einer Krise des Kapitalismus
und dem Problem der sozialen Ungleichheit zu sprechen, sondern von
einer Krise der staatlichen Souveränität, des sozialen Friedens und der
nationalen Sozialsysteme, die durch die ‚Armutszuwanderung‘ als unerwünschter Nebeneffekt der Europäisierung ausgelöst würde. Die Krise
selbst wurde zum Modus des Regierens, der autoritäre und austeritäre
Maßnahmen zum Schutze der Sicherheit legitimierte.
316
�Nach Ende des Untersuchungszeitraums sollte es nicht besser werden:
Ende Dezember 2016 schloss die Bundesregierung arbeitssuchende
(EU-)Ausländer*innen entgegen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht nur von der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Leistungen nach SGB II) sondern auch von Sozialhilfe (Leistungen nach
SGB XII) aus.193 Dieses sogenannte Unionsbürgerausschlussgesetz unterscheidet zwischen dem sogenannten ‚materiellen‘ und dem ‚formalen‘ Freizügigkeitsrecht: Ohne dass die Ausländerbehörden die Freizügigkeit formal aberkannt haben, können die Sozialbehörden schon den
‚materiellen‘ Aufenthalt entziehen. Es wurde also eine rechtliche Zone
geschaffen, in der aufenthaltsberechtigte Personen keinen Anspruch auf
ein Existenzminimum haben. Diese Regelung steht im Widerspruch zu
den grundlegenden Prinzipien des Sozialstaats bzw. dem Anspruch auf
ein Existenzminimum (vgl. Riedner 2017). Durch das „sozialrechtlich
normierte Aushungern wirtschaftlich unproduktiver EU-Bürger“ (Voigt,
2016) – durch den Ausschluss der postliberal Bedrohlichen, der ‚nichterwerbsfähigen Ausländer*innen‘, der ‚Armutszuwander*innen ohne
Perspektive‘ – wird soziale Ungleichheit perpetuiert und (relativ) entrechtete Zonen in der Gesellschaft produziert, in denen Prekarisierung
existenzielle Not bedeutet und der Zwang zur Arbeit maximiert wird.
Meine Forschung hat aber nicht nur gezeigt, wie neue Versuche des
Regierens in erratischen Prozessen ausgehandelt wurden, sondern auch,
dass die Autonomie der Migration, die hartnäckigen widerständigen
Praktiken der migrantischen Arbeiter*innen eine treibende Kraft in diesen Aushandlungen waren. Die EU-Migrant*innen kamen und blieben
trotz Versuchen der Abschreckung. Die Menschen am selbstorganisierten Arbeitsmarkt ließen sich nicht vertreiben. Diese Antagonismen
zwischen den multiplen Grenzziehungen, Regierungs- und Ausbeutungstechnologien und den Praktiken der Migrant*innen artikulierten
sich in Verhältnissen der differenzierten Inklusion und der Multiplikation von Arbeit (Mezzadra & Neilson, 2014) – in einer stratifizierten,
vielfältigen Gesellschaft, in der Bürger*innen und Migrant*innen auf
193
Mit dem ‚Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch‘
hat die Bundesregierung alle Unionsbürger*innen mit einem Aufenthaltsrecht
allein zur Arbeitssuche oder ohne materielles Aufenthaltsrecht von Leistungen
nach SGB II und XII ausgeschlossen.
317
�unterschiedliche Arten und Weisen in den Zwang zur (Lohn-)Arbeit,
Prekarisierung und weitere Machtverhältnisse verstrickt sind.
Während ich diese Schlussworte in ihrer ersten Version schrieb, hatten
sich die Wähler*innen im Vereinigten Königreich in einem Referendum
(23.06.2016) mit knappen 52 Prozent für den sogenannten Brexit, den
Austritt Großbritanniens aus der EU, ausgesprochen. Bis heute (Mai
2018) blieben die Auseinandersetzungen zum Brexit vom Thema (EU-)
Migration geprägt. Rechte Kräfte schürten den Rassismus gegen EUMigrant*innen und auch gegen (Flucht-)Migrant*innen von außerhalb
der EU, indem sie Migration in einem diffusen Bedrohungsszenario für
die sozialen Missstände verantwortlich machten. Auch wenn Einwände
gegen den brachialen Rassismus laut wurden, herrschte (ähnlich wie
in der deutschen Armutszuwanderungsdebatte 2013) weitestgehend
Konsens, dass Migration unter den Gesichtspunkten der ökonomischen
Nützlichkeit zu betrachten und zu bewerten sei und dass unregulierte Migration den Sozialstaat bedroht.194 In den Verhandlungen zu den
Konditionen eines potenziellen Verbleibs in der EU (2015-2016) forderte
der britische Premier, der für die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens zu
bestimmten Konditionen warb, den Zugang von Unionsbürger*innen zu
sozialen Leistungen im Vereinigten Königreich zu erschweren. Auch einige Linke sprachen sich unter dem Schlagwort Lexit für einen Austritt
aus der EU aus. Sie begründeten ihre Ablehnung des EU-europäischen
Projektes u.a. damit, dass die EU auf der Ausbeutung ihrer Peripherien
beruht, austeritäre Politik durchsetzt, die europäische Identität nach außen abgrenzt, das Recht auf Asyl faktisch abschafft und das Sterben an
den Außengrenzen verursacht. Gleichzeitig sprachen sich Stimmen aus
dem Lexit-Lager für eine Rückkehr zum national-sozialen Staat aus, der
Arbeitsrechte und einen Anteil am erwirtschafteten Mehrwert durch
soziale Absicherung und relativ hohe Löhne garantiere – und seine
Grenzen schütze. Heute, fast zwei Jahre später (Mai 2018), nimmt die
Frage, wie eine britische Migrationspolitik gegenüber EU-Bürger*innen
zu gestalten sei, immer noch eine zentrale Stelle in den Austrittsverhandlungen sowie in den nationalen Wahlkampagnen ein. Dabei fordert nicht nur die Rechte eine restriktive Migrationspolitik. Auch auf
194
Ich möchte Veit Schwab dafür danken, dass er einen früheren Entwurf
der vorliegenden Überlegungen zum Brexit/Lexit gelesen und kommentiert hat.
Insbesondere die Beobachtungen eines nützlichkeitsrassistischen Konsens und
des diffusen Bedrohungsszenarios gehen auf seine Kommentare zurück.
318
�Seiten der Linken werden nationalprotektionistische Positionen vertreten. Nach Meinung des Parteivorsitzenden der Labour-Partei, dem Hoffnungsträger vieler britischer Linken, sollte sich eine Migrationspolitik
unter Labour an der Nachfrage der britischen Wirtschaft orientieren
und deshalb Einwanderung beschränken, um Lohndumping zu verhindern:
„What there wouldn‘t be is whole-scale importation of underpaid workers from central Europe in order to destroy conditions, particularly in
the construction industries.“ (Elgot, 2017; vgl. auch Angry Workers of
the World, 2018)
Auch in Deutschland stellt die These, dass Migration die Arbeitsstandards und den Sozialstaat bedroht, sowohl für rechte Kräfte wie auch
für Teile der ‚Linken‘ eine handlungsleitende Maxime dar. Als prägnantes Beispiel kann etwa das Thesenpapier zu einer human und sozial regulierenden linken Einwanderungspolitik einiger prominenter
Vertreter*innen der Partei Die LINKE dienen, die im Frühjahr 2018 für
einen besseren Schutz nationalstaatlicher Grenzen sowie die Regulierung der Einwanderung von Niedrigqualifizierten eintreten und dabei
die Einschränkung der Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit für rumänische und bulgarische EU-Bürger*innen als positives Beispiel heranziehen (Bimboes et al., 2018).
Auf Grundlage der vorliegenden Diskussion des EU-europäischen Migrationsregimes in München bieten sich einige Argumente an, wieso
ein solcher ‚linker‘ Nationalprotektionismus nicht nur politisch gefährlich ist, sondern auch analytisch zu kurz greift. Die Untersuchung der
konkreten Aushandlungen um die EU-Freizügigkeit und den sozialen
Gehalt der Unionsbürgerschaft verweist darauf, welche Fragen gestellt
werden können, um einer Analyse der Widersprüche und Handlungsspielräume in der aktuellen krisenhaften Konjunktur näher zu kommen.
Erstens enthüllt die Perspektive der Migration den methodologischen
und politischen Nationalismus hinter der Forderung nach dem Schutz
des nationalen Wohlfahrtsstaats – für Nicht-Bürger*innen bedeutet der
Nationalstaat Ausschluss und Entrechtung (oder zumindest die Drohung damit). Indem sie den nationalen Bezugsrahmen erweitert, macht
die Perspektive der Migration zudem darauf aufmerksam, wie nationalprotektionistische Projekte globale postkoloniale und kapitalistische
319
�Machtverhältnisse mit durchsetzen – auch innerhalb EU-Europas.
Zweitens wurde deutlich, wie sich neue Versuche des Regierens und
neue gesellschaftliche Verhältnisse sedimentieren, die nicht allein in
der EU oder in einzelnen Staaten zu lokalisieren sind, sondern
in transversalen, transnationalen Verknüpfungen. Nationalprotektionistische Projekte rufen den Nationalstaat tendenziell als
einzige handlungsfähige Schutzmacht gegenüber der EU (oder
wahlweise ‚Globalisierung’) an und blenden weitere politische
Ebenen und Akteure (wie etwa Städte, transnationale Organisationen oder Netzwerke) aus. Hinzu kommt, drittens, dass im
Zuge der Transformation der Sozialsysteme hin zum aktivierenden workfare und der damit einhergehenden Deregulierung der
Arbeitsmärkte die soziale Absicherung auch für diejenigen, die
sich innerhalb des nationalen Kompromisses befinden und von
ihm profitieren, zusehends herabgesetzt wird. Für eine fundierte Kritik des Nationalprotektionismus muss die Analyse vom
national-sozialen Staat, die auf dem fordistischen Klassenkompromiss beruht, aktualisiert werden. Der sozialstaatliche Klassenkompromiss ist zwar in Deutschland noch nicht gänzlich aufgekündigt worden, aber die sozialen Rechte werden doch immer
weiter abgebaut. Die Radikalisierung des Zwangs zur Arbeit, wie
sie gegenüber Unionsbürger*innen bereits durchgesetzt wurde,
erscheint aus dieser Perspektive nicht als Schutzmaßnahme für
soziale und arbeitsrechtliche Standards, sondern als neoliberalautoritäres Projekt, das perspektivisch auch vor anderen Gruppen
nicht Halt macht und die gesellschaftlichen Zonen der Exklusion
und extremen Prekarisierung auch in den ökonomischen Zentren
des globalen Nordens potenziell ausweitet.
Um in den Städten, den einzelnen Mitgliedsstaaten, in der EU,
über sie hinaus und transversal zu ihnen eine linke Bewegung
gegen die rassistischen, nationalistischen und austeritären Kräfte
aufbauen und stärken zu können, gilt es, die aktuelle Konjunktur
genauer zu betrachten – „to analyse ruthlessly what sort of crisis
it is“ (Hall & Massey, 2012: 56) – und in ihrer Komplexität und in
ihren Widersprüchen rassismus- und kapitalismusanalytisch fundiert zu untersuchen. Dazu ist es hilfreich, die soziale Frage in
trans- und postnationalen Zusammenhängen zu stellen sowie die
320
�Migrations- und Grenzforschung in sozialen und kapitalistischen
Verhältnissen zu kontextualisieren.
Eine Forschungspraxis, die sich auf reflektierte Weise in konkreten Konflikten in den umkämpften, transnationalen Regimen positioniert, ermöglicht es, eine solche Perspektive einzunehmen. Diese Arbeit konnte
Verschiebungen und Auseinandersetzungen, Brüche und Öffnungen im
urbanen Regime der EU-internen Migration in München aufzeigen. Sie
weist darauf hin, wie wichtig es ist, aufmerksam nicht nur für reaktionäre Nationalismen zu sein, sondern auch für die Doppelbewegung von
Aktivierung und Ausschluss, die im Kleid einer potenzialorientierten
Inklusionspolitik und mit dem vorgeblichen Ziel, die Sozialstandards
in der vielfältigen Stadtgesellschaft zu schützen, zwischen ‚guten‘ und
‚schlechten‘ Migrant*innen unterscheidet. Im relativ jungen Regime der
EU-internen Migration soll ein Set an aufenthalts- und sozialpolitischen
Instrumenten die ersteren unter den Bedingungen der Arbeitsgesellschaft integrieren und die letzteren mit Zwang zum Arbeiten aktivieren
oder als Personen ‚ohne Perspektive‘ bzw. ‚ohne Aussicht auf Erfolg bei
der Arbeitsuche‘ von gesellschaftlichen Mindeststandards ausschließen.
321
�Literaturverzeichnis
Adam, Jens & Vonderau, Asta (2014): Formationen des Politischen. Bielefeld.
Alberti, Gabriella (2014): Mobility strategies, ‚mobility differentials’
and ‚transnational exit’. The experiences of precarious migrants in
London’s hospitality jobs. In: Work, Employment & Society. 1–17.
Alberti, Gabriella (2017): The government of migration through
workfare in the UK. Towards a shrinking space of mobility and social
rights? In: movements. Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, 3(1).
Alberti, Gabriella & Holgate, Jane & Tapia, Maite (2013): Organising
migrants as workers or as migrant workers? Intersectionality, trade
unions and precarious work. In: The International Journal of Human
Resource Management, 24 (22). 4132–4148.
Althusser, Louis (1968): Widerspruch und Überdeterminierung. In: Althusser, Louis (Hg.): Für Marx. Frankfurt a.M. 52–147.
Althusser, Louis (1977): Ideologie und ideologische Staatsapparate.
Hamburg.
Amt für Soziale Sicherung & Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt München] (2006): Auswirkungen der Änderungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Beschlussvorlage
Nr. 02-08 / V 08799 des Sozialausschusses vom 12.10.2006. Verfügbar
unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/975814.pdf [23.06.2016].
Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2010a): Münchner Gesamtplan II. Soziale Wohnraumversorgung - Wohnungslosenhilfe Paradigmenwechsel „Wohnen statt
Unterbringen“ - Erfahrungsbericht und Fortschreibung des Beschlusses der Vollversammlung vom 08.10.2008. Sitzungsvorlage Nr. 08-14 /
V 03974 vom 04.05.2010. Verfügbar unter: https://www.rismuenchen.
de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2009277.pdf [23.06.2016].
322
�Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2010b): Unterbringung wohnungsloser Haushalte – Meldefrist sechs Monate. Dienstanweisung vom 23.12.2010. München.
Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2011): 100 Jahre Wohnungsamt – 1911 bis 2011. München. Verfügbar unter: http://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/412_
lhm%20wohnungsamt_100_jahre_festschrift.pdf [23.06.2016].
Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2012a): Dienstanweisung zur Schlafplatzvergabe – Handlungsempfehlung Erfrierungsschutz. Dienstanweisung vom 02.02.2012.
München.
Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt München] (2012b): Münchner Gesamtplan II - Soziale
Wohnraumversorgung/Wohnungslosenhilfe
Handlungsprogramm „Wohnen statt Unterbringen“ - Erfahrungsbericht und Fortschreibung. Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 10010 vom 11.10.2012.
Verfügbar unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2771316.pdf [23.06.2016].
Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2012c): Einrichtung und Betrieb eines Kälteschutzraums
für die Kälteperiode; Einrichtung eines ganzjährigen Beratungsdienstes. Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 10525 vom 08.11.2012. Verfügbar unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2812237.pdf [23.06.2016].
Amt für Wohnen und Migration [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2015): Kälteschutzprogramm der Landeshauptstadt München – Evaluation der Kälteperiode 2014/2015. Sitzungsvorlage Nr. 1420 / V 03977 vom 06.10.2015. Verfügbar unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/ 3820965.pdf [23.06.2016].
Anderson, Bridget (2007): Battles in Time: the Relation between Global and Labour Mobilities. COMPAS Working Paper Series, WP07-55. Verfügbar unter: https://www.compas.ox.ac.uk/media/WP2007-055-Anderson_Global_Labour_Mobilities.pdf [20.06.2016].
Andrä erklärt seine Ziele - Rundgang mit Polizeipräsident im Bahnhofsviertel (2013). In: tageszeitung, 26.11.2013. Verfügbar unter:
323
�http://www.tz.de/muenchen/stadt/ludwigsvorstadt-isarvorstadtort43328/muenchen-rundgang-polizeipraesident-andrae-bahnhofsviertel-3216729.html [21.06.2016].
Andrijašević, Rutvica (2007): Das zur Schau gestellte Elend. Gender,
Migration und Repräsentation in Kampagnen gegen Menschenhandel. In: TRANSIT MIGRATION Forschungsgruppe (Hg.): Turbulente
Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas.
Bielefeld. 121–140.
Angry Workers of the World (2018): Migration und nationale Sozialdemokratie in Großbritannien. In: Wildcat, 101.
Anlauf, Thomas (2017): Obdachloser klagt Recht auf Unterkunft ein. In:
sueddeutsche.de, 22.08.2017. Verfügbar unten: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/urteil-obdachloser-klagt-recht-auf-unterkunftein-1.3635486 [14.04.2018].
Apostolova, Raia (2013): Green wristbands. Verfügbar unter: http://
www.criticatac.ro/lefteast/green-wristbands/ [21.06.2016].
Apostolova, Raia (2014): The German Greens. Or how they learned
to stop worrying and game the ‚poverty migrants’. In: Lefteast. Verfügbar unter: http://www.criticatac.ro/lefteast/the-german-greensor-how-they-learned-to-stop-worrying-and-game-the-poverty-migrants/ [23.06.2016].
Apostolova, Raia (2015). Economic vs. political: Violent abstractions in Europe’s refugee crisis. 9.3.2016. Verfügbar unten: www.
focaalblog.com/2015/12/10/raia-apostolova-economic-vs-politicalviolent-abstractions-in-europes-refugee-crisis#sthash.Wzbtrngj.dpuf
[20.06.2016].
Ärger um Tagelöhner - Petition gegen „Arbeiterstrich“ (2013). [Radiobeitrag]. In: BR.de, 27.08.2013.
arranca!-Redaktion (2008): Militante Untersuchungen. Arranca! #39.
Verfügbar unter: http://arranca.org/ausgabe/39 [2.2.2013].
Asyl in Deutschland? „Alle hassen die Zigeuner“ (1990). In: Der Spiegel, 36, 3.9.1990. S. 34–37. Verfügbar unter: http://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-13500312.html [24.06.2016].
324
�Auf dem Arbeiterstrich (2011). Radiobeitrag. In: Deutschlandfunk,
29.06.201.
Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft (2015): Beschlussseite zu TOP
3. Verfügbar unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/
TOP/3652097.pdf. [30.08.2017].
Bacher, Marion (2010): Lohn und Leid. In: Süddeutsche Zeitung,
24.08.2010, München City. R5.
Bachner, Andreas (2013): Hier gibt’s Ärger mit der Tagelöhner-Mafia Aufstand gegen Schwarz-Arbeiter. In: Bild, 26.08.2013.
Bahl, Eva & Ginal, Marina (2009): Von Opfern, Tätern und
Helfer(inne)n - Diskurse um „Menschenhandel“ und ihre Bedeutung für die Regulierung feminisierter Migration. Unveröffentlichte
Magisterarbeit.
Ludwig-Maximilians-Universität
München.
Bahl, Eva; Ginal, Marina & Hess, Sabine (2010): Unheimliche Arbeitsbündnisse. Zum Funktionieren des Anti-Trafficking-Diskurses auf
lokaler und europäischer Ebene. In: Hess, Sabine & Kasparek, Bernd
(Hg.): Grenzregime. Diskurse/Praktiken/Institutionen in Europa. Bielefeld. 161–178.
Balestrini, Nanni & Moroni, Primo (2002): Die goldene Horde: Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien. Berlin.
Balibar, Étienne (1998): Der „Klassen-Rassismus“. In: Balibar,
Étienne
&
Wallerstein,
Immanuel
(Hg.):
Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten. Hamburg.
S. 247–260.
Balibar, Étienne (2003): Sind wir Bürger Europas? Politische Integration, soziale Ausgrenzung und die Zukunft des Nationalen. Hamburg.
Balibar, Étienne (2008): Die Rückkehr des Konzepts „Rasse“. Zur Umwandlung der Wahnvorstellungen von Rasse und Rassismus durch die
Neuschaffung eines „Intimfeindes“ – häufig unter dem Deckmantel
des Universalismus. In: Springerin, 3 (8). 18–24.
Balibar, Étienne (2010): Kommunismus und (Staats-)Bürgerschaft. In:
Demirović, Alex; Adolphs, Stephan & Karakayalı, Serhat (Hg.): Das
325
�Staatsverständnis von Nicos Poulantzas. Der Staat als gesellschaftliches Verhältnis. Baden-Baden. 19–34.
Balibar, Étienne & Wallerstein, Immanuel (2014): Rasse, Klasse, Nation: Ambivalente Identitäten. Hamburg/Berlin.
Barnard, Catherine (2005): Case C-209/03. In: Common Market Law
Review, 42 (5).S. 1465–1489.
Bartley, Tim & Roberts, Wade (2006): Relational exploitation: The informal organization of day labor agencies. In: WorkingUSA, 9 (1). 41–58.
Bauböck, Rainer (2003): Reinventing urban citizenship. In: Citizenship
studies, 7 (2).S. 139–160.
Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr
(2013). Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Christine Kamm und
Katharina Schulze vom 23.10.2013 betreffend Kennzeichnung von Personen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Antwortschreiben
vom 15.12.2013. Verfügbar unten: www.gruene-fraktion-bayern.de/
sites/default/files/17_0000334.pdf [23.06.2016].
Benz, Martina (2014): Zwischen Migration und Arbeit: Worker Centers
und die Organisierung prekär und informell Beschäftigter in den USA.
Münster.
Beck, Ulrich & Grande, Edgar (2004): Das kosmopolitische Europa.
Frankfurt a.M.
Bigo, Didier (o.J.): Security and anthropology: Encounters, Misunderstanding and Possible Collaborations. Verfügbar unten: https://www.
academia.edu/10122296/Security_and_anthropology_Encounters_Misunderstanding_and_Possible_Collaborations [21.06.2016].
Bigo, Didier (2002): Security and Immigration: Towards a Critique of
the Governmentality of Unease. In: Alternatives: Global, Local, Political, 27 (1). 63–92.
Bigo, Didier (2008): Globalized (In)Security: The field and the Ban-Opticon. In: Bigo, Didier & Tsoukala, Anastassia (Hg.): Terror, Insecurity
and Liberty. Illiberal Practices of Liberal Regimes after 9/11. Abingdon. 10–48.
Bimboes, Detlef; Braun, Constantin; De Masi, Fabio; Fauser, Hannes;
Grünberg, Harri; Heidorn, Malte; Horn, Florian; King, Alexander,
326
�Krämer, Ralf; Krellmann, Jutta; Krüger, Lydia; Leutert, Michael;
Lhommeau, Lev; Marose, Jan; Scholemann, Kaspar; Thie, Hans; Veressov, Roman; Zimmermann, Sabine: Thesenpapier zu einer human
und sozial regulierenden linken Einwanderungspolitik. Verfügbar unter: https://www.die-linke.de/fileadmin/download/debatte/einwanderungsgesetz/2018-05-03_thesenpapier_linke_einwanderungspolitik.
pdf [09.05.2018].
Binder, Beate; Bose, Friedrich von; Ebell, Katrin; Hess, Sabine &
Keinz, Anika (2013): Eingreifen, Kritisieren, Verändern!?: Interventionen ethnographisch und gendertheoretisch. Münster.
Birkner, Martin & Mennel, Birgit (2006): Mayday! Oder: Die unmögliche Organisierung der möglicherweise Unorganisierbaren – eine
Zwischenbilanz mit Ausblick. In: kulturrisse. Zeitschrift für radikaldemokratische Kulturpolitik, 04. Verfügbar unter: http://kulturrisse.
at/ausgaben/042006/oppositionen/mayday-oder-die-unmoegliche-organisierung-der-moeglicherweise-unorganisierbaren-eine-zwischenbilanz-mit-ausblick [21.06.2016].
Bojadžijev, Manuela (2008): Die windige Internationale. Rassismus und
Kämpfe der Migration. Münster.
Bojadžijev, Manuela & Karakayalı, Serhat (2007): Autonomie der Migration. 10 Thesen zu einer Methode. In: TRANSIT MIGRATION Forschungsgruppe (Hg.): Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas. Bielefeld. 203–209.
Bojadžijev, Manuela; Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis (2003):
Das Rätsel der Ankunft. Von Lagern und Gespenstern. In: kurswechsel, 3. 39–52.
Bojadžijev, Manuela & Ronneberger, Klaus (2001): Gleich in die Ungleichheit. Integration in Deutschland. In: blätter des iz3w, 253. 19–21.
Bouali, Celia (2018): Facing Precarious Rights and Resisting EU ‚Migration Management’: South European Migrant Struggles in Berlin. In:
Social Inclusion, 6 (1). 166–175.
Böröcz, József (2001): Introduction: Empire and coloniality in the ‘Eastern Enlargement’ of the European Union. In: Kovács, Melinda &
Böröcz, József (Hg.): Empire’s new clothes. Unveiling EU enlargement:
327
�Central Europe Review. Verfügbar unter: http://aei.pitt.edu/144/1/Empire.pdf [23.06.2016].
Brinkmann, Ulrich; Dörre, Klaus; Röbenack, Silke; Kraemer, Klaus &
Speidel, Frederic (2006): Prekäre Arbeit: Ursachen, Ausmaß, soziale Folgen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer Beschäftigungsverhältnisse. Bonn.
Brenner, Neil (1997): Globalisierung und Reterritorialisierung. Städte,
Staaten und die Politik der räumlichen Redimensionierung im heutigen Europa. In: WeltTrends, 17. 7–29.
Bröckling, Ulrich (2013): Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer
Subjektivierungsform. Berlin.
Bröckling, Ulrich; Krasmann, Susanne & Lemke, Thomas (2000): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt a.M.
Buckel, Sonja (2013): „Welcome to Europe“ – Die Grenzen des europäischen Migrationsrechts. Bielefeld.
Bundesministerium des Inneren; Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (2014): Zwischenbericht des Staatssekretärsausschusses zu
„Rechtsfragen und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme
der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten“ vom 26.3.2014. Verfügbar unter: http://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/abschlussberichtarmutsmigration.pdf;jsessionid=2A1E1722670FC931198651085035
BA75.2_cid287?__blob=publicationFile [23.06.2016].
Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2014): Änderungsantrag vom 05.11.2014. Drucksache 18/3079. Verfügbar unter: http://
dip.bundestag.de/btd/18/030/1803079.pdf [23.06.2016].
Bundestagsfraktion DIE LINKE (2014): Entschließungsantrag vom
05.11.2014. Drucksache 18/3080. Verfügbar unten: http://dip.bundestag.de/btd/18/030/1803080.pdf [23.06.2016].
Burawoy, Michael (1983): Between the labor process and the state: The
changing face of factory regimes under advanced capitalism. In: American sociological review, 48 (5). 587–605.
328
�Burawoy, Michael (2000): Global ethnography: forces, connections, and
imaginations in a postmodern world. Berkeley/Los Angeles/London.
Butler, Judith (2006): Precarious life: the powers of mourning and violence. London/New York.
Butler, Judith (2010): Performative Agency. In: Journal of Cultural Economy, 3 (2)S. 147–161.
Calderon, José; Foster, Suzanne & Rodriguez, Silvia (2003). Organizing immigrant workers: Action research and strategies in the Pomona Day Labor Center. Paper presented at the annual meeting of the
American Sociological Association, Atlanta, GA.
Camou, Michelle (2009): Synchronizing Meanings and Other Day Laborer Organizing Strategies Lessons from Denver. In: Labor Studies
Journal, 34 (1). 39–64.
Caritas; Malteser & Männerfürsorge (2012): Die Koffer sind schon
gepackt – Viele Bulgaren streben nach München. Informationsreise
nach Bulgarien 01.09.-09.09.2012. München. Verfügbar unter: http://
www.malteser-muenchen.de/fileadmin/Files_sites/Regionen/BT/Muenchen_und_Freising/Muenchen/Dienste/MMM/Reisebericht_Bulgarien_2012_Gesamt.pdf [25.06.2016].
Carstensen, Lisa; Heimeshoff, Lisa-Marie; Riedner, Lisa (i.E.). Der
Zwang zur Arbeit. Verwertungslogiken in den umkämpften Regimen
der Anwerbe-, Flucht- und EU-Migration. In: Sozial.Geschichte Online. Im Erscheinen.
C.A.S.E. Collective (2006): Critical approaches to security in Europe: A
networked manifesto. In: Security Dialogue, 37 (4). 443–487.
Casas-Cortés, Maribel (2014): A genealogy of precarity. A toolbox for
rearticulating fragmented social realities in and out of the workplace.
In: Rethinking Marxism, 26 (2). 206–226.
Casas-Cortés, María Isabel (2009). Social movements as sites of
knowledge production: Precarious work, the fate of care and activist research in a globalizing Spain. Doctor of Philosophy, University of North Carolina at Chapel Hill: Chapel Hill. Verfügbar unter:
https://www.researchgate.net/profile/Maribel_Casas-Cortes/publication/266259719_Social_Movements_as_Sites_of_Knowledge_Pro-
329
�duction_Precarious_Work_the_Fate_of_Care_and_Activist_Research_in_a_Globalizing_Spain/links/542af7470cf29bbc126a7c0f.pdf
[23.06.2016].
Casas-Cortés, Maribel; Cobarrubias, Sebastian; De Genova, Nicholas;
Garelli, Glenda; Grappi, Giorgio; Heller, Charles; Hess, Sabine; Kasparek, Bernd; Mezzadra, Sandro; Neilson, Brett; Peano, Irene; Pezzani, Lorenzo; Pickles, John; Rahola, Federico; Riedner, Lisa; Scheel,
Stephan & Tazzioli, Martina (2014): New Keywords: Migration and
Borders. In: Cultural Studies, 29 (1). 55–87.
Castel, Robert (2000): Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine
Chronik der Lohnarbeit. Konstanz.
Castel, Robert & Dörre, Klaus (2009): Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung: Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frankfurt
a.M./New York.
Castel, Robert (2009): Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale
Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frankfurt a.M.
CDU, CSU & SPD (2013): Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag. Berlin. Verfügbar unter: https://www.bundesregierung.
de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__
blob=publicationFile&v=2 [23.06.2016].
Clifford, James & Marcus, George E. (Hg.) (1986): Writing Culture. The
Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley/Los Angeles/London.
Clarke, John (2012): What crisis is this? In: Rutherford, Jonathan & Davison, Sally (Hg.): (Soundings on) The Neoliberal Crisis. 44–54.
Cohen, Stanley (1972): Moral panics and folk devils. London.
Combahee River Collective (1982): The Combahee River Collective
Statement. In: Hull, Gloria T., Scott, Patricia Bell & Smith, Barbara
(Hg.): But Some of Us Are Brave. Old Westbury/New York. 13–22.
Costanzo, David (2013a): Aufstand gegen den Arbeiter-Strich! In: tageszeitung, 28.08.2013.
Costanzo, David (2013b): Zoll verschärft seine Kontrollen – Kameras
und Polizei gegen Arbeiterstrich. In: tageszeitung, 31.08.2013.
330
�Damian, Chalmers; Hadjiemmanuil, Christos; Monti, Giorgio & Tomkins, Adam (2006): European Union Law. Text and Materials. Cambridge.
David, Matthew; Rohloff, Amanda; Petley, Julian & Hughes, Jason
(2011): The idea of moral panic – ten dimensions of dispute. In: Crime,
Media, Culture, 7 (3). S. 215–228.
Davis, Angela (1981): Women, Race and Class. New York.
Davis, Mike (2007): Planet der Slums. Berlin/Hamburg.
Deggerich, Markus (2006): „Wie ein Stück Fleisch“. In: Der Spiegel, 52,
22.12.2006. S. 32–33. Verfügbar unter: http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-49976909.html [21.06.2016].
Deleuze, Gilles (1992): Postscript on the Societies of Control. In: October, 59. 3–7.
Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (1997): Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie. Berlin.
Deneva, Neda (2014): Conflicting Meanings and Practices of Work. Bulgarian Roma as Citizens and Migrants. In: Apostolova, Raia, Deneva,
Neda & Hristova, Tsvetelina (Hg.): Situating Migration in Transition.
Temporal, Structural, and Conceptual Transformations of Migrations.
Sketches from Bulgaria. Sofia. 42–70.
Deutscher Bundestag (2014a): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer aufenthaltsrechtlicher
Vorschriften. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 22.09.2014.
Drucksache 18/2581. Verfügbar unter: http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/18/025/1802581.pdf [23.06.2016].
Deutscher Bundestag (2014b): Streit um Vorgehen gegen Freizügigkeitsmissbrauch. Videoaufzeichnung der Sachverständigen-Anhörung
des Innenausschusses vom 13.10.2014. Verfügbar unter: http://www.
bundestag.de/blueprint/servlet/page/bt/dokumente/textarchiv/2014/
kw42_pa_innen/332826?view=DEFAULT [23.06.2016].
Deutscher Städtetag (2013b): Positionspapier des Deutschen Städtetages zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien.
22.01.2013. Berlin. Verfügbar unter: http://www.staedtetag.de/impe-
331
�ria/md/content/dst/internet/fachinformationen/2013/positionspapier_zuwanderung_2013.pdf [26.06.2016].
Die dunkle Seite Deutschlands (2010). In: BR Abendschau, 13.10.2010.
[Fernsehbeitrag]. Verfügbar unter: http://www.br-online.de/
bayerisches-fernsehen/abendschau/tageloehner-bulgaren-eiseleID1286973996495.xml [02.02.2011].
Die Grünen – Rosa Liste Stadtratsfraktion (2017): Prekäre Tagelöhnersituation im Südlichen Bahnhofsviertel endlich auflösen! Antrag im
Münchner Stadtrat. Sitzungsvorlage Nr. 14–20 / A 03010. Verfügbar
unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/4432475.
pdf [01.09.2017].
Dickinson, Maggie (2016): Working for food stamps. Economic citizenship and the post-Fordist welfare state in New York City. In: American
Ethnologist, 43 (2). S. 270–281.
Dietze, Gabriele (2009): Okzidentalismuskritik. Möglichkeiten und
Grenzen einer Forschungsperspektivierung. In: Dietze, Gabriele,
Brunner, Claudia & Wenzel, Edith (Hg.): Kritik des Okzidentalismus.
Transdisziplinäre Beiträge zu (Neo-)Orientalismus und Geschlecht.
Bielefeld. 23–55.
Dietze, Gabriele; Brunner, Claudia & Wenzel, Edith (2010): Kritik des
Okzidentalismus. Transdisziplinäre Beiträge zu (Neo-)Orientalismus
und Geschlecht. Bielefeld.
Ege, Moritz (2015a): Email an Lisa Riedner vom 4.12.2015.
Ege, Moritz (2015b): Policing the Crisis. Zum Verhältnis von Europäischer Ethnologie und Cultural Studies. In: Götz, Irene; Moser, Johannes; Ege, Moritz & Lauterbach, Burkhart (Hg.) Europäische Ethnologie in München. Ein kulturwissenschaftlicher Reader. Münster/New
York. 53–86.
Elgot, Jessica (2017): Labour would leave single market, says Jeremy
Corbyn. The Guardian, 23.07.2017. Verfügbar unten: https://www.
theguardian.com/politics/2017/jul/23/labour-would-leave-single-market-jeremy-corbyn [09.05.2018].
End, Markus (2014): Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit.
Heidelberg.
332
�End, Markus & Grunau, Andrea (2014): Interview – „Antiziganismus prägt Zuwanderungsdebatte“. Deutsche Welle, 11.01.2014. Verfügbar unter: http://www.dw.com/de/antiziganismus-pr%C3%A4gtzuwanderungsdebatte/a-17354910 [21.06.2016].
Escobar, Arturo (2007): The ‘ontological turn’ in social theory. A commentary on ‘Human geography without scale’, by Sallie Marston, John
Paul Jones II and Keith Woodward. In: Transactions of the Institute of
British Geographers, 32 (1). S. 106–111.
Evans, Tony & Harris (2004): Street-level bureaucracy, social work and
the (exaggerated) death of discretion. In: The British journal of social
work, 34 (6). 871–895.
Eversberg, Dennis (2015): Beyond individualisation: The German ‘activation toolbox’. In: Critical Social Policy, 36 (2). 167–186.
Fachbereich Europa; Deutscher Bundestag (2014): Fragen zur Reform
des Freizügigkeitsgesetzes/EU. Ausarbeitung PE 6 - 3000 – 157/14 vom
10.10.204. Verfügbar unten: http://www.bundestag.de/blob/407906/045
2d0864854eb77aa96f49bc639c96b/pe-6-157-14-pdf-data.pdf [23.06.2016].
Faist, Thomas & Häußermann, Hartmut (1996): Immigration, social citizenship and housing in Germany. In: International Journal of Urban
and Regional Research, 20 (1). S. 83–98.
Fanon, Frantz (1966): Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt a.M.
Fassin, Didier (2012): Compassion and repression: the moral economy
of immigration policies in France. In: Cultural anthropology, 20 (3).
362–387.
Fassin, Didier (2013): Enforcing order. An ethnography of urban policing. Cambridge/Malden.
FelS (2011): Eine Militante Untersuchung am Jobcenter Neukölln.
Verfügbar: http://fels.nadir.org/de/tag/militante-untersuchung
[06.04.2018].
Freie und Hansestadt Hamburg (2013): Abschlussbericht der BundLänder Arbeitsgemeinschaft „Armutswanderung aus Osteuropa“. 90.
ASMK Protokoll vom 11.10.2013. Hamburg. 140–188.
Foucault, Michel (1983): Der Wille zum Wissen – Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt a.M.
333
�Foucault, Michel (1987): Sexualität und Wahrheit: Erster Band: Der
Wille zum Wissen. Frankfurt a.M.
Foucault, Michel (1992): Was ist Kritik? Berlin.
Foucault, Michel (1999): In Verteidigung der Gesellschaft: Vorlesungen
am Collège de France (1975–76). Frankfurt a.M.
Foucault, Michel (2000): Gouvernementalität der Gegenwart. Studien
zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt a.M.
Foucault, Michel (2004): Geschichte der Gouvernementalität, Bd. 1: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am Collège de France
1977–1978. Frankfurt a.M.
Fox Piven, Frances (1998): Welfare Reform and the Economic and Cultural Reconstruction of Low Wage Labor Markets. In: City & Society,
10 (1). 21–36.
Frassanitos-Netzwerk (2005): Prekär, Prekarisierung, Prekariat? Bedeutungen, Fallen und Herausforderungen eines komplexen Begriffs, und
was das mit Migration zu tun hat … Verfügbar unten: http://archiv.
labournet.de/diskussion/arbeit/realpolitik/prekaer/frassanito.html
[21.06.2016].
Friedrich, Hans-Peter (2013): „Wir zahlen nicht zweimal“ – Innenminister Friedrich fordert im heute-journal, EU-Einwanderer schneller
auszuweisen, wenn sie die Sozialsysteme missbrauchen. Deutschland
zahle bereits genug EU-Hilfen an Rumänien und Bulgarien. ZDF heute journal. [Filmbeitrag]. Verfügbar unter: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1846034/#/beitrag/video/1846034/FriedrichWir-zahlen-nicht-zweimal [12.05.2013].
Friedrich, Hans-Peter; Teeven, Fred; May, Theresa & Mikl-Leitner,
Johanna (2013): Ohne Titel. Verfügbar unter: http://dpaq.de/aJ68l
[23.06.2016].
Friedrich, Sebastian (2014): Der Geist von Wildbad Kreuth. In: ak – analyse & kritik – Zeitung für linke Debatte und Praxis, 590, 21.1.2014. Verfügbar unter: https://www.akweb.de/ak_s/ak590/35.htm [21.06.2016].
Friedrich, Sebastian & Mohrfeldt, Johanna (2012): Alltägliche Ausnahmefälle. Zu Institutionellem Rassismus bei der Polizei und der Pra-
334
�xis des ‚Racial Profiling‘. In: ZAG – Antirassistische Zeitschrift, 61.
Verfügbar unter: https://www.kop-berlin.de/beitrag/alltagliche-ausnahmefalle-zu-institutionellem-rassismus-bei-der-polizei-und-derpraxis-des-racial-profiling [27.06.2016].
Friedrich, Sebastian & Zimmermann, Jens (2015): Empörung reicht
nicht. In: ak - analyse & kritik - Zeitung für linke Debatte und Praxis, 601, 20.01.2015. Verfügbar unter: https://www.akweb.de/ak_s/
ak601/27.htm [21.06.2016].
Frings, Dorothee (2012): Sozialleistungen für Unionsbürger/innen nach
der VO 883/2004. Flüchtlingsrat Berlin. Verfügbar unter: http://www.
fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/pdf/Frings_Sozialleistungen_883-2004.
pdf [21.06.2016].
Frisch, Max (1965): Überfremdung I. In: Frisch, Max: Gesammelte Werke in Zeitlicher Folge. Bd. V.2. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 374–376.
Fuchs, Florian (2013): Bahnhofsviertel in München – Gefühlte Unsicherheit. In: Sueddeutsche.de, 12.11.2013. Verfügbar unten: http://
www.sueddeutsche.de/muenchen/bahnhofsviertel-in-muenchen-gefuehlte-unsicherheit-1.1817105 [21.06.2016].
Fuchs, Maximilian (2015): Arbeitnehmerfreizügigkeit und Sozialleistungen. In: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht, 3.
95–101.
Garland, David (2008): On the concept of moral panic. In: Crime, Media, Culture, 4 (1). 9–30.
Gather, Claudia; Gerhard, Ute; Schroth, Heidi & Schürmann, Lena
(2005): Vergeben und vergessen? Gebäudereinigung im Spannungsfeld zwischen kommunalen Diensten und Privatisierung. Hamburg.
Gießelmann, Bente (2013): Differenzproduktion und Rassismus: Diskursive Muster und narrative Strategien in Alltagsdiskursen um Zuwanderung am Beispiel Duisburg-Hochfeld. Bachelorarbeit. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Verfügbar unten: http://www.
diss-duisburg.de/wpcontent/uploads/2013/08/Giesselmann-BenteDifferenzproduktion-und-Rassismus-2013.pdf [10.06.2016].
335
�Giroux, Susan Searls & Goldberg, David Theo (2006): On the state of
race theory: a conversation with David Theo Goldberg. In: JAC, 26
(1–2). 11–66.
Glick Schiller, Nina & Caglar, Ayse (2011): Locating Migration. Rescaling Cities and Migrants. Ithaca/London.
Goldberg, David Theo (2002): The racial state. Malden/Oxford.
Goscinny, René; Uderzo, Albert & Watrin, Pierre (1976): Asterix erobert Rom. [Spielfilm].
Götz, Irene (1997): Unternehmenskultur. Die Arbeitswelt einer Großbäckerei aus kulturwissenschaftlicher Sicht. München.
Götz, Irene (2011): Narrative der (Im-)Mobilität: Exploration eines Ideologems europäischer Arbeitswelten. In: Johler, Reinhard; Matter, Max
& Zinn-Thomas, Sabine (Hg.): Mobilitäten. Europa in Bewegung als
Herausforderung kulturanalytischer Forschung. Münster/New York/
München/Berlin. 88–90.
Götz, Irene (2012): Vom Fordismus zum Postfordismus? Arbeitsethnografische Fallstudien als Korrektiv für vereinfachende Dichotomien.
In: kulturen, 6. 4–12.
Götz, Irene; Huber, Birgit & Kleiner, Piritta (2010): Arbeit in neuen
Zeiten: Ethnografien zu Ein- und Aufbrüchen. München.
Götz, Irene; Lehnert, Katrin; Lemberger, Barbara & Schondelmayer,
Sanna (2010): Mobilität und Mobilisierung. Arbeit im sozioökonomischen, politischen und kulturellen Wandel. Frankfurt a.M./New York.
Götz, Irene & Lemberger, Barbara (2009): Prekär arbeiten, prekär leben. Kulturwissenschaftliche Perspektiven auf ein gesellschaftliches
Phänomen. Frankfurt a.M.
Gramsci, Antonio (1991): Gefängnishefte. Hamburg/Berlin.
Greiser, Johannes (2014): Europarechtliche Spielräume des Gesetzgebers bei der Verhinderung sozialleistungsmotivierter Wanderbewegungen. In: ZESAR,01/14. 18–26.
Greyser, Naomi (2012): Academic and activist assemblages: An interview with Jasbir Puar. In: American Quarterly, 64 (4). 841–843.
336
�Grossberg, Lawrence (2007): Haben die Cultural Studies Zukünfte?
Sollten sie mehrere haben? (Oder was ist los mit New York?). In: Winter, Rainer (Hg.): Die Perspektive der Cultural Studies. Der LawrenceGrossberg-Reader. Köln. 134-179.
Grundner, Hubert (2013): Schattendasein. In: Süddeutsche Zeitung,
25.11.2013, München City. R9.
Gupta, Akhil & Ferguson, James (1997a): Anthropological locations:
Boundaries and grounds of a field science. Berkeley/Los Angeles/London.
Gupta, Akhil & Ferguson, James (1997b): Discipline and practice: “The
field” as site, method, and location in anthropology. In: Anthropological locations: Boundaries and grounds of a field science, 100. 1–47.
Hailbronner, Kay (2004): Die Unionsbürgerschaft und das Ende rationaler Jurisprudenz durch den EuGH? In: Neue Juristische Wochenschrift, 57 (31). 2185–2188.
Hale, Charles R (2006): Activist research v. cultural critique: Indigenous
land rights and the contradictions of politically engaged anthropology. In: Cultural Anthropology, 21 (1). 96–120.
Hale, Charles R. (2008): Engaging contradictions: theory, politics, and
methods of activist scholarship. Berkeley/Los Angeles/London.
Hall, Stuart (1994): Der Westen und der Rest: Diskurs und Macht. In:
Hall, Stuart (Hg.): Rassismus und kulturelle Identität. Ausgewählte
Schriften 2. Hamburg.
Hall, Stuart (2000): Rassismus als ideologischer Diskurs. In: Räthzel,
Nora (Hg.): Theorien über Rassismus. Hamburg. 7–16.
Hall, Stuart (2004): Das Spektakel des „Anderen“. Ideologie, Identität,
Repräsentation. Ausgewählte Schriften 4. Hamburg. 108–165.
Hall, Stuart (2012): The neoliberal revolution. Thatcher, Blair, Cameron
– the long march of neoliberalism continues. In: Rutherford, Jonathan
& Davison, Sally (Hg.): (Soundings on) The Neoliberal Crisis. 8–26.
Hall, Stuart & Massey, Doreen (2012): Interpreting the crisis. In: Rutherford, Jonathan & Davison, Sally (Hg.): (Soundings on) The Neoliberal Crisis.
337
�Hamm, Marion & Sutter, Ove (2010): „ICH STRESS. ICH PAUSE. ICH
STREIK.“ Widerständige Subjektivierungen auf den EuroMayDayParaden der Prekären. In: Maier, Wolfgang & Maderthaner, Michaela
(Hg.): Der 1. Mai. Demonstration, Tradition, Repräsentation. Wien.
Haraway, Donna (1988): Situated knowledges: The science question in
feminism and the privilege of partial perspective. In: Feminist studies
14 (3). 575–599.
Haraway, Donna (1997): Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan_Meets_ OncoMouse: Feminism and Technoscience. New York.
Haraway, Donna (2007): Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im
Feminimus und das Privileg einer partialen Perspektive. In: Dis/Kontinuitäten: feministische Theorie. Wiesbaden. 305–322.
Hatton, Joshua Paul. (2011). How and why did MARS facilitate migration control?: Understanding the Implication of Migration and Refugee
Studies (MARS) with the Restriction of Human Mobility by UK State
Agencies. PhD Dissertation. University of Oxford.
Hampel, Lea (2012): Münchens Tagelöhner – ein Leben im Schatten. In:
Münchner Merkur, 47, 25./26.2.2012. 36.
Hampel, Lea (2013): Südosteuropäer in München – Auf der Suche nach
dem Glück. In: Münchner Merkur, 140, 20.06.2013. 34.
Handel, Stephan (2012): Münchner Bahnhofsviertel – Reizende Gegend. In: Süddeutsche.de, 02.12.2012. Verfügbar unten: http://www.
sueddeutsche.de/muenchen/muenchner-bahnhofsviertel-reizendegegend-1.1539283 [21.06.2016].
Hess, Sabine (2005): Globalisierte Hausarbeit – Au-pair als Migrationsstrategie von Frauen aus Osteuropa. Wiesbaden.
Hess, Sabine (2009): „Man schickt doch nicht eine Ersatzbraut zum Altar.“ Zur Konfliktualität der neuen Formen des Regierens in und von
Europa. In: Welz, Gisela & Lottermann, Annalina (Hg.): Projekte der
Europäisierung. Kulturanthropologische Forschungsperspektiven.
Kulturanthropologische Notizen, Band 78. Frankfurt a.M. 181–196.
Hess, Sabine; Binder, Jana & Moser, Johannes (2009): No integration?!
Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Integrationsdebatte in Europa.
Bielefeld.
338
�Hess, Sabine & Kasparek, Bernd (2010): Grenzregime : Diskurse, Praktiken, Institutionen in Europa. Berlin.
Hess, Sabine; Langreiter, Nikola & Timm, Elisabeth (2014): Intersektionalität revisited: empirische, theoretische und methodische Erkundungen. Bielefeld.
Hess, Sabine & Lebuhn, Henrik (2014): Politiken der Bürgerschaft. Zur
Forschungsdebatte um Migration, Stadt und citizenship. In: sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung, 2 (3). 11–34.
Hess, Sabine & Moser, Johannes (2003): Kultur der Arbeit – Kultur der
neuen Ökonomie. Kulturwissenschaftliche Beiträge zu neoliberalen
Arbeits- und Lebenswelten. Graz.
Hess, Sabine & Schwertl, Maria (2013): Vom „Feld“ zur „Assemblage“?
Perspektiven europäisch-ethnologischer Methodenentwicklungen. In:
Hess, Sabine & Schwertl, Maria (Hg.): Europäisch-ethnologisches Forschen. Neue Methoden und Konzepte. Berlin.
Hess, Sabine & Tsianos, Vassilis. (2004). „Killing me softly?“ Festung
Europa oder Grenzregime als soziales Kräfteverhältnis? Europäisierung der Migrations- und Grenzpolitiken. Vortrag bei der HeinrichBöll-Stiftung Hessen. 07.12.2004.
Hess, Sabine & Tsianos, Vassilis (2010): Ethnographische Grenzregimeanalyse als Methodologie der Autonomie der Migration. In: Hess,
Sabine & Kasparek, Bernd (Hg.): Grenzregime. Diskurse, Praktiken,
Institutionen in Europa. Berlin.
Hielscher, Lee (2013). Von Semantiken und Praktiken der Depriviligierung. Eine ethnografische Grenzregimeanalyse zur Situation rumänischer und bulgarischer Rom_nija in Berlin. Unveröffentlichte Bachelorarbeit. Georg-August-Universität Göttingen.
Hielscher, Lee & Riedner, Lisa (2015): Von Blockupy zum sozialen
Streik. Der Politikwissenschaftler Sandro Mezzadra über die Proteste
in Frankfurt und den Versuch, verschiedene Kämpfe zusammenzuführen. In: ak – analyse & kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis, Nr.
604, 21.4.2015, 14.
Hirsch, Michael (2015): Die Überwindung der Arbeitsgesellschaft: Eine
politische Philosophie der Arbeit. Wiesbaden.
339
�Hoffinger, Isa (2011): Draußen bleiben. In: BISS – Bürger in Sozialen
Schwierigkeiten, 10.
hooks, bell (1990): Yearning: race, gender and cultural politics. Boston.
Höfler, Rosemarie (2002): Europa auf dem Weg zu einer sozialen Union? Die EuGH-Rechtsprechung zu unionsrechtlichen Ansprüchen auf
Sozialhilfe. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 10. 1206–1208.
Huber, Rudolf & Gebharst, Heinz (2015): Multikulti-Hochburg, Touristen-Magnet, Gastro-Paradies - Bahnhofsviertel: 14 Geschichten
aus dem Schmelztiegel. In: tageszeitung, 14.03.2015. Verfügbar unten: http://www.tz.de/muenchen/stadt/ludwigsvorstadt-isarvorstadtort43328/bahnhofsviertel-muenchen-geschichten-schmelztiegel-derstadt-tz-4816743.html [21.06.2016].
Huntington, Samuel (1996): The clash of civilizations and the remaking
of world order. New York.
Hutta, Jan Simon; Laister, Judith; zur Nieden, Birgit & Hess, Sabine
(2013): Kollaborationen und Grenzgänge zwischen akademischen und
nicht-akademischen Wissenspraktiken: Ein Gespräch mit Jan Simon
Hutta, Judith Laister, Birgit zur Nieden und Sabine Hess. In: Binder,
Beate; von Bose, Fred; Ebell, Katrin; Hess, Sabine & Kainz, Annika
(Hg.): Eingreifen, Kritisieren, Verändern? Ethnographische und genderkritische Perspektiven auf Interventionen. Münster. 151–173.
Hymes, Dell (1972): Reinventing Anthropology. New York.
International Labour Organisation (2001): Yearbook of labour statistics. Genf.
Isin, Engin & Nielsen, Greg (2008): Acts of citizenship. London.
Initiative Zivilcourage (2010): Bulgarische Münchner fordern Respekt, mehr Rechte und das nicht nur auf dem Papier. Verfügbar unter:
http://inizivi.antira.info/2010/04/29/bulgarische-munchner-fordernrespekt-mehr-rechte-und-das-nicht-nur-auf-dem-papier/ [23.06.2016].
Initiative Zivilcourage (2013): Rassistische Polizeikontrollen: Zoll
kennzeichnet bulgarische Tagelöhner_innen mit grünen Bändchen.
Pressemitteilung vom 23.10.2013. Verfügbar unter: http://inizivi.antira.info/2013/10/23/rassistische-polizeikontrollen-zoll-kennzeichnetbulgarische-tagelohner_innen-mit-grunen-armbandern/ [23.06.2016].
340
�Initiative Zivilcourage (2017a): Wir wollen wohnen! Bericht und Materialien zur Kampagne 2016. Verfügbar unter: http://inizivi.antira.
info/2017/03/18/wir-wollen-wohnen-bericht-und-materialien-zurkampagne-2016/ [14.04.2018].
Initiative Zivilcourage (2017b): We won! Obdachloser EU-Bürger klagt
Recht auf unterkunft vor Gericht ein! Verfügbar unten: http://inizivi.
antira.info/2017/08/28/we-won-obdachloser-eu-burger-klagt-rechtauf-unterkunft-vor-gericht-ein/ [28.08.2017].
Initiative Zivilcourage (2017c): Hristo Vankov ist gestorben. Wir
werden ihn nicht vergessen. Verfügbar unter: http://inizivi.antira.
info/2017/10/18/hristo-vankov-ist-gestorben-wir-werden-ihn-nichtvergessen/ [14.04.2018].
Initiative Zivilcourage & Arbeitsuchende bzw. Arbeitnehmer/innen im Bahnhofsviertel (2013): Offener Brief der Initiative Zivilcourage und Arbeitsuchender im Bahnhofsviertel vom
6.12.2013. Verfügbar unten:
http://inizivi.antira.info/2013/12/18/
offener-brief-der-initiative-zivilcourage-und-arbeitsuchender-imbahnhofsviertel-an-die-verantwortlichen-von-zoll-und-polizei/
[23.06.2016].
Ivancheva, Mariya (2014): Die Protestwelle 2012-13. Gelegenheiten und
Hindernisse für eine neue Linke im postsozialistischen Bulgarien. In:
Kurswechsel, 1. 71–79.
Janda, Constanze (2015a): EuGH – Kein „Hartz-IV“ trotz Arbeitssuche.
Deutschland darf mittellose EU-Bürger von Sozialhilfe ausschließen.
In: Legal Tribune Online. Verfügbar unter: http://www.lto.de/recht/
hintergruende/h/eugh-urteil-c6714-alimanovic-sozialleistungenHartz IV-arbeitssuche/ [23.06.2016].
Janda, Constanze (2015b): Ungleichbehandlung im Grundsicherungsrecht – eine Nachlese zur Rechtssache „Dano“. In: Informationsbrief
Ausländerrecht, 3. S. 108–112.
Jessop, Bob (2013): Putting neoliberalism in its time and place: a response to the debate. In: Social Anthropology, 21 (1). 65–74.
Johler, Reinhard; Matter, Max & Zinn-Thomas, Sabine (2011): Mobilitäten. Europa in Bewegung als Herausforderung kulturanalytischer
Forschung. Münster/New York/München/Berlin.
341
�Karakayalı, Serhat (2008): Gespenster der Migration. Zur Genealogie
illegaler Einwanderung in der Bundesrepublik Deutschland. Bielefeld.
Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis (2002): Migrationsregimes in der Bundesrepublik Deutschland: Zum Verhältnis von Staatlichkeit und Rassismus. In: Demirovic, Alex &
Bojadžijev, Manuela (Hg.): Konjunkturen des Rassismus. Münster.
246–267.
Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis (2007): Movements that matter.
Eine Einleitung. In: Forschungsgruppe, TRANSIT MIGRATION (Hg.),
Turbulente Ränder – Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas. Bielefeld. 7–17.
Kasparek, Bernd (2016): Complementing Schengen. The Dublin System
and the European Border and Migration Regime. In: Bauder, Harald &
Matheis, Christian (Hg.): Migration Policy and Practice: Interventions
and Solutions. NewYork. 59–78.
Kastner, Bernd (2013): Zoll wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe. In:
Süddeutsche Zeitung, 24.10.2013, München City. R4.
Keller, Berndt; Schulz, Susanne & Seifert, Hartmut (2012): Entwicklungen und Strukturmerkmale der atypisch Beschäftigten in Deutschland
bis 2010, WSI-Diskussionspapier, 182. Verfügbar unter: http://www.
boeckler.de/pdf/p_wsi_disp_182.pdf [21.06.2016].
Kingreen, Thorsten (2007): Die Universalisierung sozialer Rechte im
europäischen Gemeinschaftsrecht. In: Europarecht, Beiheft 1. 43–74.
kolinko (2002): hotlines – call center | untersuchung | kommunismus.
Verfügbar: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/kolinko/lebuk/d_lebuk.htm [15.10.2015]
Krause, Johannes (2008): Die Konstruktion der Grenzen Europas. Das
staatliche Territorialitätsprinzip und seine Extrapolation auf die supranationale Ebene. Doktorarbeit, Universität Leipzig.
Kurz, Joshua (2012): (Dis)locating Control: Transmigration, Precarity
and the Governmentality of Control. In: Behemoth, 5 (1). 30–51.
Künkel, Jenny (2016): Email an Lisa Riedner vom ##.12.2016.
342
�Künkel, Jenny (2017): Gentrification and the flexibilisation of spatial control: Policing sex work in Germany. In: Urban Studies, 54 (3).
730–746.
Labor Migration (2014): Vom Rand ins Zentrum. Perspektiven einer
kritischen Migrationsforschung. Berlin.
Landeshauptstadt München (2014). Sicherheitsbericht der Landeshauptstadt München 2013. München. Verfügbar unter: https://www.
ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3333627.pdf
[23.06.2016].
Lanz, Stephan (2009): In unternehmerische Subjekte investieren. Integrationskonzepte im Workfare-Staat. Das Beispiel Berlin. In: Hess, Sabine; Binder, Jana; Moser, Johannes (Hg.): No integration?! Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Integrationsdebatte in Europa. Bielefeld.
105–122.
Latour, Bruno (2005): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. New York.
Law, John & Urry, John (2004): Enacting the social. In: Economy and
society, 33 (3). 390–410.
Länder erhalten eine Milliarde Euro für Flüchtlinge – Bundesrat billigt Asylbewerbergesetz (2014). In: Die Welt, 28.11.2014. Verfügbar
unter: http://www.welt.de/newsticker/news1/article134811364/Laender-erhalten-eine-Milliarde-Euro-fuer-Fluechtlinge.html [23.06.2016].
Lebuhn, Henrik (2012): Bürgerschaft und Grenzpolitik in den Städten
Europas. Perspektiven auf die Stadt als Grenzraum. In: Peripherie.
Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt, 126/127. 350362.
Lebuhn, Henrik (2013): Urban citizenship, border practices and immigrants’ rights in Europe. Ambivalences of a cosmopolitan project. In:
Open Citizenship, 4 (2).
Lehnert, Katrin (2009): „Arbeit, nein danke“!? Das Bild des Sozialschmarotzers im aktivierenden Sozialstaat. München.
Lehnert, Katrin & Lemberger, Barbara (2014): Mit Mobilität aus der
Sackgasse der Migrationsforschung? Mobilitätskonzepte und ihr Beitrag zu einer kritischen Gesellschaftsforschung. In: Labor Migration
343
�(Hg.): Vom Rand ins Zentrum. Perspektiven einer kritischen Migrationsforschung. Berlin. 45-61.
Lem, Winnie & Leach, Belinda (2002): Culture, economy, power: anthropology as critique, anthropology as praxis. Albany.
Lemberger, Barbara (2007): „Alles fürs Geschäft!“ Die Unternehmenskultur eines kleinen Familienunternehmens. Berlin.
Lemke, Thomas (1997): Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults
Analyse der modernen Gouvernementalität. Berlin.
Lentin, Alana (2011): What happens to anti-racism when we are post
race? In: Feminist Legal Studies, 19 (2). 159–168.
Lentin, Alana & Titley, Gavin (2011): The crises of multiculturalism.
Racism in a neoliberal age. London.
Lessenich, Stephan (2013): Die Neuerfindung des Sozialen – Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus. Bielefeld.
„Life ist too Expensive“ Movement (2016): We are not for sale! Communique from „Life ist too Expensive“ Movement. In: Lefteast. Verfügbar unter: http://www.criticatac.ro/lefteast/we-are-not-for-salecommunique/ [28.06.2016].
Lipsky, Michael (2010): Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York.
Loerzer, Sven (2014): Eine Frage der Kälte. In: Süddeutsche Zeitung,
15.02.2014, München City. R2.
Lorey, Isabell (2007): Als das Leben in die Politik eintrat. Die biopolitisch-gouvernementale Moderne, Foucault und Agamben. In: Pieper, Marianne; Atzert, Thomas; Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis
(Hg.): Empire und die biopolitische Wende: Die internationale Diskussion im Anschluss an Hardt und Negri. Frankfurt/New York. 269–292.
Lorey, Isabell (2011): Von den Kämpfen aus. Eine Problematisierung
grundlegender Kategorien. In: Timm, Sabine Hess/Nikola Langreiter/
Elisabeth (Hg.): Intersektionalität revisited. Empirische, theoretische
und methodische Erkundungen. Bielefeld. 101–116.
Lorey, Isabell (2012): Die Regierung der Prekären. Wien.
344
�Low, Setha M. & Merry, Sally Engle (2010): Engaged Anthropology
– Diversity and Dilemmas – An Introduction to Supplement 2. In:
Current Anthropology, 51 (2). 2013–2226.
Maguire, Mark; Frois, Catarina & Zurawski, Nils (2014): The Anthropology of Security: Perspectives from the Frontline of Policing, Counter-Terrorism and Border Control. London/Ann Arbor.
Mak, Geert (2005): Der Mord an Theo Van Gogh. Geschichte einer moralischen Panik. Frankfurt a.M.
Malinowski, Bronislaw (2002): Argonauts of the Western Pacific: An
account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of
Melanesian New Guinea. London/New York.
Malo de Molina, Marta (2004a): Common Notions, Part 1: WorkersInquiry, Co-Research, Consciousness Raising. In: transversal – multilingual webjournal. Verfügbar unter: http://transform.eipcp.net/
transversal/0406/malo/en [20.06.2016].
Malo de Molina, Marta (2004b): Common Notions, Part 2: Institutional
Analysis, Participatory Action-Research, Militant Research. In: transversal – multilingual webjournal. Verfügbar unter: http://eipcp.net/
transversal/0707/malo/en [20.06.2016].
Marcus, George (1995): Ethnography in/of the World System: The
Emergence of Multi-Sited Ethnography. In: Annual review of anthropology, 24. 95–117.
Marx, Karl. Grundrisse: Notebook III / IV. Verfügbar unter: https://
www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch07.htm
[24.06.2016].
Massey, Doreen (2005): For Space. London/Thousand Oaks/New Delhi.
Mezzadra, Sandro (2011): Bringing capital back in: a materialist turn in
postcolonial studies? In: Inter‐Asia Cultural Studies, 12 (1). 154–164.
Mezzadra, Sandro (2015): Paper presented at the Workshop on Borders,
Citizenship & Mobility, King’s College London. 26.06.2015.
Mezzadra, Sandro & Neilson, Brett (2013): Border as Method, Or, the
Multiplication of Labor. Durham.
345
�Mezzadra, Sandro & Neilson, Brett (2014): Grenzen der Gerechtigkeit,
differentielle Inklusion und Kämpfe der Grenze. In: Heimeshoff, LisaMarie; Hess, Sabine; Kron, Stefanie; Schwenken, Helen & Trzeciak,
Miriam (Hg.): Grenzregime II – Migration, Kontrolle, Wissen. Transnationale Perspektiven. Berlin/Hamburg. 232–255.
Miles, Robert (2000): Apropos the idea of ‚race‘... again. In: Back, Les
& Solomos, John (Hg.): Theories of Race and Racism – A reader. London/New York. 125–143.
Mitropoulos, Angela (2005): Precari-us. In: mute–culture and politics
after the net, 1 (29). 88–96.
Moser, Johannes (1993): Jeder, der will, kann arbeiten. Die kulturelle
Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit. Wien/Zürich.
Nader, Laura (1969): Up the Anthropologist – Perspectives gained from
Studying up. In: Hymes, Dell (Hg.): Reinventing Anthropology. New
York. 284–311.
New Keywords Collective (2016): Europe / Crises: New Keywords of
‚the Crisis‘ in and of ‚Europe‘. In: Near Futures Online, Europe at a
Crossroads (1). Verfügbar unter: http://nearfuturesonline.org/europecrisis-new-keywords-of-crisis-in-and-of-europe/ [21.0.2016].
Nicolaus, Noel David (2014): Zwischen citizenship und commoning –
Recht auf Stadt in Zeiten der Eurokrise. In: sub\urban. zeitschrift für
kritische stadtforschung, 2 (3). 113–125.
Nonhoff, Martin (2006): Politischer Diskurs und Hegemonie – das Projekt „Soziale Marktwirtschaft“. Bielefeld.
Objektbezogene Planung und Immobilien-Management [Sozialreferat, Landeshauptstadt München] (2011): Beendigung der Unterbringung – Befristung der Unterbringung. Dienstanweisung vom
13.09.2011. München.
Objektbezogene Planung und Immobilien-Management [Sozialreferat, Landeshauptstadt München] (2012). Dienstanweisung zur Unterbringung von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern. Dienstanweisung
vom 31.07.2012. München.
346
�Ong, Aihwa/Collier, Stephen J. (2005): Global Assemblages. Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems. Malden/Oxford/
Carlton.
o.V. (2007): Weltweite Workers Center?. In: Wildcat, 78. 21–22. Verfügbar unter: http://www.wildcat-www.de/wildcat/78/w78_workers_
center.htm [16.06.2016].
Öchsner, Thomas (2013): Arbeitsmigranten aus Osteuropa – Endstation
„Arbeiterstrich“. In: Süddeutsche Zeitung, 10.02.2013.
Özkan, Derya (2015): „Let Them Gentrify Themselves“ – Space, Migration and Culture in Munich’s Bahnhofsviertel. In: Götz, Irene; Moser,
Johannes; Ege, Moritz & Lauterbach, Burkhart (Hg.): Europäische Ethnologie in München. Ein kulturwissenschaftlicher Reader. München.
Papadopoulos, Dimitris & Sharma, Sanjay (2008): Editorial: Race/matter-materialism and the politics of racialization. In: darkmatter, 2.
Papadopoulos, Dimitris; Stephenson, Niamh & Tsianos, Vassilis (2008):
Escape Routes. Control and Subversion in the Twenty-first Century.
London/Ann Arbor, MI.
Papadopoulos, Dimitris & Tsianos, Vassilis (2013): After citizenship:
autonomy of migration, organisational ontology and mobile commons. In: Citizenship studies, 17 (2). 178–196.
Papp, Konstanze v. (2009): EuGH zieht Notbremse zum Schutz der sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedsstaaten bei Unterhaltsstipendien für Studenten. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2. 87–90.
Peck, Jamie (2001): Workfare States. New York.
Peck, Jamie (2003): The rise of the workfare state. In: Kurswechsel, 18
(3). 75–87.
Pieper, Marianne; Atzert, Thomas; Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis (2011): Biopolitik in der Debatte – Konturen einer Analytik der
Gegenwart mit und nach der biopolitischen Wende. Wiesbaden. 7–27.
Pieper, Marianne & Gutiérrez Rodríguez, Encarnación (2003): Gouvernementalität – Ein sozialwissenschaftliches Konzept in Anschluss
an Foucault. Frankfurt a.M./New York.
347
�Pieper, Marianne; Panagiotidis, Efthimia & Tsianos, Vassilis (2009):
Regime der Prekarität und verkörperte Subjektivierung. In: Herrlyn,
Gerrit; Müske, Johannes; Schönberger, Klaus & Sutter, Ove (Hg.): Arbeit und Nicht-Arbeit. Entgrenzungen und Begrenzungen von Lebensbereichen und Praxen. München/Mehring. 341–357.
Pieper, Marianne; Panagiotidis, Efthimia & Tsianos, Vassislis (2011):
Konjunkturen der egalitären Exklusion. Postliberaler Rassismus und
verkörperte Erfahrung in der Prekarität. In: Pieper, Marianne; Atzert,
Thomas; Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis (Hg.): Biopolitik in der
Debatte. Wiesbaden. 193–226.
Prantl, Heribert (2014): Armutsmigration – Die CSU missbraucht Zuwanderer aus Osteuropa. In: Süddeutsche.de, 28.08.2014. Verfügbar
unten: http://www.sueddeutsche.de/politik/armutsmigration-die-csumissbraucht-zuwanderer-aus-osteuropa-1.2105463 [21.06.2016].
precarias a la deriva (2007): Projekt und Methode einer ‚militanten Untersuchung’. Das Reflektieren der Multitude in actu. In: Pieper, Marianne; Atzert, Thomas; Karakayalı, Serhat & Tsianos, Vassilis (Hg.):
Empire und die biopolitische Wende. Die internationale Diskussion
im Anschluss an Hardt und Negri. Frankfurt a.M./New York, 85–108.
Preuss, Roland & Janisch, Wolfgang (2014): Grenzen der Freizügigkeit.
In: Süddeutsche Zeitung, 12.11.2014. 5.
Price, Jonathan & Spencer, Sarah (2014): City-level responses to migrant families with restricted access to welfare benefits - A European
pilot study. Oxford. Verfügbar unter: http://www.compas.ox.ac.uk/
media/PR-2014-No_Recourse_Public_Funds.pdf [21.06.2016].
Puar, Jasbir (2007): Terrorist assemblages: Homonationalism in queer
times. Durham/London.
Rahmsdorf, Inga (2016): Obdachlose Tagelöhner demonstrieren vor
demm Rathaus. In: Süddeutsche.de, 01.03.2016. Verfügbar unten:
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/protestzug-obdachlose-tageloehner-demonstrieren-vor-dem-rathaus-1.2887586 [14.04.2018].
Redaktion heute.at (2017): Mutiger Mann — Obdachloser erkämpft vor
Gericht eigene Notunterkunft. In: heute.at, 23.08.2017. 23.8.17. Ver-
348
�fügbar unten: http://www.heute.at/welt/news/story/Muenchen–Obdachloser-feiert-Erfolg-vor-Gericht-43855829 [14.04.2018].
Reding, Viviane (2013): Free movement: Vice-President Reding’s intervention at the Justice and Home Affairs Council. SPEECH/13/789 Verfügbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-789_
de.htm [21.06.2016].
Referat für Arbeit und Wirtschaft [Landeshauptsstadt München]
(2015): Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am
21.04.2015. Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02711. Verfügbar unten:
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3635704.pdf [30.08.2017].
Referat für Stadtplanung und Bauordnung; Kommunalreferat; Sozialreferat; Stadtkämmerei [Landeshauptstadt München] (2001): Wohnen in München, III – Wohnungspolitisches Handlungsprogramm
2001–2005. 04.07.2001.
Reinsberg, Alexandra (2012): Arbeiterstrich in München – „Scheißegal,
ich mache alles“. In: Süddeutsche.de, 07.10.2012. Verfügbar unten:
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/arbeiterstrich-in-muenchenscheissegal-ich-mache-alles-1.1487608 [21.06.2016].
Restrepo, Eduardo & Escobar, Arturo (2005): ‘Other Anthropologies and Anthropology Otherwise’ Steps to a World Anthropologies
Framework. In: Critique of Anthropology, 25 (2). 99–129.
Richter, Eva-Maria (2015): Beggars not wanted: a chronology of the
exclusion of ‘poverty immigrants’ in Munich. In: transformations. A
new voice on culture, politics and change. Verfügbar unter: http://
transformations-blog.com/beggars-not-wanted-a-chronology-of-theexclusion-of-poverty-immigrants-in-munich/ [21.06.2016].
Richter, Eva-Maria (2017): Osteuropäische „Armutszuwanderung“ in
München. Eine ethnografische Grenzregimeanalyse (= Münchner Ethnografische Schriften Bd. 23). München.
Riedner, Lisa (2011): „Let’s show the world how we live and work!”
The Struggles of Bulgarian Day-labourers in Munich. In: Multicultural
Center Prague (Hg.): Flexi In-Security. Ten Stories and Photo Reportages on the Situation of Labor Migrants in Times of Economic Crisis.
Prag.
349
�Riedner, Lisa (2014): Wie intervenieren? Zur Wirkmacht akademischer
Wissenspraxis und der ethnographischen Regimeanalyse. In: Heimeshoff, Lisa-Marie; Hess, Sabine; Kron, Stefanie; Schwenken, Helen &
Trzeciak, Miriam (Hg.): Grenzregime II. Migration – Kontrolle – Wissen. Transnationale Perspektiven. Berlin/Hamburg. 281–300.
Riedner, Lisa (2015): Justice for Janitors? Marktbürgerschaft, Freizügigkeit und EU-Migrantinnen im Arbeitskampf. Einblicke in ein aktivistisches Forschungsprojekt. In: movements. Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, 1 (2). Verfügbar unten: http://
movementsjournal.org/issues/02.kaempfe/16.riedner–justice-for-janitors.html [21.06.2016].
Riedner, Lisa (2017): Aktivierung durch Ausschluss. Sozial- und migrationspolitische Transformationen unter den Bedingungen der EUFreizügigkeit. In: movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 3 (1). Verfügbar unter: http://movements-journal.
org/issues/04.bewegungen/06.riedner–aktivierung-durch-ausschluss.
html [08.05.2018].
Riedner, Lisa; Weinzierl, Matthias & Zehmisch, Philipp (2009): Eiskalte Händchen. Eine eiskalte Hinterland-Comicbeilage. In: Bayerischer
Flüchtlingsrat (Hg.). Hinterland, 12.
Riedner, Lisa & Weissmann, Julie (2013): Wenn Wissen schafft? Überlegungen zu Wissenspraxen der In(ter)vention. In: Binder, Beate; Ebel,
Katrin; Hess, Sabine; Keinz, Anika & von Bose, Fred (Hg.): Kritisieren,
Verändern, Eingreifen!? Interventionen ethnographisch und gendertheoretisch. Münster. 192–206.
Riedner, Lisa & Zehmisch, Philipp (2009): Widerstand auf der Baustelle. Eine ethnographische Fallstudie zur Aushandlung transnationaler
Realitäten der Werkvertragsarbeit in München und Istanbul. In: Crossing Munich Ausstellungsgruppe (Hg.): Crossing Munich. Texte zur
Migration aus Kunst, Wissenschaft und Aktivismus. München.
Riegler, Birgit; Remter, Felix; Reiprich, Nina; Sommerauer, Michael
& Tetik, Savas (2011): Öffnungszeiten. [Dokumentarfilm]. Institut für
Ethnologie. Ludwig-Maximilians-Universität. München.
Risel, Michael (2013a): Die Straßenarbeiter. In: Süddeutsche Zeitung,
22.08.2013, München City. R7.
350
�Risel, Michael (2013b): Tagelöhner in München – Ware Mensch. In: Süddeutsche.de, 30.10.2013. Verfügbar unten: http://www.sueddeutsche.
de/muenchen/tageloehner-in-muenchen-ware-mensch-1.1806948
[21.06.2016].
Risel, Michael (2013c): Treff für Tagelöhner im Bahnhofsviertel – Ärger
mit den Schwarzarbeitern. In: Süddeutsche.de, 30.08.2013. Verfügbar
unten: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/treff-fuer-tageloehner-im-bahnhofsviertel-aerger-mit-den-schwarzarbeitern-1.1757969
[22.06.2016].
Rodatz, Mathias (2014): Migration ist in dieser Stadt eine Tatsache.
Urban politics of citizenship in der neoliberalen Stadt. In: sub\urban.
zeitschrift für kritische stadtforschung, 2 (3). 35–58.
Roggero, Gigi (o.J.): Brief relation about meaning, methods and examples of militant investigation and co-research as political action. Verfügbar unter: http://www.sindominio.net/idan/web/coresearch_method.html [21.06.2016].
Rohrer, Julian (2013): Armutszuwanderung in München – Endstation
Arbeiterstrich – Hier warten die Armen der Schickeria-Stadt auf einen Job. In: Focus Online, 30.10.2013. Verfügbar unter: http://www.
focus.de/panorama/welt/tid-34337/armutszuwanderung-in-muenchen-der-arbeiterstrich-schaedigt-unser-geschaeft_aid_1140034.html
[21.06.2016].
Rose, Nikolas (2000): Das Regieren von unternehmerischen Individuen.
In: Kurswechsel, 2. 8–27.
Rose, Romani (2013): „Gestohlene Kinder?“ Roma in Europa am Pranger – die Verantwortung der Medien. Pressemitteilung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, 05.11.2013. Verfügbar unter: http://
www.foerdervereinroma.de/archiv/2013/Zentralrat_Griechenland.
pdf [24.06.2016].
Roßmann, Robert (2013): CSU plant Offensive gegen Armutsmigranten. In: Süddeutsche.de, 28.12.2013. Verfügbar unten: http://www.
sueddeutsche.de/politik/wegen-bulgarien-und-rumaenien-csu-plantoffensive-gegen-armutsmigranten-1.1852159 [21.06.2016].
Ruder, Karl-Heinz (2015): Grundsätze der polizei- und ordnungsrechtlichen Unterbringung von (unfreiwillig) obdachlosen Menschen unter
351
�besonderer Berücksichtigung obdachloser Unionsbürger. Berlin. Verfügbar unter: http://www.bagw.de/media/doc/POS_15_Rechtsgutachten_Ordungsrecht_Endg%C3%BCltige_Fassung.pdf [21.06.2016].
Rühle, Alex (2010): Probebohrungen im Biotop. In: Süddeutsche.de,
04.06.2010. Verfügbar unter: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/projekt-munich-central-probebohrungen-im-biotop-1.954141
[21.06.2016].
Said, Edward (1979): Orientalism. New York.
Sarasin, Philipp (2001): Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers. 1765–1914. Frankfurt a.M.
Sassen, Saskia (1996): Metropolen des Weltmarkts: Die neue Rolle der
Global Cities. Frankfurt a.M./New York.
Scharpf, Fritz & Girndt, Cornelia (2008): „Der einzige Weg ist, dem
EuGH nicht zu folgen“ – Interview. In: Die Mitbestimmung, 54 (7–8),
18–23.
Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens – Friedrich kündigt
deutsches Veto an (2013). In: tagesschau.de, 03.03.2013. Verfügbar unten:
https://www.tagesschau.de/ausland/schengen170.html
[24.06.2016].
Scherschel, Karin & Booth, Melanie (2012): Aktivierung in die Prekarität. Folgen der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland. In: Scherschel,
Karin; Streckeisen, Peter & Krenn, Manfred (Hg.): Neue Prekarität.
Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik. Europäische Länder im
Vergleich. Frankfurt a.M./New York. 17–46.
Scherschel, Karin; Streckeisen, Peter & Krenn, Manfred (2012): Neue
Prekarität: Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik – europäische Länder im Vergleich. Frankfurt a.M./New York.
Schiller 25 – Migrationsberatung Wohnungsloser [Evangelisches
Hilfswerk] (2015): Tätigkeitsbericht 2014 – 01.04.2014-31.03.2015.
Verfügbar unten: http://www.hilfswerk-muenchen.de/content/site/
dateien/892Schiller%2025_JB%202014.pdf?PHPSESSID=2c27433ad02fe
059cd87e236c56daab4 [13.06.2016].
Schoenes, Katharina & Schultes, Hannah (2014): Was ist neu an
‚neuer Migration’? In: DISS-Journal, 28. Verfügbar unten: https://
352
�www.diss-duisburg.de/2014/11/was-ist-neu-an-neuer-migration[06.04.12018].
Schröder, Berit (2015): Von Saisonarbeit, Werkverträgen und migrantischer Organisierung in der Baubranche und im Grünen Bereich.
Münster.
Schröder, Gerhard & Blair, Tony (1999): Der Weg nach vorne für Europas Sozialdemokraten: ein Vorschlag. Verfügbar unten: http://www.
glasnost.de/pol/schroederblair.html [21.06.2016].
Schwell, Alexandra (2014): „Niemand darf sich sicher fühlen!“ Anthropologische Perspektiven auf die Politik der Inneren Sicherheit. In:
Adam, Jens & Vonderau, Asta (Hg.): Formationen des Politischen –
Anthropologie politischer Felder. Bielefeld.
Schwertl, Maria (2015): Faktor Migration. Projekte, Diskurse und Subjektivierungen des Hypes um Migration&Entwicklung. Münster/New
York.
Sciortino, Giuseppe (2004): Between Phantoms and Necessary Evils.
Some Critical Points in the Study of Irregular Migrations to Western
Europe. In: IMIS-Beiträge 24: Migration and the Regulation of Social
Integration. 17–43.
Seifert, Manfred; Götz, Irene & Huber, Birgit (2007): Flexible Biografien? Horizonte und Brüche im Arbeitsleben der Gegenwart. Frankfurt
a.M./New York.
Sennett, Richard (1998): The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York/London.
Shore, Cris (2009): European Governance, or Governmentality? Reflections on the EU’s System of Government. Webpapers on Constitutionalism and Governance beyond the State, 3. Verfügbar unter: https://
www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/sowi/politik/governance/ConWeb_Papers/conweb3-2009.pdf [21.06.2016].
Shore, Cris & Wright, Susan (2003): Anthropology of policy: Perspectives on Governance and Power. London.
Shore, Cris & Wright, Susan (1997): Policy. A New Field of Anthropology. In: Shore, Cris & Wright, Susan (Hg.): Anthropology of Policy.
Critical Perspectives. London/New York. 3–39.
353
�Shore, Cris & Wright, Susan (2011): Conceptualising policy: Technologies of governance and the politics of visibility. In: Shore, Cris;
Wright, Susan & Però, Davide: Policy worlds. Anthropology and the
Analysis of Contemporary Power. New York/Oxford. 1–25.
Shukaitis, Stevphen & Graeber, David (2007): Introduction. In: Shukaitis, Stevphen, Graeber, David & Biddle, Erika (Hg.): Constituent Imagination: Militant Investigations // Collective Theorization. Oakland/
Edinburgh.
Siegert, Myriam (2013): Im Hauptbahnhofviertel – Arbeiterstrich: Die
Kreuzung der Armut. In: abendzeitung, 28.08.2013. Verfügbar unten:
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.im-hauptbahnhofviertel-arbeiterstrich-die-kreuzung-der-armut.0825ef04-2d33-45b3-b57317103a9fe0c1.html [21.06.2016].
SkriptaTV (2013): Yanis Varoufakis „Confessions of an Erratic Marxist“.
[Filmaufnahme]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?
v=A3uNIgDmqwI&feature=youtu.be17:44-18:09 [21.06.2016].
Smith, Gavin (1999): Confronting the present: towards a politically engaged anthropology. Oxford/New York/Berg.
Solomos, John (2002): Making sense of Racism: Aktuelle Debatten und
politische Realitäten. In: Bojadžijev, Manuela & Demirovic, Alex (Hg.):
Konjunkturen des Rassismus. Münster. 157–172.
Sozialleistungen: Friedrich mobilisiert EU gegen Armutszuwanderung (2013). In: Zeit Online, 25.04.2013. Verfügbar unter: http://
www.zeit.de/politik/ausland/2013-04/eu-innenminister-zuwanderung
[23.06.2016].
Sozialreferat [Landeshauptstadt München] (2009): Aufenthaltssituation von BürgerInnen aus den neuen EU- Beitrittsländern in München.
Antwortschreiben vom 28.12.2009. Verfügbar unter: http://www.rismuenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/1918980.pdf [23.06.2016].
Sozialreferat [Landeshauptstadt München] (2011): Wohnen statt Unterbringen. Thesenpapier vom 11.11.2011. München.
Sozialreferat [Landeshauptstadt München] & Evangelisches Hilfswerk. Das Münchner Kälteschutzprogramm ist ein europaweit
einmaliges Beratungsangebot – Sozialreferat und Evangelisches
354
�Hilfswerk nehmen zu Vorwürfen Stellung. Pressemitteilung vom
11.02.2014. Verfügbar unter: http://www.hilfswerk-muenchen.
de/index.php?lan=1&x=43&y=&detail=67&site=&PHPSESSID=
a0e4b91ab50b4b3c9b10044e239dfe50 [23.06.2016].
Squire, Vicky (2014): Keynote – Intervening in politics of mobility. Vortrag bei der Konferenz „Migrating in, migrating out: how to (re)think
‚migrants’‘ struggles“ am 08.05.2014. Sofia.
Stacey, Judith (1988): Can there be a feminist ethnography? In: Women’s
Studies International Forum, 11 (1). 21–27.
Stadtjugendamt [Sozialreferat, Landeshauptstadt München] (2010):
Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 05342 vom 30.11.2010. Verfügbar unter: http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2189198.pdf [23.06.2016].
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/rosa liste (2006): Auswirkungen der Änderungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Antrag Nr. 02-08 / A 03130 vom 11.07.2006.
Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste (2009): Aufenthaltssituation
von BürgerInnen aus den neuen EU-Beitrittsländern in München. Anfrage vom 06.10.2009. Verfügbar unter: http://www.ris-muenchen.de/
RII/RII/DOK/ANTRAG/1823565.pdf [23.06.2016].
Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste (2010): Umgang mit Zuwanderung aus den neuen EU-Beitrittsländern. Antrag Nr. 08-14 / A 01545
vom 07.05.2010. Verfügbar unter: http://www.ris-muenchen.de/RII/
RII/DOK/ANTRAG/2017507.pdf [23.06.2016].
Stadtratsfraktion Die Grünen/rosa liste (2012): Integrationskonzept
erweitern für ZuwanderInnen aus neuen EU-Beitrittsländern? Anfrage vom 30.10.2012. Verfügbar unter: http://gruene-fraktion-muenchen.
de/integrationskonzept-erweitern-fur-zuwanderinnen-aus-neuen-eubeitrittslandern/ [23.06.2016].
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/rosa liste & Stadtratsfraktion SPD (2013): Runder Tisch zur Armutszuwanderung aus EULändern (Südosteuropa). Antrag Nr. 08-14 / A 04260 vom 16.05.2013.
Verfügbar unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/2980367.pdf [23.06.2016].
355
�Stelle für interkulturelle Arbeit [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2008): Interkulturelles Integrationskonzept – Grundsätze
und Strukturen der Integrationspolitik der Landeshauptstadt München. München. Verfügbar unter: http://www.muenchen.info/soz/
pdf/int_konzept_grundsatz_pdf.pdf [23.06.2016]
Stelle für Interkulturelle Arbeit [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2014): Runder Tisch Armutszuwanderung aus EU-Ländern
(Südosteuropa). Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13716 vom 28.01.2014.
Verfügbar unter: https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/3232643.pdf [23.06.2016].
Südliches Bahnhofsviertel e.V. (2016a): Quartiersmanagement – was
ist das?. Verfügbar unten: http://www.bahnhofsviertel-muenchen.de/
quartiersmanagement [27.06.2016].
Südliches Bahnhofsviertel e.V. (2016b): Über Uns. Verfügbar unten:
http://www.bahnhofsviertel-muenchen.de/ueber-uns [10.06.2010].
Tibudd, Michael (2010): Eingewandert, ausgegrenzt - Eine Gruppe von
300 Bulgaren fristet in München ein Leben als Tagelöhner. In: Süddeutsche Zeitung, 05.08.2010, München City. R20.
TRANSIT MIGRATION Forschungsgruppe (2007): Turbulente Ränder:
Neue Perspektiven auf Migration an den Grenzen Europas. Bielefeld.
Theodore, Nik; Valenzuela, Abel & Meléndez, Edwin (2006): La Esquina (The Corner). Day Laborers on the Margins of New York’s Formal
Economy. In: WorkingUSA, 9 (4), 407–423.
Thym, Daniel (2014): EU-Freizügigkeit als rechtliche Konstruktion –
nicht als soziale Imagination. In: Verfassungsblog. Verfügbar unten:
http://verfassungsblog.de/eu-freizuegigkeit-als-rechtliche-konstruktion-nicht-als-soziale-imagination/ [23.06.2016].
Thym, Daniel (2015): When Union citizens turn into illegal migrants:
the Dano Case. In: European Law Review 40 (2). 249–262.
Todorova, Maria (2004): Historische Vermächtnisse als Analysekategorie. Der Fall Südosteuropa. In: Kaser, Karl; Gramshammer-Hohl,
Dagmar & Pichler, Robert (Hg.): Europa und die Grenzen im Kopf.
Klagenfurt. 227–252.
356
�Tsianios, Vassilios (2007): Imperceptible politics – rethinking radical politics of migration and precarity today. Dissertation an der Universität
Hamburg. Verfügbar unter: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2010/4665/pdf/Tsianos2007_ImperceptiblePolitics.pdf [21.06.2016].
Tsianos, Vassilis (2014): Homonationalismus und New Metropolitan
Mainstream. Gentrifizierungsdynamiken zwischen sexuellen und
postsäkularen Politiken der Zugehörigkeit. In: sub\urban. zeitschrift
für kritische stadtforschung, 2 (3). S. 59-80.
Tsianos, Vassilis (2015): Antimuslimischer Urbanismus. Zur Stadtsoziologie des antimuslimischen Rassismus. In: Hafez, Farid (Hg.): Jahrbuch
für Islamophobieforschung 2015. Wien. 55–82.
Tsianos, Vassilis & Karakayalı, Serhat (2008): Die Regierung der Migration in Europa. Jenseits von Inklusion und Exklusion. In: Soziale
Systeme, 14 (2). 329–348.
Tsianos, Vassilis & Pieper, Marianne (2011): Postliberale Assemblagen.
Rassismus in Zeiten der Gleichheit. In: Friedrich, Sebastian (Hg.): Rassimus in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen der ‚Sarrazindebatte‘. Berlin. 114–132.
Tyler, Stephen A. (1987): The Unspeakable. Discourse, Dialogue, and
Rethoric in the postmodern World. Madison/London.
Valenzuela, Abel; Kawachi, Janette A. & Marr, Matthew D. (2002):
Seeking Work Daily. Supply, Demand, and Spatial Dimensions of Day
Labor in Two Global Cities. In: International Journal of Comparative
Sociology, 43 (2). 192–219.
Valenzuela Jr, Abel (2003): Day labor work. In: Annual Review of Sociology. 307–333.
Van Baar, Huub (2012): Socio-economic mobility and neo-liberal
governmentality in post-socialist Europe: Activation and the dehumanisation of the Roma. In: Journal of Ethnic and Migration Studies,
38 (8). 1289–1304.
Van Baar, Huub (2015): Governing the Roma, Bordering Europe. Europeanization, Securitization and Differential Inclusion. Präsentation
auf der Konferenz: Reasonable Accommodations and Roma in Con-
357
�temporary Europe: A Symposium on Global Governance, Democracy
and Social Justice, Duke University, Durham (NC). Verfügbar unten:
https://www.academia.edu/18165726/Governing_the_Roma_Bordering_Europe_Europeanization_Securitization_and_Differential_Inclusion_2015_ [23.06.2016].
Van der Hoeven, Rolph & Sziraczki, György (1997): Lessons from Privatization. Labour Issues in Developing and Transitional Countries.
International Labour Organization. Genf.
van der Mei, Anne-Pieter (2005): Union Citizenship and the ‚De-Nationalisation‘ of the Territorial Welfare State. In: European Journal of
Migration and Law, 7 (2). 203–2011.
Van Overmeiren, Filip; Eichenhofer, Eberhard & Verschueren, Herwig (2013): Analytical Study 2011 – Social Security Coverage of NonActive Persons Moving to Another Member State. Gent.
Varsanyi, Monica (2008): Rescaling the „alien“, rescaling personhood:
Neoliberalism, immigration, and the state. In: Annals of the Association of American Geographers, 98 (4). 877–896.
Veto in Brüssel – Deutschland verhindert Schengen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien (2013). In: MIGAZIN, 11.03.2013. Verfügbar unten: http://www.migazin.de/2013/03/11/veto-in-brussel-friedrich-verhindert-schengen-beitritt-von-bulgarien-und-rumanien/ [23.06.2016].
Viehmann, Klaus; u.a. (1991): Drei zu Eins. Klassenwiderspruch, Rassismus und Sexismus. In: Metropolen(gedanken) und Revolution?. Berlin.
Voigt, Claudius (2014): Stellungnahme des Paritätischen – Gesamtverband – zum Gesetzentwurf zur Änderung des Freizügigkeitsgesetzes
und weiterer Vorschriften vom 22.9.2014 sowie zum Abschluss- und
Zwischenbericht des Staatssekretärsausschusses zu „Rechtsfragen
und Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der EU-Mitgliedsstaaten. Deutscher
Bundestag, Innenausschuss. Ausschussdrucksache 18(4)164 B vom
19.10.2014. Verfügbar unten: http://www.migration.paritaet.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1466953242&hash=371793
064987762858ffd0a707de89fb5b97af2a&file=/fileadmin/SUBDOMAINS/
358
�migration/Dokumente/Stellungnahmen/BAGFW-Stelln__Gesetz_
zur_Aenderung-FreizuegigG-EU_10-2014.pdf [23.06.2016].
Voigt, Claudius (2016): Stütze nur für Deutsche. In: Jungle World,
12.05.2016.
Verfügbar
unter:
http://jungle-world.com/artikel/2016/19/53987.html [26.06.2016].
Wacquant, Loïc (2008): Die städtische underclass im sozialen und wissenschaftlichen Imaginären Amerikas. In: Lindner, Rolf & Musner,
Lutz (Hg.): Unterschicht. Kulturwissenschaftliche Erkundungen der
„Armen“ in Geschichte und Gegenwart. Freiburg i.Br./Berlin/Wien.
59–77.
Wacquant, Loïc (2009): Punishing the poor. The neoliberal government
of social insecurity. Durham.
Wacquant, Loïc (2011): Die neoliberale Staatskunst: Workfare, Prisonfare und soziale Unsicherheit. In: Dollinger, Bernd & Schmidt-Semisch,
Henning (Hg.): Gerechte Ausgrenzung? Wohlfahrtsproduktion und
die neue Lust am Strafen. Wiesbaden. 77–109.
Wacquant, Loïc (2012): Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism. Social Anthropology, 19(4). 66–79.
Wallerstein, Immanuel (1998): Ideologische Spannungsverhältnisse im
Kapitalismus. Universalismus vs. Sexismus und Rassismus. In: Balibar,
Étienne & Wallerstein, Immanuel (Hg.): Rasse Klasse Nation. Ambivalente Identitäten. Hamburg.
Walters, William (2002): Mapping Schengenland. Denaturalizing the
border. In: Environment and Planning D: Society and Space, 20 (5).
561–580.
Walters, William (2004): Some Critical Notes on „Governance“. In: Studies in Political Economy, 73. 27–46.
Walters, William (2006): Border/control. In: European journal of social
theory, 9 (2). S. 187–203.
Walters, William (2011): Foucault and frontiers. Notes on the birth of
the humanitarian border. In: Bröckling, Ulrich; Krasmann, Susanne
& Lemke, Thomas (Hg.): Governmentality: Current issues and future
challenges. New York. 138–164.
359
�Walters, William (2012): Governmentality. Critical encounters. New
York.
Weissmann, Julie (2011): ‚In defense of place’. Ein Konzept, um das
Verhältnis von Wissenschaft und Praxis sowie von Globalisierung
und Lokalität neu zu artikulieren. Unveröffentlichte Magisterarbeit.
Ludwig-Maximilians-Universität München. München.
Welz, Gisela (1998): Moving Targets. Feldforschung unter Mobilitätsdruck. In: Zeitschrift für Volkskunde, 94 (2). 177–194.
Williams, Damian T. (2009): Grounding the Regime of Precarious Employment. Homeless Day Laborers’ Negotiation of the Job Queue. In:
Work and Occupations, 36 (3). 209–246.
Wimmer, Andreas & Glick Schiller, Nina (2003): Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration. An Essay
in Historical Epistemology. In: International Migration Review, 37 (3).
576–610.
Wischmann, Maike (1999): Angewandte Ethnologie und Unternehmen.
Die praxisorientierte ethnologische Forschung zu Unternehmenskulturen. Hamburg.
Wissel, Jens (2015): Staatsprojekt EUropa: Grundzüge einer materialistischen Theorie der Europäischen Union. Münster.
Wohnungs- und Flüchtlingsamt [Sozialreferat, Landeshauptstadt
München] (2001): Unterbringung von Obdachlosen nur noch gegen
Meldebestätigung. Vorläufige Dienstanweisung vom 13.11.2001. München.
Wohnungs- und Flüchtlingsamt [Sozialreferat, Landeshauptstadt München] (2002): Münchner Gesamtplan, I - Soziale Wohnraumversorgung - Wohnungslosenhilfe - Ziele und Handlungsprogramme ab 2002. Beschluss des Sozialhilfeausschusses vom
21. März 2002. Sitzungsvorlage 96-02 / V 02903. Verfügbar unter:
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/1958364.pdf [23.06.2016].
Wright, Sharon Elizabeth (2013): Confronting Unemployment in a
Street-Level Bureaucracy. Jobcentre staff and client perspectives. PhD
360
�Dissertation. University of Stirling. Verfügbar unten: https://dspace.
stir.ac.uk/bitstream/1893/259/1/wright-thesis.pdf [23.06.2016].
Wright, Steve; Hauer, Dirk; Kurz, Felix; Liebhold, Marion & Stubbe,
Lars (2005): Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus. Berlin.
361
�362
�
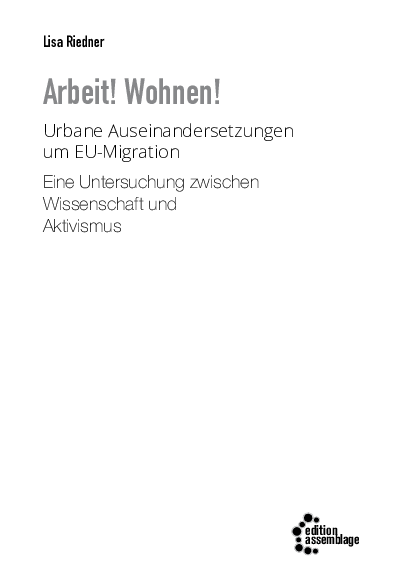
 Lisa Riedner
Lisa Riedner