Körperlose Anwesenheit? Vom Topos der ›reinen
Sichtbarkeit‹ zur ›artifiziellen Weltflucht‹
Marcel Finke / Mark A. Halawa
Den meisten bildtheoretischen Ansätzen liegt die Denkfigur einer ›inneren Duplizität
des Bildes‹ zugrunde: die scheinbar intuitiv schlüssige Differenz zwischen materiellem
Bildträger und immaterieller Bilderscheinung. Doch ist die Charakterisierung des
Bildes als in sich gespaltenes Phänomen in vielerlei Hinsicht heikel. So geht sie oft
mit der Priorisierung der Darstellung einher, der eine Marginalisierung der Materialität korrespondiert. Letzteres wird in der gegenwärtigen Debatte meist mit der
hermeneutischen und semiotischen Theorietradition assoziiert. Der Aufsatz möchte
indes zeigen, dass ›Materialitätsvergessenheit‹ ein Problem darstellt, das wesentlich
verbreiteter ist. Als Beispiel dient die phänomenologische Bildtheorie von Lambert
Wiesing. Es wird diskutiert, inwieweit seine These der ›reinen Sichtbarkeit‹ nicht
nur das Bild unzulässig purifiziert, sondern letztlich auch zu einer Entkörperung
des Wahrnehmungssubjekts führt.
1. Einleitung: Bildtheorie und Materialität
Über Bilder oder gar: über das Bild zu schreiben, ist kein einfaches Unterfangen. Je intensiver man den Bildbegriff zu definieren versucht, desto mehr
verwischt sich dessen Kontur. Man kann daher dem Kunsthistoriker Kurt
Bauch nur beipflichten, der bereits 1960 mutmaßte, dass es womöglich
eine »unserer Hauptfragen [ist], was ›Bild‹ noch bedeutet.«1 Im Rückblick
auf die viel beschworenen ›Wenden zum Bild‹ hat sich diese Vermutung
zweifellos als korrekt erwiesen.2 Die Einsicht in aktuelle Publikationen
zum Thema macht indes deutlich, dass die von Bauch gestellte ›Hauptfrage‹ längst nicht beantwortet ist. So zieht etwa Simone Neuber in der
Einleitung des Sammelbandes Das Bild als Denkfigur folgendes Fazit:
1
2
Kurt Bauch: »Imago« (1960), in: Gottfried Boehm (Hg.): Was ist ein Bild?, München 2006
[zuerst ebd. 1994], S. 275−299, hier: S. 275.
Für einen allgemeinen Überblick vgl. Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg 2009 [zuerst ebd. 2006],
S. 329−380.
�Körperlose Anwesenheit?
87
Wir sind fern davon, einen fest umrissenen Bildbegriff zu haben. In der Tat macht
es den Anschein, als spielten die Bedeutungsfacetten so ineinander, dass wir gar
nicht einmal sagen können, es handle sich überhaupt noch um einen Begriff […].
Viel eher scheinen wir es mit etwas zu tun zu haben, was auf besonders elastische
Weise eine Familie von mehr oder minder Ähnlichem bezeichnet.3
Neubers Resümee gilt allein der Geschichte und Diversität des Bildbegriffs
innerhalb der Philosophie. Es verwundert daher wenig, dass andere Disziplinen, die sich mit ›Bildern‹ befassen, den Bedeutungshof des Begriffs
ausweiten und der ›Familie‹ unentwegt zusätzliche Mitglieder hinzufügen.4 Die Vielfalt der Bildbegriffe ist zugleich der Grund dafür, dass jede
Festlegung auf eine operative Bedeutung des Wortes notwendigerweise
eine Reduktion darstellt. Jede noch so weite inhaltliche Bestimmung des
Begriffs schließt stets andere, ebenfalls mögliche Phänomene aus. Eine
thematische Abschattung scheint letztlich unumgänglich.
Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf einen Zweig der
Familie der Bilder, den man mit Edmund Husserl »physische Bildlichkeit«5
nennen könnte. Gemeint sind Bilder als materielle Artefakte, die uns
alltäglich in Form von Zeichnungen, Diagrammen, Gemälden, analogen,
aber auch digitalen Fotografien, Computersimulationen und dergleichen
begegnen. Die Liste ist damit nicht beendet, und auch der vorliegende
Sammelband kann nur einzelne Ausschnitte dieses weitreichenden Terrains
beleuchten, welches seinerseits ohne feste Umrandung ist.
Nun ist jedoch nicht nur der Begriff des Bildes vielfältig, sondern auch
das Spektrum der bildtheoretischen Positionen.6 Gleichwohl hat sich über
die Grenzen einzelner Ansätze hinaus eine grundlegende strukturelle Differenzierung des physischen – oder auch: externen, materiellen, empirischen – Bildes durchgesetzt. So besteht weitgehend Einigkeit darüber,
dass Darstellendes, Darstellung und Dargestelltes zu unterscheiden sind.
Diese Dreierstruktur findet sich in verschiedenen terminologischen Varia3
4
5
6
Simone Neuber: »Versuch einer einleitenden historisch-semantischen Rekonstruktion«,
in: dies., Roman Veressov (Hg.): Das Bild als Denkfigur. Funktionen des Bildbegriffs in
der Philosophie, München 2010, S. 7−32, hier: S. 7. Der Vorschlag, von einer Familienähnlichkeit der Bilder auszugehen, findet sich bereits bei William J. Thomas Mitchell:
Iconology. Image, Text, Ideology, Chicago / London 1987, S. 9−14. Vgl. auch Ingeborg
Reichle, Steffen Siegel, Achim Spelten: »Die Familienähnlichkeit der Bilder«, in: dies. (Hg.):
Verwandte Bilder. Die Fragen der Bildwissenschaft, Berlin 2007, S. 7−11.
Zur Bandbreite der Disziplinen vgl. u. a. Andreas Beyer, Markus Lohoff (Hg.): Bild und
Erkenntnis. Formen und Funktionen des Bildes in Wissenschaft und Technik, München
2005; Klaus Sachs-Hombach (Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen, Methoden,
Frankfurt / M. 2005.
Edmund Husserl: »Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung« (1904/05), in: Husserliana,
Bd. 23, hg. v. Eduard Marbach, Den Haag 1980, S. 1−108, hier: § 14, S. 29.
Zur Orientierung vgl. etwa Gustav Frank, Barbara Lange: Einführung in die Bildwissenschaft, Darmstadt 2010; Klaus Sachs-Hombach (Hg.): Bildtheorien. Anthropologische und
kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn, Frankfurt / M. 2009.
�88
Marcel Finke / Mark A. Halawa
tionen wieder. Mit einiger Vorsicht kann davon gesprochen werden, dass
diese Trias sowohl eine interne als auch eine externe Relation aufweist.
So handelt es sich beim Darstellenden und der Darstellung um eine dem
Bild immanente Beziehung, wohingegen die Beziehung zwischen Darstellung und Dargestelltem dem Bild selbst eher äußerlich ist. Eine besondere
Faszination geht zumeist von der »internen Verzweigung« zwischen dem
materiellen Bildträger und der immateriellen bildlichen Erscheinung aus,
die laut Axel Müller für einen »paradoxalen Doppelcharakter des Bildes«
sorgt.7 Tatsächlich gehört die Charakterisierung des Bildes als »doppeltes
Faktum«8 zum Grundrepertoire nahezu aller Bildtheorien. Man kann sogar
sagen, dass die Reflexionsfigur der Duplizität des Bildes selbst Ansätzen
zugrunde liegt, die ansonsten unvereinbar scheinen. Nicht immer wird die
Idee der Duplizität explizit ausgesprochen; häufig tritt sie im Gewand unterschiedlicher Terminologien auf und ist mit durchaus disparaten Thesen
und Zielstellungen verbunden.9
Ihre Überzeugungskraft gewinnt die Vorstellung einer konstitutiven
›inneren Doppelheit‹ des Bildes dadurch, dass sich die Differenz, auf der sie
beruht, gewissermaßen intuitiv mitteilt. Ganz ›offen-sichtlich‹ bestehen Unterschiede zwischen der bildlichen Erscheinung und ihrem physischen Träger – dies gilt etwa für deren Sichtbarkeit, Verwendbarkeit oder Zeitlichkeit.
Doch trotz dieser Augenscheinlichkeiten ist die theoretische Aufspaltung
des Bildphänomens keineswegs unproblematisch. Mit ihr gehen vielmehr
zahlreiche Risiken einher. Nicht nur, dass im Gewand der Dichotomie von
bildlicher Erscheinung und physischem Bildträger häufig alte Polaritäten wie
jene von Stoff und Form wiederkehren;10 auch ist nicht klar, ob diese ›nur
heuristische‹ Unterscheidung zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt ohne
Verlust wieder aufgehoben werden kann. So hat man durch die Beschreibung
der beiden Pole – hier der verdinglichte Bildträger, dort eine körperlose
Bilderscheinung – deren Zusammenhang eher aufgelöst als erfasst. Zudem
resultiert daraus häufig die Konstruktion eines ›Weltendualismus‹:11 Es geht
um die Behauptung zweier verschiedener Welten, insofern das Abbild aus
7
8
9
10
11
Axel Müller: »Wie Bilder Sinn erzeugen. Plädoyer für eine andere Bildgeschichte«, in: Stefan Majetschak (Hg.): Bild-Zeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild, München
2005, S. 77−96, hier: S. 83−84.
Hippolyte Taine: Der Verstand, Bd. 1, Bonn 1880 [zuerst Paris 1870], S. 79.
Der Gedanke einer ›inneren Doppelheit‹ findet sich bei so unterschiedlichen Autoren wie
Edmund Husserl, Richard Wollheim, Hans Belting, Hans Jonas und Reinhard Brandt. Bei
allen lassen sich jeweils eigene Varianten dieser theoretischen Figur feststellen.
Siehe hierzu die kritischen Anmerkungen im Aufsatz von Emmanuel Alloa in diesem
Band.
Vgl. Sybille Krämer: »Sprache – Stimme – Schrift. Sieben Gedanken über Performativität
als Medialität«, in: Uwe Wirth (Hg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und
Kulturwissenschaften, Frankfurt / M. 2002, S. 323−346, hier: S. 324.
�Körperlose Anwesenheit?
89
seinen irdischen Zusammenhängen gelöst und einer prinzipiell anderen,
eigenen Sphäre zugewiesen wird.
Zugleich fällt auf: Die Annahme einer internen Teilung des Bildes geht
häufig nicht mit einer Neutralität gegenüber beiden Polen der Differenz
einher. Stattdessen wird vor allem die Seite der Darstellung priorisiert.
Die Reflexionsfigur der ›inneren Duplizität‹ ist in den meisten Fällen mit
einer Hierarchisierung verbunden. In ihrer Dichotomie sind die beiden
Pole stets schon in einem Ungleichgewicht; die Waage schlägt zugunsten
dessen aus, was nicht physisches Bildding oder Medium, sondern darin
Sichtbargemachtes ist. Konsequenz dieser einseitigen Fokussierung ist in der
Regel eine auf je eigene Weise vollzogene Depravierung der Materialität.
Daraus aber resultiert ein bemerkenswerter Effekt, insofern die anfänglich
als konstitutiv behauptete ›Doppel-heit‹ des Bildes nachträglich annulliert
wird; sie erlischt gewissermaßen infolge der Tilgung jener Momente des
Bildes, die nicht in der Darstellungsfunktion aufgehen. Dieses ›Erlöschen‹
meint folglich keine dialektische Aufhebung, sondern schlicht und ergreifend die Negation der Materialität des Bildes.
Eine solche Ignoranz gegenüber materiellen Aspekten wird in der gegenwärtigen Bilddebatte in der Regel vor allem hermeneutischen und
semiotischen Ansätzen unterstellt. Dieser Vorwurf ist – wenn auch nicht
in Gänze12 – durchaus berechtigt. In der Tat neigt die semiotische und
hermeneutische Tradition für gewöhnlich dazu, Materialität zugunsten
immaterieller Bedeutungseinheiten zu marginalisieren. Die Materialität des
Bildes spielt für sie nur insoweit eine Rolle, wie sie zur Übermittlung und
Deutung von Sinngehalten dient.13 Zum Tragen kommt hier ein grundlegend
»metaphysische[r] Gestus«, der sich auf jene immateriellen Bedeutungen
richtet, die »hinter dem Gegebenen einer Erscheinung« liegen.14
Die nachstehenden Ausführungen werden die begründete Kritik am
Interpretationismus hermeneutischer und semiotischer Theorieentwürfe
nicht weiter vertiefen. Stattdessen wollen sie zeigen, dass die zu beklagende
12
13
14
Vgl. Mark A. Halawa: »Widerständigkeit als Quellpunkt der Semiose. Materialität, Präsenz
und Ereignis in der Semiotik von C. S. Peirce«, in: Kodikas / Code – Ars Semeiotica. An
International Journal of Semiotics, Bd. 32, Nr. 1−2, 2009, S. 11−24.
Exemplarisch hierfür ist Karl Bühlers Begriff der abstraktiven Relevanz. In seiner Sprachtheorie machte Bühler das gezielte Absehen von solchen Materialitätsaspekten, die nicht
in eine signifikative Funktion überführt werden können, zum methodischen Prinzip. Vgl.
ders.: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Stuttgart 1999 [zuerst Jena
1934], S. 40−48. Das Prinzip der abstraktiven Relevanz findet in der zeitgenössischen
Bildtheorie kaum Erwähnung. Wie sich in diesem Aufsatz zeigen wird, lässt sich sein
›Geist‹ indessen nicht nur auch außerhalb von semiotischen Bildtheorien wiederfinden;
vielmehr wird das Prinzip der abstraktiven Relevanz mitunter gerade von dezidiert nichtsemiotischen Bildkonzeptionen deutlich radikalisiert und übertroffen.
Sybille Krämer: Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt / M. 2008, S. 25, 26 [unsere Hervorhebung].
�90
Marcel Finke / Mark A. Halawa
›Materialitätsvergessenheit‹ ein Motiv darstellt, das auch in anderen Ansätzen wirksam ist. Sie lässt sich sogar in dezidiert phänomenologischen
Bildtheorien nachweisen, die gemeinhin mit dem Anspruch verknüpft
werden, materielle Aspekte des Bildes stärker zu berücksichtigen.
Zur Verdeutlichung dieser These sollen einige der bisherigen Feststellungen anhand von Lambert Wiesings Theorie der reinen Sichtbarkeit des
Bildes veranschaulicht werden. In seinem Versuch, den »ontologischen
Sonderstatus des Bildes«15 gegenüber anderen wahrnehmbaren Dingen
herauszuarbeiten, greift auch er auf die Gedankenfigur der internen Duplizität zurück. Wie gezeigt werden soll, gehen Wiesings Bemühungen mit
einer systematischen Ausblendung der Materialität des Bildes einher, die
sich auf verschiedenen Ebenen seiner Argumentation nachweisen lässt. In
einem ersten Schritt wird dargelegt, inwiefern der Autor eine Purifizierung
des Bildes vornimmt und dieses zu einer Art immakulaten Entität verklärt.
Darauf folgt eine Problematisierung von Wiesings Thesen zur spezifischen
Wahrnehmungssituation, in die die Betrachtenden eines Bildes angeblich
eintreten. In Kritik gerät vor allem die vollständige theoretische Entkörperung der Rezipierenden, die aus dem Konzept der reinen Sichtbarkeit
resultiert und nicht zuletzt phänomenologisch höchst fragwürdig ist.
2. Reine Sichtbarkeit: Immaterialität des Bildobjekts?
Lambert Wiesing vertritt einen wahrnehmungstheoretischen Ansatz, dessen
historische Grundlagen systematisch zuerst in seinem Buch Die Sichtbarkeit des Bildes vorgestellt und seither in zahlreichen Publikationen weiter
ausgearbeitet wurden.16 Wiesing teilt die Prämisse der inneren Doppelheit
des Bildes, welcher er mit dem von Husserl entlehnten Begriffspaar Bildträger und Bildobjekt Rechnung trägt. Der Fokus seiner Überlegungen
liegt allerdings auf der Bestimmung der wesenhaften Eigenschaften des
immateriellen Bildobjekts, das seines Erachtens auf andere Weise anwesend ist als alle sonstigen Wahrnehmungsdinge. Mit dem Bildobjekt werde
ein »künstlich präsentierter Gegenstand«17 vor Augen gestellt, der »nicht
richtig gegenwärtig, sondern eben nur artifiziell präsent ist, das heißt
15
16
17
Lambert Wiesing: Die Sichtbarkeit des Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen
Ästhetik, Frankfurt / New York 2008 [zuerst Reinbek bei Hamburg 1997], S. 163; ders.:
Das Mich der Wahrnehmung: Eine Autopsie, Frankfurt / M. 2009, S. 201, 206.
Vgl. Wiesing 2008 (wie Anm. 15). Vgl. ferner ders.: Phänomene im Bild, München 2000;
ders.: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt / M. 2005; ders.
2009 (wie Anm. 15).
Lambert Wiesing: »Pragmatismus und Performativität des Bildes«, in: Sybille Krämer (Hg.):
Performativität und Medialität, München 2004, S. 115−128, hier: S. 119.
�Körperlose Anwesenheit?
91
Abb. 1 John Deakin: Porträt Peter Lacy, zirka 1959, Arbeitsdokument aus dem
Atelier Francis Bacons, S/W-Fotografie, 24,8 x 18,5 cm, Dublin City Gallery
The Hugh Lane.
reduziert auf die Sichtbarkeit.«18 Nach Wiesing ergibt sich die Singularität des Bildobjekts mithin aus dem Umstand, dass dieses ausschließlich
gesehen werden könne. Es weise nur eine einzige sinnlich wahrnehmbare
Eigenschaft auf, welche als reine Sichtbarkeit bezeichnet wird.19 Wie
aber kann man sich die bildliche Herstellung von bloßer Sichtbarkeit
vorstellen? Nach Wiesings Dafürhalten erlauben es Bilder, Sichtbarkeit
als solche zu isolieren, ja Bildlichkeit selbst könne als Resultat dieses
Isolationsvorgangs angesehen werden.20 Mit der »Abspaltung und Verabsolutierung der Sichtbarkeit«21 ist aber letztlich nichts anderes gemeint
als ein Prozess der Entkörperung. Entsprechend hält Wiesing fest: »Bilder
sind Entmaterialisierungen, welche einen Gegenstand in reine Sichtbarkeit
transformieren.«22
18
19
20
21
22
Wiesing 2005 (wie Anm. 16), S. 70.
In Wiesings jüngster Monografie Das Mich der Wahrnehmung fällt auf, dass die Trope
von der ›reinen Sichtbarkeit‹ weitgehend durch den Begriff der ›Nursichtbarkeit‹ ersetzt
wurde. Vgl. Wiesing 2009 (wie Anm. 15).
Vgl. Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. 15, 161−163.
Ebd., S. 163.
Ebd., S. 15.
�92
Marcel Finke / Mark A. Halawa
Die These von der Entmaterialisierung beschränkt sich unterdessen nicht
auf die Aussage, dass ein abgebildetes Ding andere physikalische Eigenschaften aufweist als das in Raum und Zeit real anwesende empirische Ding.
Wiesing geht noch einen Schritt weiter: Bildobjekte haben seiner Meinung
nach per se gar »keine Materialität und damit auch keine physikalischen
Eigenschaften«.23 Das im Bild sichtbar gemachte Ding weist demgemäß
nicht andere physikalische Merkmale auf, sondern überhaupt keine. Wiesings Rede von der Entmaterialisierung ist nicht metaphorischer, sondern
buchstäblicher (und: kategorischer) Natur. Von »reiner Sichtbarkeit« kann
seiner Ansicht nach schon darum gesprochen werden, weil sich auf »einer
Bildoberfläche […] die Sichtbarkeit von etwas ohne den Ballast einer anwesenden, anhängenden Substanz«24 finden lasse. Der Gedanke einer für
die Konstitution von Bildlichkeit wesentlichen Entmaterialisierung ist bei
Wiesing deshalb aufs Engste mit der Behauptung einer Substanzlosigkeit
des Bildobjekts verknüpft. Diese These besagt, dass das Bildobjekt wie ein
»Gespenst« anwesend ist, ohne eine »materielle Substanz« aufzuweisen.25
Der behauptete »prinzipielle Phantomcharakter«26 resultiert allerdings
nicht nur aus der fundamentalen Substanzlosigkeit der im Bild anschaulichen Erscheinung. Vielmehr ergibt sich gerade daraus ein noch häufiger
genanntes Charakteristikum des Bildobjekts: seine Physikfreiheit. Weil
Bilder für Wiesing »Entmaterialisierungsinstrument[e]«27 sind, gelten sie
ihm als »Physikentmachtungsmittel«28.
In dem Maße, wie die These der Entmaterialisierung zur Idee der
generellen Substanzlosigkeit des Bildobjekts zugespitzt wird, erfährt auch
der Gedanke von der Physiklosigkeit eine zunehmende Radikalisierung.
Im Folgenden skizzieren wir diesen Gedanken in seinen wesentlichen
Schritten: Ausgangspunkt ist Wiesings Bemerkung, das Bild stelle seinen
Betrachtenden etwas vor Augen, »ohne daß das vorgestellte Etwas physisch
da ist«.29 Das Bildobjekt sei »stofflich nicht anwesend«, habe also »kein
physisches Dasein«.30 Hier geht es zunächst um die simple Feststellung,
dass die im Bild sichtbar werdende Erscheinung – im Gegensatz zum empirischen Bildträger – nicht materiell gegenwärtig ist. Darüber hinaus hebt
23
24
25
26
27
28
29
30
Lambert Wiesing: »Das Bild aus phänomenologischer Sicht. Interview mit Lambert Wiesing«, in: Klaus Sachs-Hombach (Hg.): Wege zur Bildwissenschaft. Interviews, Köln 2004,
S. 152−169, hier: S. 162.
Wiesing 2000 (wie Anm. 16), S. 11.
Vgl. Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. 162; ders. 2004 (wie Anm. 17), S. 120; ders. 2005
(wie Anm. 16), S. 32.
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 204, 224.
Wiesing 2000 (wie Anm. 16), S. 24.
Wiesing 2005 (wie Anm. 16), S. 162.
Ebd., S. 69.
Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. VII; ders. 2005 (wie Anm. 16), S. 161.
�Körperlose Anwesenheit?
93
Wiesing hervor, dass das Bildobjekt »in einem physikalischen Sinn kein
materieller Gegenstand in Raum und Zeit«31 sei. Eine vermittels des Bildes
artifiziell präsentierte Person ist demnach von grundsätzlich anderer Art
als der reale Körper dieser Person; der im Bild lediglich sichtbare Körper
hat per se keine Physis.
In seinen Ausführungen zur Physiklosigkeit des Bildes geht Wiesing
jedoch noch einige entscheidende Schritte weiter: Bisher ging es ausschließlich um das, was das Bild zeigt. Dieses dargestellte Etwas (zum Beispiel
der im Foto anschaulich gemachte Körper Peters; Abb. 1) wurde als
nicht physisch anwesend, ohne eigene Physis und von den physikalischen
Zwängen der Naturgesetze entbunden charakterisiert. Die hier zur Sprache
kommende Physikfreiheit wird von Wiesing nun aber auch in toto auf das
Bildobjekt, d. h. auf das Anschauungsphänomen eigener Art, ausgeweitet.
Die These betrifft nicht mehr nur das, was im Bild sichtbar gemacht wird,
sondern auch die Art und Weise des Gegenwärtigseins des Bildobjekts an
sich, kurz: dessen »Daseinsstil«32. Wiesing behauptet, dass die ontologisch
»autonome[n] Dinge«, die auf einem Bild zum Vorschein kommen, in
ihrer phänomenalen Gesamtheit »der physikalischen Wirklichkeit perfekt
entrückt« seien.33 Nun macht es aber einen qualitativen Unterschied, ob
man behauptet, der in einem Bild artifiziell präsente Körper (das Was
des Bildobjekts) sei ein »Gegenstand ohne Physik«34, oder ob man meint,
die Erscheinung des Bildobjekts als solche sei gänzlich vom »Diktat der
Physik«35 befreit. Letzteres aber scheint von Wiesing nahegelegt zu werden.
Was sich in den Thesen von der Entmaterialisierung, der reinen Sichtbarkeit
sowie der Substanzlosigkeit bereits abzeichnete, kulminiert in der Kennzeichnung der Darstellung als eines Bereichs, der nicht Bestandteil unserer
Welt sei und dem grundsätzlich »keine physikalische Weltenschwere«36
anhafte. »Schaut man auf ein physisch existentes Bild«, erklärt Wiesing in
diesem Zusammenhang, »so schaut man doch in eine physikfreie Zone«.37
Diese Rede vom Bildobjekt als einer »physikfreien Zone« kann durchaus
in ihrer radikalsten Lesart ausgelegt werden: Der von Wiesing anfänglich
noch als unverzichtbar bezeichnete Bildträger, durch den das Bildobjekt
allererst zu seiner sichtbaren Erscheinung kommt, ist als materieller Grund
durchgestrichen; das Bildobjekt hingegen ist theoretisch freigesetzt, von
31
32
33
34
35
36
37
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 202.
Ebd., S. 204.
Wiesing 2005 (wie Anm. 16), S. 161 [unsere Hervorhebung].
Wiesing 2000 (wie Anm. 16), S. 110.
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 219.
Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. VIII.
Wiesing 2000 (wie Anm. 16), S. 10. Ähnlich auch ders. 2005 (wie Anm. 16), S. 69; ders.
2009 (wie Anm. 15), S. 204.
�94
Marcel Finke / Mark A. Halawa
allen Zwängen der materiellen Welt entbunden und endgültig zur reinen
Sichtbarkeit hypostasiert.
Wenn ein Bildobjekt nach Wiesing aber ausschließlich sichtbar, ohne
materielle Substanz und von den Gesetzen der Physik befreit ist, dann ist
es nur folgerichtig, dass es sich seiner Meinung nach auch anders verhält
als die realen Gegenstände unserer Umgebung. Um dies zu verdeutlichen,
greift er auf ein Beispiel zurück, in dem es um die Wechselwirkung zwischen dem physischen Zustand eines Bildes und dem Aussehen der darin
sichtbar werdenden Erscheinung geht. Abermals sieht man sich mit der
Zuspitzung eines zu Beginn einleuchtenden Argumentes konfrontiert. Wiesing beschreibt zunächst einen vertrauten Sachverhalt:
Wenn man es mit dem Bild eines Hauses zu tun hat, dann ist dieses ausschließlich sichtbare Haus den Gesetzen der Physik enthoben. Diese Darstellung des
Hauses wird insofern nicht älter, als das gezeigte Haus nicht älter wird, auch
wenn der Bildträger sehr wohl wie jeder andere physikalische Gegenstand in
Raum und Zeit älter wird.38
Sowohl die Idee der Physikfreiheit als auch der Gedanke, dass das artifiziell
präsente Objekt nicht gleichermaßen einer altersbedingten Veränderung
unterworfen sei wie der materielle Bildträger, beziehen sich erneut auf das
Was der Darstellung. Ersetzt man im Zitat das »Haus« durch »Peter«,
dann wird leichter verständlich, worauf Wiesing abzielt: Ein Fotoabzug,
der die Darstellung eines 43-jährigen Peters zeigt, wird auch nach Jahrhunderten den damals 43 Jahre alten Peter zeigen – und zwar selbst dann, wenn
der gealterte Abzug selbst schon zerschlissen und der reale Peter längst
verstorben ist (Abb. 1).39 Dies möchte wohl niemand bezweifeln. Doch
Wiesing verallgemeinert dieses Argument erneut, indem er nicht nur das
sichtbar gemachte Etwas (ein dargestelltes Haus, den dargestellten Peter)
vom zeitlichen Wandel ausnimmt, sondern die Erscheinung des Bildobjekts
an sich. Was im Folgenden ähnlich wie die vorhergehende Passage klingt,
ist in seiner theoretischen Konsequenz wesentlich radikaler:
Alles, was wahrgenommen wird, ist […] ein alterndes Objekt zu einem bestimmten Zeitpunkt – nur das Bildobjekt nicht! Im Gegensatz zum Bildträger verändert
sich ein Bildobjekt nicht in der Zeit: es wird nicht älter. [… Das] Bildobjekt muss
morgen so aussehen, wie es heute aussieht, um ein Bildobjekt zu sein.40
38
39
40
Wiesing 2005 (wie Anm. 16), S. 28. Vgl. ähnlich auch ders. 2000 (wie Anm. 16), S. 33,
145.
Vgl. Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 204.
Ebd., S. 221−222.
�Körperlose Anwesenheit?
95
An dieser Stelle ist es nicht mehr nur das Was, sondern auch das Wie der
sichtbaren Beschaffenheit des Bildobjekts, welches von den Veränderungen
des physischen Bildträgers unberührt bleibt. Wiesing insistiert geradezu darauf, dass »die Zeit in ihren Alterswirkungen am Aussehen des physikfreien
Bildobjekts vorbeigeht«.41 Wohlgemerkt ist das Aussehen des Bildobjekts,
d. h. die Weise, in der es den Betrachtenden anschaulich erscheint, dessen
einzige Eigenschaft. Nichts anderes besagt Wiesings These von der reinen
Sichtbarkeit! Wovon aber hängt die jeweilige Erscheinung eines Bildobjekts
ab, wenn nicht von den medialen Grundlagen seiner Hervorbringung? Es
stellt sich daher die Frage, weshalb Wiesing behaupten kann, dass das
Aussehen der Darstellung von den Veränderungen des Bildträgers nicht
tangiert wird – oder noch drastischer: nicht tangiert werden kann.
Eine mögliche Antwort darauf mag in Lambert Wiesings Neigung zu
finden sein, das Wie des Bildobjekts auf den Stil, d. h. die formalen Relationen einer strukturierten Oberfläche, zu reduzieren. Der Stil (oder auch:
die Sichtweise) gilt ihm als fundamentale Bedingung und »transzendentales
Prinzip der Bildlichkeit«42. Es gibt demzufolge kein Bild ohne Stil, weil es
kein Bildobjekt ohne das Wie seiner nursichtbaren Erscheinung geben kann.
Dass Wiesing dem Stil große Beachtung schenkt, ist von daher vollkommen verständlich. Doch ist der Stil für ihn offensichtlich noch aus einem
anderen Grund besonders interessant: Seines Erachtens ist dieser ebenfalls
ausschließlich sichtbar, weshalb er sich problemlos in die These der reinen
Sichtbarkeit des Bildobjekts einfügen lässt. Das Wie der Erscheinung des
Bildobjekts betrifft bei Wiesing hauptsächlich formale Aspekte, die sich
auf der Oberfläche des Bildes lokalisieren lassen.43 Letztere wird ihm zum
einzigen Ort von Bedeutung. Dem wiederum entspricht, dass Wiesing den
materiellen Bildträger gelegentlich auf die Bildoberfläche, d. h. auf die
»›anfaßbare‹ Außenseite eines physischen Objekts«44, reduziert. Demnach
spielt nicht die gesamte Physis des Bildes eine Rolle. An ihr ist lediglich von
Belang, dass sie eine Oberfläche erzeugt, auf der etwas anderes, nämlich
das Bildobjekt, erscheinen kann. Als Resultat schrumpft der Bildträger
zur buchstäblichen Flachware. So wie zuvor die Wirklichkeit »durch ein
Bild gehäutet«45 wurde, so wird nun auch der materielle Körper des Bildes
(tableau) auf seine Außenhaut limitiert. Er wird auf seine plane Vorderseite beschränkt, auf der ein Bildobjekt von reiner Sichtbarkeit artifiziell
41
42
43
44
45
Ebd., S. 222 [unsere Hervorhebung].
Wiesing 2000 (wie Anm. 16), S. 57. Vgl. auch ders.: »Zur Rhetorik des Bildes«, in: Joachim
Knape (Hg.): Bildrhetorik, Baden-Baden 2007, S. 37−48, hier: S. 37.
Vgl. Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. 217, 223, 231; ders. 2000 (wie Anm. 16), S. 16;
ders. 2007 (wie Anm. 42), S. 39
Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. 214.
Ebd., S. 162.
�96
Marcel Finke / Mark A. Halawa
hergezeigt wird. Das Bildobjekt, heißt es passend dazu, »wird sozusagen
durch das Bild wie auf einem Tablett präsentiert.«46
Nach Wiesing ist das ausschließlich sichtbare Bildobjekt der Oberflächeneffekt einer ebenfalls ausschließlich sichtbaren Infrastruktur. Er stellt damit
freilich nicht in Frage, dass sich etwa der Zustand eines Fotoabzugs mit der
Zeit wandeln kann. Doch werden mögliche Veränderungen wie das Wellen
oder Aufreißen des Papiers, das Ausbleichen, Eintrüben oder Abblättern
der Farbe, die Knitter oder Kratzer in der Bildoberfläche als dem Bildobjekt äußerlich gedacht. Aus Wiesings Perspektive sind solche materiellen
Transformationen lediglich bedauernswerte Störungen, die das ›eigentliche‹
Aussehen des Bildobjekts, d. h. sein stilistisches Wie, nicht betreffen.
Doch so wenig man ein Bild ohne Stil herstellen kann, so wenig kann
ein Bild ausschließlich aus Stil gemacht sein. Auch dieser muss in der Materialität des Bildes einen ›Anhalt‹ finden; ebenso müssen sich die formalen
Strukturen im Bild verkörpern, um in dessen Oberfläche etwas anderes
(zum Beispiel das Antlitz von Peter) sichtbar werden zu lassen (Abb. 1).
Veränderungen des Bildträgers wirken sich deshalb unumgänglich auf das
Aussehen des Bildobjekts aus, gerade weil dieses kein ideales eidos ist,
sondern eine je spezifische Erscheinung. Für Wiesings Argumentation ist
es symptomatisch, diesen Zusammenhang zu negieren.
Was sich in Wiesings Thesen und der Entwicklung seiner Argumentation beobachten lässt, ist eine zunehmende Purifizierung des Bildobjekts.
Dessen Sichtbarkeit wird sukzessive vom Schmutz jeder »physikalisch[en]
Weltenschwere«47 gesäubert, um im Glanz einer reinen Sichtbarkeit zu
erstrahlen.48 Mit hygienischem Gestus vollzieht Wiesing als Philosoph somit das, was seiner Meinung nach das Bild selbst leistet. Durch eine Art
theoretischen Großputz wird das Bildobjekt zu einer immakulaten, der
Welt enthobenen Entität aufpoliert. Die damit verbundene Haltung könnte
man als eine Art optischen Platonismus bezeichnen. Während es bei Platon
das »Auge des Geistes«49 ist, das einen Blick auf ewige Ideen zu werfen
vermag, genügt bei Wiesing der Blick auf ein Bild, um unwandelbaren
metaphysischen Entitäten gewahr zu werden. Was im einen Fall mühsam
46
47
48
49
Wiesing 2004 (wie Anm. 23), S. 160.
Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. VIII.
Das Adjektiv »rein«, so erklärt Wiesing im Vorwort zur Neuauflage seines Buches Die
Sichtbarkeit des Bildes, sei für die Charakterisierung der besonderen Art der Sichtbarkeit
des Bildobjekts deshalb passend, weil seine Bedeutungen ebenfalls an Ausdrücke wie
»sauber« sowie »nicht dreckig« denken lassen. Vgl. Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. VII.
Noch in einem Interview aus dem Jahr 2005 hatte er allerdings das Gegenteil betont. Vgl.
ders.: »Ornament, Diagramm, Computerbild – Phänomene des Übergangs. Ein Gespräch
mit Lambert Wiesing«, in: Bildwelten des Wissens, Bd. 3.1, Berlin 2005, S. 115−128, hier:
S. 115.
Symposion, 219a.
�Körperlose Anwesenheit?
97
durch kontemplative Vernunft erarbeitet werden muss, stellt sich im anderen Fall mühelos dadurch ein, dass man seine Augen auf ein Bildobjekt
richtet. Damit ist aber zugleich die problematische Tendenz verbunden, die
angeblich ausschließliche Sichtbarkeit des Bildobjekts in der Vorstellung
eines bildlichen Panoptismus gipfeln zu lassen. Demzufolge wäre alles, was
für das Bild von Bedeutung ist, auch auf diesem positiv sichtbar. Alles läge
gleichsam ohne Rückstand vor Augen, wäre ›offen-sichtlich‹. Denn da, wo
es reine Sichtbarkeit gibt, kann sich im Grunde nichts verbergen. Eine solche
Totalisierung der Sichtbarkeit im Bild schließt jedoch die Möglichkeit aus,
dass es relevante Aspekte des Ikonischen gibt, die sich nicht direkt oder auch
gar nicht sehen lassen.50 Die Säuberung und Idealisierung des Bildobjekts
zu einer Entität von absoluter visueller Reinheit drohte letztlich mit dem
Phantasma des allmächtigen Blicks kurzgeschlossen zu werden.51
3. Optische Entindividualisierung:
artifizielle Weltflucht des Bildbetrachters?
In unseren bisherigen Darlegungen wurde lediglich am Rande erwähnt,
dass sich Lambert Wiesing in seiner bildtheoretischen Arbeit der phänomenologischen Theorietradition eng verbunden fühlt. Tatsächlich trugen
nahezu alle Autoren, die er zur Unterstützung seiner Argumentation
heranzieht, entscheidend dazu bei, die Phänomenologie als eigenständige
philosophische Methode zu begründen und zu positionieren.52 Somit
überrascht es nicht, dass Wiesing das ausdrückliche Ziel verfolgt, »die
Stärke der phänomenologischen Philosophie zur Erforschung des Bildes
dar[zu]stellen und [zu] verteidigen.«53 Bedauerlicherweise mündet dieses
Vorhaben in ein nahezu dogmatisches Vertrauen in die bildtheoretische
Erklärungskraft der Phänomenologie. Seiner Ansicht nach hat diese allein
im Zentrum einer philosophischen Erörterung des Bildbegriffs zu stehen.
Dies legt nicht nur Wiesings Terminologie nahe; dafür spricht auch der
Umstand, dass er bei der Beschreibung der elementaren Bausteine einer
50
51
52
53
Zum Verhältnis von Bildlichkeit und (Un-)Sichtbarkeit am Beispiel des Mediums Film
siehe den Aufsatz von Ulrike Hanstein in diesem Band.
Für weitere Kritiken vgl. Ludger Schwarte: »Die Wahrheitsfähigkeit des Bildes«, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Heft 53/1, 2008, S. 107−123, bes.:
S. 110−113; Aneta Rostkowska: »Critique of Lambert Wiesing’s Phenomenological Theory
of Picture«, in: IMAGE. Zeitschrift für interdisziplinäre Bildwissenschaft, Nr. 10, Juli 2009;
Emmanuel Alloa: Das durchscheinende Bild. Konturen einer medialen Phänomenologie,
Berlin / Zürich 2011, S. 265−271.
Vgl. dazu Wiesing 2000 (wie Anm. 16), Kap. III und IV, wo die bildtheoretische Bedeutung
Husserls, Sartres und Merleau-Pontys diskutiert wird.
Ebd., S. 7.
�98
Marcel Finke / Mark A. Halawa
philosophischen Theorie des Bildes konsequent auf phänomenologische
Gedankenmotive zurückgreift.54 Zwar nimmt Wiesing die Positionen und
Methoden anderer theoretischer Strömungen durchaus zur Kenntnis,
doch resultiert dies zumeist in einer Zurückweisung konkurrierender
Bildkonzeptionen.55 Die Phänomenologie wird dadurch zur bildtheoretischen Leitdisziplin erklärt: nur sie scheint dazu in der Lage zu sein, die
konstitutiven Merkmale von Bildlichkeit zu enthüllen.
Nun ist die bildtheoretische Fruchtbarkeit der Phänomenologie kaum
zu bezweifeln. Besonders in der Auseinandersetzung mit der Gegebenheitsweise von Bildern betritt man nahezu unumgänglich phänomenologisches
Forschungsterrain.56 Wiesings Positionierung ist insofern überaus verständlich. Gleichwohl sind die Konsequenzen, die er aus der phänomenlogischen Fundierung seiner Bildtheorie zieht, mindestens aus zwei Gründen
problematisch: Zum einen zeigte sich bereits, dass die Idee der reinen
Sichtbarkeit mitsamt ihrer Privilegierung des vermeintlich körperlosen
Bildobjekts die Relevanz der Materialität des Bildes in extremer Weise
negiert. Zum anderen lässt sich darüber hinaus feststellen, dass mit der
Hypostasierung der mutmaßlichen Nursichtbarkeit des Bildobjekts eine
Abkehr von zentralen leibphänomenologischen Grundsätzen einhergeht.
Ironischerweise wohnt dem als dezidiert phänomenologisch propagierten
Topos der reinen Sichtbarkeit – wenn auch ungewollt – eine gegenläufige
Dialektik inne. Um diesen Kritikpunkt näher auszuführen, konzentrieren
wir uns nun auf die Instanz des bildbetrachtenden Subjekts und das damit
verbundene Problem der Bildwahrnehmung.
Grundsätzlich diskutiert Wiesing nicht nur die Immaterialität des ausschließlich sichtbaren Bildobjekts, sondern auch die Erfahrungsmomente,
die bei der Wahrnehmung dieses Objekts zum Tragen kommen. Insbesondere
denkt er darüber nach, welche notwendigen Auswirkungen die Betrachtung
eines Bildes auf ein wahrnehmendes Subjekt hat: »Was geschieht mir, wenn
ich ein Bild sehe«, lautet die entsprechende Leitfrage.57 Die Beschreibung
54
55
56
57
So wird die oben diskutierte Fixierung auf das Moment des Stils vor allem in Rekurs auf
Merleau-Ponty entwickelt. Vgl. Wiesing 2008 (wie Anm. 15), Kap. V; ders. 2000 (wie
Anm. 16), Kap. IV.
Vgl. Wiesing 2005 (wie Anm. 16), Kap. 2.
Vgl. etwa Husserl 1904/05 (wie Anm. 5); Jean-Paul Sartre: Was ist Literatur? Ein Essay,
Reinbek bei Hamburg 1967 [zuerst Paris 1947]; ders.: Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Einbildungskraft, Reinbek bei Hamburg 1971 [zuerst Paris 1940];
Maurice Merleau-Ponty: »Der Zweifel Cézannes« (1947), in: ders.: Das Auge und der
Geist. Philosophische Essays, hg. v. Christian Bermes, Hamburg 2003, S. 3−27; ders.: »Das
Auge und der Geist« (1961), in: ebd., S. 275−317. Von den neueren phänomenologischen
Beiträgen zur Bildtheorie vgl. v. a. Bernhard Waldenfels: Sinne und Künste im Wechselspiel.
Modi ästhetischer Erfahrung, Berlin 2010.
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 210.
�Körperlose Anwesenheit?
99
der ontologischen Besonderheit des Bildes wird auf diese Weise durch die
phänomenologische Rekonstruktion einer spezifischen Wahrnehmungssituation ergänzt.58 Beide Aspekte greifen für Wiesing ineinander; seiner
Ansicht nach können sie erst in der Zusammenschau die Faszinationskraft
des Bildes erklären. Möchte man die Entwicklung von Wiesings Denken
indes präziser beschreiben, muss man eigentlich festhalten: Seine Überlegungen zur Seinsweise des Bildobjekts münden letztendlich in eine Theorie
der perzeptuellen Folgen einer reinen Bildobjekt-Wahrnehmung.
Wiesings Argumentation ist in diesem Zusammenhang wie folgt: Wer
ein Bild sieht, erblickt seines Erachtens nicht nur ein besonderes Objekt,
sondern findet sich zugleich in einer besonderen Wahrnehmungssituation wieder. Diese charakterisiert Wiesing ausdrücklich als perzeptuellen
»Ausnahmezustand«.59 Wichtig ist an dieser Stelle, dass damit nicht erneut
der vertraute Gedanke einer ›gespaltenen‹ oder im Sinne Husserls ›widerstreitenden‹ Wahrnehmung angesprochen ist. Weniger ein spezieller Modus
der Wahrnehmung ist hier von Belang als das spezifische Verhältnis, in
dem ein Subjekt zur wahrgenommenen Welt steht. An Wiesings Versuch,
den »kategorial[en] Sonderfall«60 des Bildersehens von der normalen Gegenstandswahrnehmung abzusetzen, fällt zunächst der pejorative Ton auf,
mit dem letztere beschrieben wird: Skizziert wird ein düsteres Szenario der
gewöhnlichen Wahrnehmung, die für Wiesing mit allerlei »Zumutungen«
verbunden ist.61 Demgegenüber verspreche das Bildersehen eine einzigartige »entlastende Reduktion«62. Durch die Betrachtung eines Bildes ist
es Wiesing zufolge möglich, sich von wesentlichen Zumutungen, die gemeinhin mit der Wahrnehmung einhergehen, zu befreien.63 Entscheidend
ist hierbei, dass sich dieser Befreiungsgedanke ebenso wie im Falle der
ontologischen Eigentümlichkeit des Bildobjekts auf die Dimensionen von
Raum und Zeit erstreckt.
58
59
60
61
62
63
Vgl. ebd., S. 209−215.
Ebd., S. 199, 211.
Ebd., S. 200.
Vgl. ebd., S. 161−169. Wiesing führt zahlreiche »persönliche Zumutungen« und »fatale
Folgen« der normalen Wahrnehmungssituation auf. So werde das wahrnehmende Subjekt
etwa zu einem »leiblichen Dasein verurteilt«; es müsse deshalb mit einem Körper in der
Welt überleben, ein »Handykap«, das ihm ohne Wahrnehmung »erspart geblieben« wäre.
Die Wahrnehmenden unterlägen ferner dem »Schicksal der Weltenpartizipation« und seien
einer »anstrengenden Daueranwesenheit in der wahrgenommenen Welt« ausgesetzt. Die
Unabhängigkeit der Existenz der Welt vom wahrnehmenden Subjekt wie auch der Umstand, dass letzteres gleichfalls wahrnehmbar sei, werden als weitere Zumutungen genannt.
Außerdem wäre es aufgrund der Wahrnehmung leider keinem Subjekt möglich, »ein freies
sichtbares Sein, das nicht unter dem Diktat der Physik steht«, führen zu können. Vgl. ebd.,
S. 167, 169−172, 175, 183−187, 193, 213, 219.
Ebd., S. 215.
Vgl. ebd., S. 213.
�100
Marcel Finke / Mark A. Halawa
Die Idee eines zeitlichen Entlastungspotenzials wird von Wiesing mit
dem Fehlen eines privilegierten Zeitpunktes der Bildwahrnehmung begründet. Weil das Bildobjekt aufgrund seines zeitlosen Daseins von jeglichem
Wandel verschont bleibe, zeige es sich jedem Betrachtersubjekt wie auch
jeder künftigen Betrachtergeneration immerzu als dasselbe. Folgt man dieser
Argumentation, dann kann das Bildobjekt zu keinem Zeitpunkt ›anders‹
oder ›neu‹ erscheinen. Für Wiesing ergibt sich daraus eine unhintergehbare
egalitäre Optik:
Mein individueller Moment, in dem gerade ich das Bildobjekt gesehen habe,
sehe oder sehen werde, kann […] kein besonderer Moment sein, weil er sich
nicht von anderen Momenten unterscheidet. Wenn die Zeit in ihrer Alterungswirkung am Aussehen des physikfreien Bildobjekts vorbeigeht, läßt sich auf
Bildern zu verschiedenen Zeiten dasselbe sehen, und das sehende Subjekt wird
durch den Eintritt in den Zustand der Bildwahrnehmung zu einem Subjekt,
das das Bildobjekt zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt sieht – aber nicht zu
seinem Zeitpunkt […].64
Aus der ›chronischen‹ Makellosigkeit des Bildobjekts resultiert in temporaler Hinsicht folglich eine »optische Entindividualisierung des Subjekts«65.
Da nun alle möglichen Anschauungen eines Bildobjekts nach Wiesing
stets identisch sind, scheint auch jede individuelle Anschauung in einer
gewissen Beziehung zeitlos zu werden. Denn während sich unsere Welt
unablässig verändert, ermöglicht der Blick auf ein Bild laut Wiesing die
sonst unmögliche Erfahrung, eine Welt zu sehen, in der die Zeit eingefroren
ist.66 Die eigentliche Entlastung bestünde für das wahrnehmende Subjekt
von daher darin, dass es durch den Anblick eines Bildobjekts von dem
Zwang befreit wird, mit dem Wahrgenommenen in einem gemeinsamen
zeitlichen Kontinuum existieren zu müssen.
Einen egalisierenden Effekt diagnostiziert Wiesing zudem im Hinblick
auf die räumliche Dimension der postulierten entlastenden Reduktionsleistung der Bildwahrnehmung.67 Seines Erachtens gibt es grundsätzlich keine
privilegierte oder exklusive Perspektive auf ein Bildobjekt. Von welchem
Standort aus eine Person auch auf ein Bild blicken mag, niemals sei es ihr
möglich, eine ›andere‹, ›privatere‹ oder gar ›bessere‹ Ansicht eines Bildobjekts zu gewinnen als alle anderen Betrachtenden, die dasselbe Bildobjekt
64
65
66
67
Ebd., S. 222.
Ebd., S. 219.
Es verwundert deshalb nicht, dass Wiesing das Bild gelegentlich mit einem Kühlschrank
vergleicht oder anmerkt, es könne sogar »besser als jeder Kühlschrank hochverderbliche
Zustände und flüchtige Befindlichkeiten einfrieren […].« Wiesing 2005 (wie Anm. 16),
S. 113. Vgl. auch ebd., S. 159; ders. 2000 (wie Anm. 16), S. 19; ders. 2007 (wie Anm. 42),
S. 42.
Vgl. Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 220−221.
�Körperlose Anwesenheit?
101
von jeweils verschiedenen Blickpunkten aus in Augenschein nehmen. Im Gegensatz zur normalen Wahrnehmung fällt die persönliche Perspektivierung
des wahrnehmenden Subjekts beim Sehen eines Bildobjekts demnach aus.
Ein Bild weist den Betrachtenden gemäß der wiesingschen Wahrnehmungslogik durchweg einen egalitären »Standort der Ansicht zu – und zwar: jedem
denselben, keinem seinen eigenen, jedem meinen.«68 Da dementsprechend
keine »individuelle Verortung« stattfinde, sei es wiederum möglich, dass
alle Betrachtenden dasselbe im Bild wahrnehmen können.
Aus dieser angenommenen ›Einansichtigkeit‹ des Bildobjekts resultiert
schließlich eine »optische Entindividualisierung des Subjekts« in räumlicher Hinsicht. Ein Bild würde eine Person somit in die einzigartige Lage
versetzen, etwas aus einer nichtsubjektiven Perspektive wahrzunehmen, die
allen anderen Betrachtenden in absolut gleichem Maße zukommt. Was diese
gemeinsame Sichtweise auf das Bildobjekt betrifft, sind für Wiesing alle
Menschen gleich. Seiner Ansicht nach ergeben sich daraus für das wahrnehmende Subjekt angenehme, weil entlastende Folgen: Im Zustand der
Bildwahrnehmung könne dieses die sonst unmögliche Erfahrung machen,
etwas wahrzunehmen, ohne aber einen unteilbaren Ort in der Welt besetzen
zu müssen. Durch die Anschauung eines Bildobjekts werde das Subjekt
von der Zumutung befreit, immerzu durch einen eigenen Standpunkt von
anderen Subjekten differenziert (und damit: individuiert) zu sein.
Nach Wiesing führt die Wahrnehmung einer bildlichen Erscheinung
aber nicht nur zu einer ›optischen Entindividualisierung‹ in zeitlicher wie
räumlicher Hinsicht; sie macht das wahrnehmende Subjekt darüber hinaus zwangsläufig zu einem teilnahmslosen Zuschauer: Das Bildobjekt
wird »immer schon aus einer unbeteiligten Zuschauerposition heraus
gesehen«69, heißt es. Ein Wahrnehmungssubjekt nimmt demzufolge weder
eine individuelle Stelle innerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums ein noch ist
es als klar zu individuierendes Subjekt am Geschehen der wahrgenommen
Welt beteiligt. Es ist, cartesianisch gesprochen, ein substanzloses Nichts.
Im Unterschied zu einer normalen Situation ist der Wahrnehmungsraum
im Fall des Bildes deshalb auch kein Handlungsraum. Der Blick auf ein
Bildobjekt bleibt – in gewisser Weise für beide Seiten – grundsätzlich ohne
Konsequenzen, sodass der Akt des Wahrnehmens nicht zuletzt sämtliche
ethischen Dimensionen verliert.70 Fragen der Verantwortung stellen sich
in diesem Zusammenhang offenkundig nicht. Zugespitzter formuliert: Sie
können sich nicht stellen, weil der Zustand der Bildwahrnehmung bei Wie68
69
70
Ebd., S. 220.
Ebd., S. 223.
Hinsichtlich der ethischen Aspekte des Wahrnehmens vgl. Eva Schürmann: Sehen als Praxis.
Ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht, Frankfurt / M. 2008.
�102
Marcel Finke / Mark A. Halawa
sing durch eine prinzipielle Folgenlosigkeit charakterisiert ist. Aufgrund der
»kategorial[en] Kluft« zwischen dem Bildobjekt (nursichtbar, substanzlos,
physikfrei) und den Betrachtenden sei letzteren »eine wirklich unbedingte
Position der Sicherheit und absoluten Distanz« garantiert.71
Einer schwachen Version dieser These kann durchaus weitgehend zugestimmt werden. Ganz ohne Zweifel lassen sich bildlichen Erscheinungen,
die bedrohliche Wesen oder Ereignisse zeigen, »prinzipiell ohne jegliche
Gefahr für den Körper beobachten«72. Erhebliche Zweifel sind allerdings
gegenüber einer starken Version dieser These anzumelden. Diese Zweifel
beziehen sich auf die Behauptung, wonach die Betrachtenden im Rahmen
der Bildwahrnehmung von jeglicher Eingriffsmöglichkeit in das Wahrnehmungsgeschehen entlastet und insofern frei von jedweder Form der Verantwortung für die Folgen ihrer eigenen Wahrnehmungstätigkeit sind.
Wiesing versucht diesen Gedanken mit dem Begriff der »Partizipationspause«73 zu stützen. Auch hier gibt es eine schwache und eine starke Version
der These: Erstere zielt lediglich auf den Umstand, dass den Betrachtenden
die »leibliche Teilnahme am wahrgenommenen Geschehen«74 im Modus der
Bildwahrnehmung erspart bleibt. Schaut man sich zum Beispiel das Foto
einer Kriegsszene an, dann ist man mit seinem Körper nicht im bedrohlichen
Geschehen real gegenwärtig. Wesentlich drastischer und problematischer
ist hingegen die Aussage, dass eine Bildwahrnehmung nur dann gegeben
sei, wenn die übliche »Immersionsleistung der Wahrnehmung außer Kraft
gesetzt ist.«75 Hier scheint es nun, als würde ein Subjekt, das ein Bildobjekt wahrnimmt, von der Teilhabe am Wahrnehmungsgeschehen inklusive der damit einhergehenden stetigen Möglichkeit der Lokalisierbarkeit,
Ansprechbarkeit und Responsibilität vollständig ›erlöst‹. Derart von den
existenziellen Verpflichtungen des normalen Wahrnehmens entrückt, kann
es sich vollständig aus der Welt zurückziehen, um seinen Blick »vollkom-
71
72
73
74
75
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 218. Mit dieser Aussage klammert er nicht zuletzt die
ethischen Faktoren des Sehens aus, die in Jean-Paul Sartres Theorie des Blicks im Zentrum
stehen. Das Problem der Macht und Anerkennung stellt sich dem wiesingschen Wahrnehmungssubjekt im Modus der Bildwahrnehmung nicht. Wiesing propagiert auf diese Weise
eine abgeklärte bzw. technische Theorie der Bildwahrnehmung, die in ethischer Hinsicht
zu einer geradezu gleichgültigen oder gar zynischen Perspektive auf den Prozess des Bildersehens einlädt.
Ebd.
Vgl. vor allem ebd., S. 197−199. Von einer ›Partizipationspause‹ spricht Wiesing dann,
wenn eine Entlastung von den Zumutungen der Wahrnehmung unter den Bedingungen der
gegenständlichen Normalwahrnehmung stattfindet. Für andere Fälle der Unterbrechung
der Teilhabe an der realen Welt (z. B. Schlaf, Bewusstlosigkeit) verwendet er den nicht
minder kuriosen Ausdruck ›Partizipationsferien‹.
Ebd., S. 199.
Ebd., S. 213.
�Körperlose Anwesenheit?
103
men distanziert und gänzlich schamlos«76 auf ein metaphysisches Reich
der reinen Sichtbarkeit zu richten.
Wir haben gesehen, dass sich das als substanzlos und physikfrei beschriebene Bildobjekt in Wiesings Augen durch die »reduzierte ontologische
Existenz«77 eines nursichtbaren Seins auszeichnet. Wie sich nun zeigt, findet
diese Vorstellung eine Entsprechung auf Seiten der Betrachtenden. Dort
korrespondiert ihr die Fiktion eines nursehenden Daseins, d. h. die Idee
einer phänomenologisch reduzierten Existenz, in der das wahrnehmende
Subjekt von seiner »gnadenlosen persönlichen innerweltlichen Präsenzund Partizipationspflicht«78 vollends entbunden ist. Dem ontologischen
Konzept der reinen Sichtbarkeit wird somit das phänomenologische Konzept eines reinen Sehens hinzugefügt. Die Säuberung des Bildobjekts zu
einem körperlosen Phantom führt zum Phantasma vom Betrachtenden als
einem nahezu vollständig entleiblichten Augenwesen. In gewisser Weise
hat Wiesing diese Konsequenz – wenn auch unfreiwillig – selbst vorweggenommen:
Zur Wirklichkeit des Bildes gibt es nur einen Zugang: hinsehen. Die dargestellte
Welt eines Bildes entspricht der künstlichen Welt einer Person, die einzig über
den Sehsinn verfügt – die aber ansonsten taub, geruchlos, tastlos, geschmacklos
und orientierungslos ist. Darüber hinaus ist diese Person handlungsunfähig.79
Man könnte diese Passage durchaus als Fazit für Wiesings Bildtheorie
heranziehen. Dies ist einerseits äußerst bemerkenswert. Denn in seiner
Berufung auf das »Primat der Wahrnehmung« beharrt Wiesing nachdrücklich auf der Leiblichkeit des wahrnehmenden Subjekts. »Die raumzeitliche Körperlichkeit«, so schreibt er, sei für alle Wahrnehmenden »ein
notwendiges Daseinskleid«.80 Andererseits überrascht dieses Fazit keineswegs. So betont er mehrfach, dass die Leiblichkeit eine »sichere Folge
der Wirklichkeit meiner Wahrnehmung«81 sei. Weil aber die Wirklichkeit
der Wahrnehmung eines Bildobjektes (nursichtbar, substanzlos, physikfrei)
eine prinzipiell andere ist als jene der realen Welt, ist es nur konsequent,
wenn Wiesing sie mit »grundlegend anderen Folgen für das Subjekt«82
verbindet. Doch führt dies letztlich dazu, dass die Purifizierung des Bildobjekts in einer Purifizierung des Wahrnehmungssubjekts kulminiert. Als
76
77
78
79
80
81
82
Ebd., S. 223.
Ebd., S. 224.
Ebd., S. 124.
Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. 162. Wiesing befasst sich in diesem Textabschnitt mit
Konrad Fiedler. Die zitierte Stelle bezieht sich auf Fiedlers Gedanken zur bildlichen Isolierung von Sichtbarkeit und der damit verbundenen Entmachtung der Wirklichkeit.
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 168.
Ebd., S. 167. Vgl. auch ebd., S. 188, 191.
Ebd., S. 201.
�104
Marcel Finke / Mark A. Halawa
ein Wesen, das durch den Effekt der optischen Entindividualisierung seine
raum-zeitliche Teilhabe am ›zumutungsreichen‹ Weltgeschehen kurzzeitig
von sich abstreifen kann, nimmt das Subjekt der Bildwahrnehmung eine
schwerelose, geradezu ›entkörperlichte‹ Daseinsform an.83
Wiesings auf die Ontologie des Bildobjekts bezogener optischer Platonismus mündet auf diese Weise in einen optischen Cartesianismus, von
dem Descartes selbst wohl niemals zu träumen gewagt hätte.84 Während
Descartes (ähnlich wie Platon) den beschwerlichen Gang der Meditation
gehen musste, um das rein Geistige vom Körperlichen sondern zu können,85
befreit sich das wiesingsche Wahrnehmungssubjekt durch den schlichten
Blick auf ein Bild von der leiblichen Zumutungslast seines gewöhnlichen
Wahrnehmungslebens.
Dieser visuell vollzogene Befreiungsakt geht für Wiesing sogar so weit,
dass das Wahrnehmungssubjekt im Prozess der Bildwahrnehmung buchstäblich (nicht metaphorisch!) im Verschwinden begriffen ist. Die Logik
dieses Gedankens ist wie folgt: Was weder eine individuelle Raumposition
noch eine je eigene Zeitstelle für sich in Anspruch nehmen kann, weil es
sich im Modus der optisch entindividualisierten Bildwahrnehmung befindet, ist für die Dauer eben dieses Wahrnehmungszustandes vom weltlichen
Geschehen gänzlich emanzipiert. Entsprechend symptomatisch lautet es
bezüglich der quasi-erlösenden Versenkung im Bild: »Ich sehe, ich tauche
ein und bin weg.«86
Obwohl Wiesing beteuert, dass die Bildwahrnehmung »keine Verbesserung, keine Steigerung oder Ergänzung der Normalwahrnehmung«87
darstelle, vermittelt der Duktus seiner Ausführungen den Eindruck einer
enormen weltlichen Entlastungssehnsucht. Tatsächlich geht Wiesings hygienischer Gestus unmittelbar in eine nahezu feierliche Entlastungsrhetorik
über. Auf der einen – ontologischen – Seite wird das Bild für seine ›reine‹,
›saubere‹, materiell ›unbeschmutzte‹ und ›unbelastete‹ Sichtbarkeit bewundert; auf der anderen – phänomenologischen – Seite wird es als Vehikel
einer perzeptuellen Kur gewürdigt. Das Medium wird zum Remedium,
83
84
85
86
87
Auf die Tatsache, dass Wiesings »zunehmende Entmaterialisierung mit einer zunehmenden
Entkörperlichung des Betrachters einhergeht«, hat bereits Bernhard Waldenfels kritisch
hingewiesen. Bernhard Waldenfels: Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie des
Fremden 3, Frankfurt / M. 1999, S. 169, Anm. 24.
Descartes ist Wiesings ausdrückliches Vorbild in seinem Buch Das Mich der Wahrnehmung.
Vgl. Wiesing 2009 (wie Anm. 15), Kap. 2. Dass Descartes selbst einen engen Zusammenhang zwischen Visualität und Taktilität postulierte, gerät vor allem in Wiesings jüngeren
Arbeiten in Vergessenheit.
Vgl. René Descartes: Meditationes de Prima Philosophia / Meditationen über die Erste Philosophie, lateinisch / deutsch, hg. v. Gerhart Schmitt, Stuttgart 1986 [zuerst Paris 1641].
Wiesing 2009 (wie Anm. 15), S. 228.
Ebd., S. 215.
�Körperlose Anwesenheit?
105
durch welches sich das wahrnehmende Subjekt von den leiblichen Zumutungen und Partizipationspflichten der Normalwahrnehmung erholen kann.
Nur deshalb, weil das Bild Zutritt zu einem »metaphysisch[en] Paradies«
gewährt, eignet es sich aus Wiesings Sicht für eine solche »artifizielle
Weltflucht«.88 Möglich wird dies durch die Verkürzung des Bildes auf das
Bildobjekt, welches – wie das Grinsen ohne Katze – anscheinend ganz für
sich existiert und zu einem frei flottierenden Phantom gerät. Wiesings entkörperlichtes Betrachtersubjekt ist somit ein bloßer Bildobjekt-Betrachter.
Entsprechend ist seine Bildtheorie im Grunde eine Theorie der reinen (und
daher unmöglichen) Bildobjekt-Wahrnehmung.
Einmal mehr darf an der Schlüssigkeit von Wiesings ›phänomenologischen‹ Thesen gezweifelt werden. So übersieht Wiesing in seiner Argumentation einen gewichtigen leibphänomenologischen Punkt: Er blendet
aus, in welch hohem Maße sowohl die Möglichkeit als auch der Prozess
der Bildwahrnehmung durch die materielle Präsenz des Bildes bedingt ist.
Die Materialität des Bildes tangiert die Leiblichkeit des Betrachters noch
im physisch unbeschwertesten Wahrnehmungsgeschehen. Um ein Wahrnehmungsobjekt als Bild erfassen zu können, reicht es nicht aus, lediglich
hinzusehen, wie Wiesing behauptet; auch ist es erforderlich, vor einem Bild
eine bestimmte Haltung einzunehmen, die in bedeutender Weise von der
materiellen Präsenz des Bildes bestimmt wird. Ein Bildobjekt mag noch
so stofflos und nursichtbar sein – so lange sich nicht ein ›echter‹ Körper
aus Fleisch und Blut in einer bestimmten Weise auf es richtet, bleibt es
ungesehen. Zwar trifft es durchaus zu, dass die Bildwahrnehmung eine
gewisse Distanz zwischen Bild und Betrachter verlangt, doch ist diese
keineswegs absolut, wie Wiesing unterstellt.
Anhänger der wiesingschen Argumentation mögen gegen unsere Kritik
einwenden, die von uns skizzierten somatischen Aspekte berührten lediglich das Verhältnis zwischen wahrnehmendem Subjekt und materiellem
Bildträger, sodass Wiesings Behauptungen in Bezug auf das Bildobjekt
nach wie vor zu folgen sei. Dieser Einwand läuft allerdings ins Leere. Wie
Phänomene wie die Anamorphose89 oder das pointillistische Gemälde unter
Beweis stellen, bestimmt die Art und Weise, wie wir zu einem Bild ›stehen‹,
sowohl das Was als auch das Wie unserer Wahrnehmung. Wer sich etwa
zunächst unmittelbar vor einem pointillistischen Gemälde positioniert,
um sich sodann sukzessive von diesem zu entfernen, wird bekanntlich die
Erfahrung machen, dass die auf der Leinwand aufgetragenen Konturen und
Farben nach und nach deutlicher und klarer erscheinen. Entscheidend ist,
88
89
Ebd., S. 228.
Vgl. hierzu den Beitrag von Yvonne Schweizer in diesem Band.
�106
Marcel Finke / Mark A. Halawa
dass diese Erfahrung vor allem die Wahrnehmung des Bildobjekts betrifft.
Mit jedem Schritt erscheint dieses ›anders‹ und ›neu‹.90
Für Wiesing ist ein solcher Sachverhalt eine absolute Unmöglichkeit.
Diese Haltung mag im Rahmen seiner Argumentation konsistent sein.
Vereinbar mit zentralen leibphänomenologischen Kernprämissen ist sie
hingegen nicht. Im Gegenteil: Durch seine Hypostasierung des immateriellen
Bildobjekts und die Postulierung eines entkörperlichten Bildwahrnehmungssubjekts entfernt sich Wiesing nicht zuletzt von einer seiner wichtigsten
phänomenologischen wie bildtheoretischen Inspirationsquellen: Maurice
Merleau-Ponty. Von dessen Bemühen, das Rätsel der Wahrnehmung gerade auch im Hinblick auf das Bild immerzu im Ausgang des Leibes zu
untersuchen, um auf diese Weise eine phänomenologische Rekonstruktion
der ›erlebten‹ Wahrnehmung durchführen zu können,91 bleibt in Wiesings Theoriegebäude kaum etwas übrig. Es mag durchaus zutreffen, dass
die Welt auf den Schultern des Subjekts der Bildwahrnehmung weniger
schwer lastet als auf den Schultern eines Subjekts, das sich im Zustand der
Normalwahrnehmung befindet. Vollständig neutralisiert ist die weltliche
Teilhabe am Wahrnehmungsgeschehen damit allerdings nicht. Will sich
eine allgemeine Theorie des Bildes von der ›Lebenswelt‹ der Betrachtenden nicht allzu sehr abwenden, kommt sie folglich nicht umhin, sich in
angemessener Weise der Materialität des Bildes wie auch der Leiblichkeit
des Wahrnehmungssubjekts zuzuwenden.
4. Fazit
Das Anliegen unserer Ausführungen zur Bildtheorie von Lambert Wiesing war zweifach: zum einen sollte auf eine zunehmende Relativierung
und Ausblendung der Materialität des Bildes hingewiesen werden; zum
anderen wollten wir zeigen, inwiefern die methodische Eliminierung der
90
91
Diese Beobachtung ist keinesfalls nur für das Kunstbild gültig. Jede bildliche Darstellung,
sei sie eine gewöhnliche Fotografie, eine Zeichnung oder ein einfaches Strichmännchen,
verwandelt sich dort, wo die räumliche Distanz zwischen Bild und Betrachtendem zu
groß oder zu klein ist, in unübersichtliche Grobkörnigkeit oder ein verschwommenes
Gesichtsbild. Dies ist freilich eine triviale Tatsache. In Wiesings Bildtheorie scheint diese
allerdings ignoriert zu werden.
Vgl. Merleau-Ponty 1947 (wie Anm. 55); ders. 1961 (wie Anm. 55). Vgl. zudem ders.:
Causerien 1948. Radiovorträge, hg. v. Ignaz Knips, übers. v. Joan-Catharine Ritter, Ignaz
Knips u. Emmanuel Alloa, Köln 2006 [zuerst Paris 2002], S. 28, wo es ausdrücklich heißt:
»Unser Verhältnis zu den Dingen ist kein distanziertes, jedes von ihnen spricht zu unserem
Leib und zu unserem Leben […]. Der Mensch ist mit den Dingen verbunden und die Dinge mit ihm.« Zu Merleau-Pontys Phänomenologie des Leibes vgl. Bernhard Waldenfels:
Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes, hg. v. Regula Giuliani,
Frankfurt / M. 2000.
�Körperlose Anwesenheit?
107
Materialität letztendlich auch zu einer theoretischen Entkörperlichung des
wahrnehmenden Subjekts führt. Folgt man der Argumentation Wiesings,
dann spielen materielle Aspekte keine Rolle für die Konstituierung von
Bildlichkeit. Geht es nach ihm, scheint Materialität allenfalls für Kunstbilder bedeutsam zu sein.92 Diese Ansicht ist insofern problematisch, als
die Materialität des Bildes zu einer Art Zusatz degradiert wird, der zum
›eigentlichen‹ Bild hinzukommt und es höchstens um ein ästhetisches
Surplus bereichert. Wiesings Aussage, dass die Materialität des Bildes
nicht erklären kann, »warum es sich bei dem jeweiligen Bild um ein Bild
handelt«93, ist zweifelsohne korrekt. Fragwürdig ist hingegen der Versuch, das Bild gänzlich von seiner Materialität zu trennen, um es auf den
›wesentlichen‹ Aspekt des Bildobjekts zu reduzieren. Ausgelöscht wird auf
diese Weise der ›Grund‹, durch den Bildobjekte allererst in Erscheinung
treten können.94
Die kritische Lektüre der Bildtheorie von Lambert Wiesing führte außerdem vor Augen, dass die Gedankenfigur der internen Duplizität des
Bildes durchaus problematisch ist. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die
Frage, wie sich Bildlichkeit konstituiert. Indem Wiesing den Gegensatz
zwischen Bildträger und Bildobjekt naturalisiert und verdinglicht, um
das Bildobjekt anschließend zu verabsolutieren, schafft er überhaupt erst
die Basis für seine eigenwillige Konzeption des Wahrnehmungssubjekts.
Was sich anfangs ›lediglich‹ als bildtheoretische Grundlagendebatte darstellte, erweist sich voller Konsequenzen und Implikationen hinsichtlich
der Frage, wie die Subjekte der Wahrnehmung konzipiert werden. Hier
deutet sich an, dass die Diskussionen über das ›Wesen‹ und den ›Ursprung‹
physischer Bildlichkeit keine rein bildphilosophischen Diskussionen sind.
Bereits den ›grundlegenden‹ Fragen danach, was ein Bild ist oder was das
Ikonische ausmacht, kann eine subjektivierende Funktion zukommen. Das
wirkmächtige Phänomen der Bildlichkeit wäre demnach sowohl in seiner
konturierenden Wirkung als auch in seiner eigenen kulturellen und sozialen
Konturierung zu begreifen; es ist – ebenso wie die interne Doppelheit von
Bildträger und Bildobjekt – nicht einfach als solches schon gegeben. Weder
lässt sich Bildlichkeit unabhängig von der Materialität des Bildes antreffen
92
93
94
Im Vorwort zur Neuauflage seines Buches Die Sichtbarkeit des Bildes heißt es demgemäß:
»Es ist der Versuch, eine Erklärung zu geben, was etwas zu einem Bild macht. Bei der
Beantwortung dieser […] Frage spielt die jeweilige Materialität und die vielleicht vorhandene Bedeutung des Gegenstandes keine Rolle.« Wiesing 2008 (wie Anm. 15), S. IX.
Ebd. [unsere Hervorhebung]
Vgl. hierzu u. a. Dieter Mersch: Posthermeneutik, Berlin 2010, S. 133−147, sowie dessen
Aufsatz im vorliegenden Band.
�108
Marcel Finke / Mark A. Halawa
noch ist sie vom Körper der Wahrnehmenden ablösbar, in welchem sie
realisiert und vollzogen wird.95
Ein letzter Punkt noch: Die Diskussion der Thesen Wiesings belegte, dass
nicht nur die oft gescholtenen semiotischen oder hermeneutischen Ansätze
dazu neigen, die Materialität des Bildes zu vernachlässigen. Vielmehr ist
bemerkenswert, dass dessen Verabsolutierung der angeblich reinen Sichtbarkeit des Bildobjekts sogar zu einem weitaus radikaleren Ergebnis führt
als die Privilegierung des bedeutungstragenden Darstellungsaspekts in Ansätzen der semiotisch-hermeneutischen Tradition. Während es bei diesen zu
einer Marginalisierung materieller Faktoren kommt, betreibt Wiesing eine
systematische Tilgung von Materialität. Für erstere ist das Moment der
Materialität lediglich im Hinblick auf die Erfüllung kommunikativer und
semiotischer Funktionen von Relevanz, da sie dem Primat der Signifikation
und Interpretation unterstehen. Für Wiesing spielen materielle Faktoren
hingegen nur anfangs eine Rolle, und zwar insoweit, wie sie zum Erscheinenlassen ›körperloser Anwesenheiten‹ nützlich sind. Auch bei ihm kommt
es zu einer Bevorzugung des Darstellungsaspektes, mit dem Unterschied
jedoch, dass er diesen hypostasiert, um die Materialität des Bildes vollends
zu elidieren.96 Die von einem dezidiert phänomenologischen Standpunkt
ausgehenden Überlegungen Wiesings liefern mithin ein besonders extremes
Beispiel für die Vernachlässigung von Materialität. Zu bedenken ist, dass diese
Tendenz auch anhand der Theorien anderer Autoren nachweisbar gewesen
wäre, die sich dem Bild etwa aus wahrnehmungstheoretischer, analytischer
oder anthropologischer Richtung nähern (z. B. bei Reinhard Brandt, Richard
Wollheim oder Hans Belting). Es scheint demnach nicht entscheidend zu
sein, ob man das Bild vorrangig als ein Zeichen bzw. Symbol oder aber
als ein besonderes »Sichtbarkeitsgebilde« (Fiedler) ansieht. Weder sind
semiotische Ansätze per se zur Blindheit gegenüber Fragen der Materialität
verurteilt noch garantieren andere – zumal phänomenologische – Zugänge
von vornherein ein besonderes Bewusstsein dafür. Im einen wie im anderen
Fall mag ein Grund für die Ausblendung und Tilgung der Materialität ihre
Widersetzlichkeit und Virulenz sein, die ihre theoretische Erfassung beständig
irritiert und die es scheinbar deshalb zu negieren gilt – sei es, indem man
sie auf den ›stabilen‹ Ort des Bildträgers verkürzt oder aber indem man sie
nach und nach aus der Problematik des Bildes herausfallen lässt.
95
96
Zu einem ähnlichen Schluss gelangt Emmanuel Alloa in seinem Aufsatz in diesem Band.
Besonders eindrücklich vorgeführt wird dies im Kapitel »Wenn Bilder Zeichen sind«, in:
ders. 2005 (wie Anm. 16), S. 37−80. Dort betont Wiesing, dass die »Materialität des Bildes […] bei der Verwendung des Bildes als Zeichen keine bedeutungsbestimmende Funktion
[spielt].« Relevant sei ausschließlich das nursichtbare Bildobjekt, das als »immaterieller
Signifikant« fungiere.
�
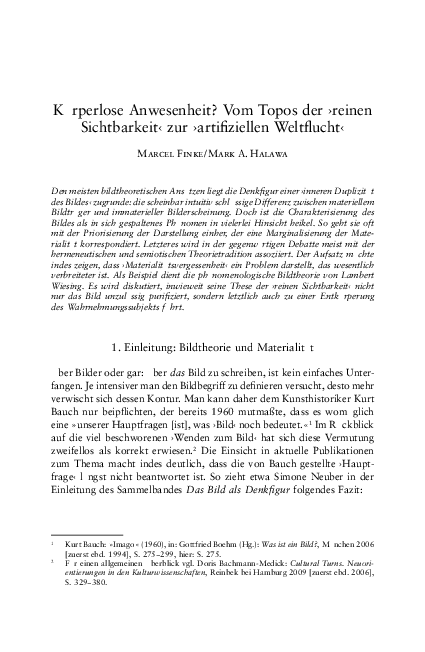
 Marcel Finke
Marcel Finke